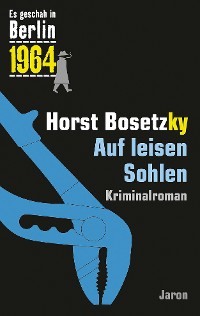Kitabı oku: «Auf leisen Sohlen», sayfa 3
VIER
JÜRGEN STERLEY war Polizeireporter beim Berliner Boulevard Blatt, kurz BBB. Sein Spitzname bei Freunden und Kollegen lautete Pfund, weil viele, die seinen Nachnamen hörten, sofort an die britische Währung dachten, das Pfund Sterling. Tatsächlich aber hatte Sterley seinen Namen einer Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg zu verdanken, aus der seine Urahnen stammten.
Bei den seriöseren West-Berliner Tageszeitungen wie Tagesspiegel, Morgenpost oder Telegraf hätte er niemals eine Anstellung als Polizeireporter bekommen, aber beim BBB wurde er geschätzt. Seine Aufgabe war es, spektakuläre Storys über Berliner Verbrechen zu schreiben. Dabei nahm er es mit der Wahrheit nicht immer sehr genau. Der West-Berliner Großstadtdschungel war Sterleys Revier, und hier war er schon des Öfteren auf eine gute Geschichte gestoßen. Aber seit über einem Jahr war ihm noch kein besonders guter Artikel gelungen. Nicht viel von dem, über das er im Vorjahr berichtet hatte, war ihm im Gedächtnis geblieben. Er erinnerte sich an den Sprengstoffanschlag gegen das sowjetische Reisebüro Intourist am Olivaer Platz, das musste am 5. März 1963 gewesen sein. Oder an den Tod des 22-jährigen Studenten Hans-Jürgen Bischoff fünf Tage später. Der war ums Leben gekommen, als er eine selbstgebastelte Bombe mit einem Zünder versehen wollte. Im Keller seines Wohnhauses Hohenzollerndamm 15 hatte die Polizei sechs Kilo Sprengstoff gefunden. Sterley war dabei gewesen. Am 29. April hatten vier Ost-Berliner im Alter zwischen 19 und 24 Jahren mit einem LKW der NVA am Leuschnerdamm im Bezirk Kreuzberg eine etwa vier Meter breite Bresche in die Mauer gerissen und unversehrt West-Berlin erreicht. Auch darüber hatte Sterley ausführlich berichtet, ebenso über einen Fluchtversuch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da wollten zwei achtzehnjährige Jugendliche aus Neubrandenburg am Mariannenplatz nach West-Berlin flüchten. Die DDR-Grenzposten hatten das Feuer auf sie eröffnet und einen von ihnen erschossen. Sterley hatte in seinem Artikel die Ansicht vertreten, dass auch ein vom Staat beauftragter Mörder zur Rechenschaft gezogen werden müsste.
Mit Genuss hatte er eigentlich nur aus dem Moabiter Schwurgericht berichtet, als Hans-Georg Neumann wegen des «Britzer Liebespaarmordes» zu zweimal lebenslänglich Zuchthaus und dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt worden war. Diese Geschichte war für Sterley das gewesen, was man gemeinhin ein «gefundenes Fressen» nennt. Neumann war als Sohn einer Prostituierten auf die Welt gekommen und in einem städtischen Waisenhaus sowie bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Als Jugendlicher hatte er verschiedene Diebstähle begangen, sich dann aber wieder gefangen und eine Lehre als Feinmechaniker absolviert. 1956 war er nach Kanada ausgewandert, aber fünf Jahre später wegen bewaffneter Banküberfälle verurteilt und nach Deutschland abgeschoben worden. Am 13. Januar 1962 schließlich hatte er im West-Berliner Ortsteil Britz ein in einem geparkten Auto sitzendes Liebespaar entführt und es mit einem Revolver erschossen.
Nach solchen Storys gierte Jürgen Sterley geradezu. Aber auf eine Sensation hoffte er an diesem Montag, dem 21. September, nicht, als ihn das BBB am Nachmittag nach Kladow zu Ludwig Wittenbeck schickte. Der sei gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dass ein Firmeninhaber von einem Einbrecher niedergestochen worden war, fand Sterley zum Gähnen. Aber er hatte nun mal die Aufgabe bekommen, darüber einen Artikel zu schreiben. Also setzte er sich in seinen Fiat 600 D, der ihn immerhin 4410 D-Mark gekostet hatte.
Sterley wohnte im Spandauer Ortsteil Hakenfelde, genauer gesagt in der Streitstraße. Von da waren es bis nach Kladow an die fünfzehn Kilometer. Für Berlin war das nicht viel, für einen geborenen Lübecker eine ganze Menge, da wäre er schon am Timmendorfer Strand gewesen und hätte baden können.
Kladows Wahrzeichen war die alte Dorfkirche, die auf einem kleinen Hügel errichtet worden war. Von dort hatte man es nicht weit zur Anlegestelle, von der die Fähre nach Wannsee übersetzte. Den Flughafen der britischen Schutzmacht hatten sie Gatow zugeschlagen, warum auch immer.
Auf der Fahrt erinnerte sich Sterley an ein anderes Kleinod dieses Ortsteils, das «Schloss» Brüningslinden, das dicht an der Grenze zur DDR lag. Es galt als eine der schönsten Gaststätten Berlins, da man von dort aus eine fantastische Aussicht auf die Havel und ihre Seen genießen konnte. Es war ein kleiner Umweg, aber bevor Sterley Wittenbeck einen Besuch abstattete, stärkte er sich dort erst einmal mit einem «kühlen Blonden», also einem frischgezapften Pils. Einige Gäste, anscheinend Leser des BBB, erkannten ihn und sprachen ihm Lob für seine guten Artikel aus.
Mit einer halben Stunde Verspätung machte er sich dann auf zu Ludwig Wittenbeck. Nur Kleingeister waren pünktlich. Er hielt sich diesbezüglich streng an Oscar Wilde: Pünktlichkeit stiehlt uns die beste Zeit. Über die Sakrower Landstraße erreichte er den Ritterfelddamm, von dem links die Selbitzer Straße abzweigte. Er stellte das Auto am Straßenrand ab und klingelte bei Wittenbeck. Einmal, zweimal – nichts. Sollte Wittenbeck doch noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden sein?
In diesem Augenblick rief ein Nachbar hinter ihm. «Der Wittenbeck wird in der Kaubstraße sein, da hat er sich ’n neues Haus gekauft. Was wolln Se denn von dem?»
«Ich bin von der Presse.»
«Ich geb Ihnen mal die genaue Adresse.»
Sterley bedankte sich und fluchte dann leise, anscheinend hatte man ihm eine falsche Anschrift genannt. Erst einmal studierte er den Stadtplan, denn von einer Kaubstraße hatte er noch nie etwas gehört. Aha, sie lag am Fehrbelliner Platz, zwischen dem Hohenzollerndamm und der Berliner Straße. Er startete den Motor erneut und fuhr Richtung Innenstadt.
Ludwig Wittenbeck machte ihm wegen seiner Verspätung keine Vorwürfe. Er schien froh zu sein, dass ihn überhaupt jemand besuchte. Das machte einen Journalisten wie Jürgen Sterley natürlich neugierig.
«Nach der Messerattacke in Ihrer Firma fühlen Sie sich nicht ganz wohl so ganz allein, oder?», erkundigte er sich.
Wittenbeck versuchte, gelassen zu wirken, konnte aber nicht verhindern, dass sich sein Gesicht schmerzvoll verzog. «Nun, seit meine Frau nicht mehr da ist …»
«Ist sie gestorben?»
«Nein, das nicht … Sie hat mich verlassen … Aber lassen wir das …» Wittenbeck führte Sterley in sein Wohnzimmer, in dem aber nur zwei alte Stühle und ein nagelneues Sofa standen, bat ihn, Platz zu nehmen, und bot ihm einen Whisky vom Feinsten an. Der stand schon auf dem Fensterbrett, zwei Gläser daneben.
Sterley bedankte sich und ließ sich dann noch einmal schildern, wie ihn der Einbrecher mit dem Messer attackiert hatte.
«Meinen Sie, er hat im Affekt gehandelt, weil er Angst hatte, Sie rufen die Polizei? Oder haben Sie das Gefühl, dass der Mann bei Ihnen eingebrochen ist, um Sie zu ermorden?»
Wittenbeck schloss die Augen. Es war ihm anzusehen, wie sehr ihn die Erinnerung quälte. «Ich weiß nicht genau … Beides könnte möglich sein.»
Sterley merkte, wie schwer es Wittenbeck fiel, über dieses Thema zu sprechen, und stellte deshalb eine andere Frage. «Haben Sie denn schon eine Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgesetzt?»
«Ja, natürlich, tausend Mark.»
Sterley sah auf seinen Notizblock. «Sie sind doch Inhaber einer Pharmafirma. Könnte es sein, dass jemand hinter einer Ihrer neuen Rezepturen her gewesen ist – Stichwort Industriespionage?»
Wieder überlegte Wittenbeck sehr lange. «Tja, wir arbeiten gerade an einem neuen Mittel gegen den allergischen Schnupfen auf der Basis von Cromoglicinsäure. Das wäre eine Weltneuheit und könnte viel Geld einbringen.»
Sterley bedankte sich, sagte dann aber, dass er sich kaum vorstellen könne, dass jemand einen Mord begehen würde, um an die Rezeptur für ein neues Mittel gegen Heuschnupfen zu gelangen.
«Haben Sie denn viel Geld im Firmentresor aufbewahrt, Herr Wittenbeck?»
«Viel nicht, aber doch etwas. Und auch ein wenig Schmuck, damit meine Frau … Ach, lassen wir das! Aber die Diebe sind ja ganz scharf auf unsere elektrischen Schreib- und Rechenmaschinen. Wir haben gerade von IBM zwei Schreibmaschinen mit Kugelkopf gekauft.»
Sterley war immer noch ratlos, wie er mit diesen Informationen einen Artikel über Wittenbeck bestreiten sollte, der für das BBB reißerisch genug war. Was er bisher herausgefunden hatte, gab kaum etwas her.
Da klingelte es an der Haustür. Wittenbeck verließ das Zimmer, und Sterley blieb allein zurück. Insgeheim hoffte er auf einen Killer, dann hätte er etwas zu berichten gehabt. Die Wohnzimmertür war angelehnt, und er bekam mit, dass es sich bei dem Gast nur um Thomas Suthfeld handelte. Über den hatte sich Sterley schon informiert und wusste, dass er Wittenbecks Geschäftspartner war. Er lauschte dem Gespräch der beiden.
«Du, Ludwig, ich bin im Augenblick ziemlich klamm und brauche dringend fünfhundert Mark», hörte Sterley Suthfeld in der Diele sagen.
Dann wurde nur noch geflüstert. Sterley schlich zur Zimmertür, um besser hören zu können. Doch die beiden sprachen kein Wort mehr miteinander. Sterley verfolgte durch den Türspalt, wie Wittenbeck eine Aktentasche öffnete, die hinter einigen Farbeimern versteckt war, etwas herausnahm und es Suthfeld gab. Dann verabschiedete sich Suthfeld von Wittenbeck. Der kam zu Sterley zurück, um ihr Gespräch fortzusetzen.
Sterley erkundigte sich zum Schluss noch einmal, ob Wittenbeck so alleine in dem leeren Haus denn keine Angst habe.
Wieder zögerte Wittenbeck mit einer Antwort. «Im Prinzip schon, aber … Ich werde nachher einen guten Freund besuchen, Max Bugsin, der wohnt gleich um die Ecke, in der Koblenzer Straße. Und danach treffe ich mich mit meinen Sauna-Freunden zum Skatspielen. Außerdem gibt es gegen Ängste heutzutage gute Tabletten.»
«Falls Sie doch lieber mit einem Fachmann über das reden möchten, was Ihnen geschehen ist – ich kenne da eine ganz vorzügliche Psychologin: die Charlotte Storkau in der Mommsenstraße», sagte Sterley vertraulich. «Ich lasse Ihnen einfach mal die Adresse hier.»
Uwe Dreetz hatte sich während seiner Liaison mit Gisela Wittenbeck nicht nur Nachschlüssel für die Firmenräume ihres Mannes anfertigen lassen, sondern auch für dessen Villen in Kladow und der Kaubstraße. «Ich brauche also nicht mal einen Einbruch zu begehen», hatte er Freunden grinsend erklärt. «Denn ich breche ja nichts auf, um in sein Haus zu kommen, keine Türen, keine Fenster.»
Nach dem missglückten Versuch in der Firma, bei dem ihn Wittenbeck überrascht hatte, wollte er nun dessen neuer Villa in der Kaubstraße einen Besuch abstatten. Aber dieses Unternehmen gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Erstens durfte niemand im Haus sein, und zweitens durfte ihn keiner beim Aufschließen von Gartentor und Haustür beobachten. Nachbarn waren schließlich neugierig und misstrauisch. Also hatte sich Dreetz etwas einfallen lassen müssen, das heißt, sein Freund Manni hatte sich etwas einfallen lassen. «Bei uns inne Fuldastraße valejen se neue Telefonkabel und ham übam Kabelschacht ’n Zelt uffjebaut, det dit nich rinrejnet. Det bauste nachts einfach ab, fährst damit in die Kaubstraße und baust et da vor det Haus, in det de rinnwillst, wieda uff», hatte der erklärt.
«Prima Idee», hatte Dreetz geantwortet.
«Ick komm jerne mit», hatte Manni angeboten, doch das hatte Dreetz nicht gewollt.
Nun saß er in der Kaubstraße vor Wittenbecks Villa in einem Zelt der Post und mimte den Telegrafenbauhandwerker. Das alles war ziemlich langweilig, aber da musste er durch, denn bei Wittenbeck gab es sicherlich eine Menge zu holen. Ein Lieferwagen, den Dreetz ebenfalls gestohlen hatte, stand ganz in der Nähe in der Mansfelder Straße.
Wittenbeck hatte längeren Besuch von einem Mann. Dreetz war sich sicher, dass er den schon einmal gesehen hatte. Aber wo? Ein Zweiter, der ausgesehen hatte wie ein Geschäftsmann, war gekommen und nach kurzer Zeit wieder gegangen.
Dreetz hoffte, dass Wittenbeck in Bälde das Haus verlassen würde, möglichst zusammen mit seinem Besuch. Anderenfalls gab es für Dreetz nur zwei Möglichkeiten: Entweder blies er die Sache für heute ab, oder er wartete, bis Wittenbeck schlafen gegangen war. Letzteres konnte allerdings noch eine Weile dauern, denn es war gerade einmal achtzehn Uhr. Dreetz gähnte. Hätte er doch Manni mitgenommen! Dreetz setzte sich auf einen Schemel und las in seinem mitgebrachten Jerry-Cotton-Heft, das den Titel Das Todeslied der Unterwelt Teil 1 trug. Kein gutes Omen, fand Dreetz.
Gisela Wittenbeck war mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Sankt-Gertrauden-Krankenhaus eingeliefert worden. Schwindel, Bewusstseinsstörungen, Schlaffheit, Lähmung und Rosafärbung der Haut hatte man in ihre Krankenakte geschrieben. Man hatte sie sofort mit reinem Sauerstoff beatmet, was als hyperbare Oxygenation vermerkt worden war, und eine Störung des Säure-Basen-Haushalts, von Ärzten Azidose genannt, mit Bikarbonat ausgeglichen.
«Wie ist denn das passiert?», hatte man sie gefragt.
«Das weiß ich auch nicht. Ich wollte mir in der Küche meiner Pension Teewasser aufsetzen und habe den Knopf für die rechte Flamme am Gasherd herumgedreht. Und bevor ich das Streichholz anzünden konnte, ist mir schwarz vor Augen geworden, und ich bin umgekippt», hatte sie geantwortet.
Das war aber nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hatte sie den Gashahn aufgedreht, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Pensionswirtin hatte sie ein paar Minuten zu früh gefunden.
Jetzt lag Gisela Wittenbeck bewegungslos da und starrte gegen die Decke ihres Krankenzimmers. Es gab für sie keine Zukunft mehr. Sie hatte alles verloren – das alte Haus in Kladow, das neue Haus in der Kaubstraße, ihren Mann, ihren Beruf. Sie war nur noch ein menschliches Wrack. Und zu alt, um einen neuen Partner zu finden. Nur Gigolos und Kriminelle hatten es noch auf sie abgesehen. Es hieß ja, die Hoffnung stürbe zuletzt. Aber für sie war auch die gestorben. Aus und vorbei. Vielleicht gab es ein Leben nach dem Tod oder eine Wiederkehr auf die Erde in einem anderen Körper, überlegte sie.
Als sie an ihren Mann dachte, packte sie die Wut. Während sie beinahe das Zeitliche gesegnet hätte, hatte der sich vielleicht mit seiner neuen Geliebten im Bett vergnügt. Gott, ein unerträglicher Gedanke! Voller Rachelust stellte sie sich vor, wie sie Ludwig mit seiner Geliebten im Bett liegen sah und mit einer kleinen Pistole auf ihn feuerte. Und wenn sie sich keine Pistole beschaffen könnte, dann würde sie sich eben ins Haus schleichen und den Schlauch vom Gasherd abziehen. Diese Fantasie gab ihr wieder Kraft.
Das merkte auch Gerda Groß, die ihr einen Besuch abstattete. «Im Geheimen habe ich ja überlegt, ob es vielleicht gar kein Unfall war, sondern Sie … Aber wenn ich Sie so sehe, ganz quietschvergnügt …»
«Mir geht es ja auch wieder blendend», behauptete Gisela Wittenbeck.
«Na, dann können Sie sich ja bald eine eigene Wohnung nehmen. Sie können nicht ewig in meiner Pension leben», sagte Gerda Groß. «Ich habe da schon etwas für Sie entdeckt.»
Siegfried Heideblick hatte an diesem Morgen gute Laune, denn er schien zwei dicke Fische an der Angel zu haben.
«Sie strahlen ja so. Haben Sie etwa Karten für das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt am Sonnabendnachmittag?», fragte dann auch Olaf Nonnenfürst.
Heideblick verneinte das. «Zu Hertha gehe ich nicht mehr, die verlieren immer und können froh sein, wenn sie nicht absteigen. Nein, Nonnenfürst, wenn ich Glück habe, kriege ich zwei Aufträge: einen vom Roxy-Kino im ehemaligen Mercedes-Palast und einen von der Albert-Schweitzer-Schule.»
«Die Schule kenne ich, aber von dem Mercedes-Palast habe ich keine Ahnung», musste Nonnenfürst eingestehen.
Heideblick hatte gerade etwas über den Mercedes-Palast in der Zeitung gelesen und sich das als geborener Neuköllner auch gemerkt. «Der Mercedes-Palast war einmal das größte Kino-Varieté Europas, er wurde 1927 eröffnet und verfügte über zweitausend Plätze. Die Preise waren sehr moderat, und es gab sogar eine Stehbierhalle für das einfache Volk. Im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude dann durch Fliegerbomben stark zerstört worden, 1954 wurde das Kino aber wieder als Europa-Palast in Betrieb genommen. 1955 entstand dann durch das Einziehen einer Zwischendecke das Roxy.»
Und dorthin machten sie sich nun zu Fuß auf den Weg. Als sie im Roxy ankamen, war der Geschäftsführer noch nicht vor Ort, aber ein Student, der hier in den Semesterferien arbeitete und sich gelegentlich etwas Kleingeld mit Kulturführungen durch Neukölln verdiente, verkürzte ihnen die Wartezeit mit seinen Erzählungen.
«Wissen Sie, was hier am Abend des 20. Januar 1931 passiert ist?», fragte er die beiden.
Heideblick lachte. «Nee, da war ich gerade einmal zwei Jahre alt.»
Der Student ließ sich nicht beirren. «Gespielt wurde an diesem Tag Zwei Menschen, ein schwülstiges deutsches Liebesdrama von Erich Waschneck, der bei der Verfilmung der Buddenbrooks als Kameramann gearbeitet hatte. Anschließend erfreute die Tanzcombo Zwölf Argentinos die dreitausend Zuschauer mit dem Tango A Media Luz, Im Zwielicht. Und im Zwielicht blieb auch bis heute, was anschließend geschehen ist: Um 21.40 Uhr fand eine Kartenverkäuferin den Geschäftsführer Ernst Schmoller tot in seinem Büro. Zuerst tippte man auf einen Herzschlag, dann entdeckte man aber unterhalb seines Kehlkopfs eine kleine Schusswunde. Es sah nach einem Raubmord aus, denn der Tresor stand offen, und es fehlte eine Menge Geld. Die Ermittlungen leitete ein Kriminalkommissar mit dem Namen Müller, genannt Leichen-Müller. Müller tappte im Dunkeln, schoss sich aber auf den Artisten Karl Urban ein, der vordem Bühnenmeister bei Mercedes gewesen war und nun als Fänger einer Trapeztruppe arbeitete. Er hatte ein Alibi, das aber nicht ganz hieb- und stichfest war, und Schulden noch und noch. Dabei führte er einen luxuriösen Lebenswandel, das heißt, er trug kostspielige Kleidung und hielt sich gern in vornehmen Lokalen auf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war Urban kein Mörder, er legte aber dennoch ein Geständnis ab und wanderte für acht Jahre ins Zuchthaus.»
«Das sollten sie mal bei Es geschah in Berlin bringen und nicht immer nur von den kleinen Eierdieben berichten», sagte Nonnenfürst.
«Ich bin Kriegskind», erwiderte Heideblick. «Ich habe zu viele Tote gesehen, ich mag keine Kriminalromane.»
Dann erschien endlich der Geschäftsführer. Er bat Heideblick und seinen Vertreter, in seinem Büro Platz zu nehmen.
«Ja, mein lieber Herr Heideblick», begann er schließlich, nachdem ihnen die Sekretärin Kaffee gebracht hatte, «ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Es lohnt sich für mich nicht mehr, das Roxy mit einem neuen Gestühl auszustatten, denn die Eigentümer haben soeben beschlossen, hier alles umzugestalten. Man munkelt, dass das gesamte Gebäude zu einem Warenhaus umgebaut werden soll. Dann gibt es für unsere Kinos keinen Platz mehr. Bald werden sowieso alle nur noch zu Hause vor dem Fernseher sitzen, und es wird ein großes Kinosterben geben.»
Heideblick hatte mehrmals hart schlucken müssen. Als sie wieder unten auf der Straße standen, tröstete er sich und Nonnenfürst damit, dass sie ja noch ein zweites Los in der Trommel hatten: die Albert-Schweitzer-Schule. Um die zu erreichen, brauchten sie nur die Hermannstraße hinunterzugehen. Nachdem sie die Flughafen- und die Biebricher Straße gekreuzt hatten, kamen sie am Alten Sankt-Jacobi-Friedhof vorbei.
«Hier liegen meine Eltern», sagte Heideblick. «Und wer weiß, wie lange wir noch …»
«Hören Sie auf, so pessimistisch zu sein!», rief Nonnenfürst und zitierte einen Reim von Fontane: «Die Tränen lassen nichts gelingen: /Wer schaffen will muß fröhlich sein.»
So erreichten sie die Albert-Schweitzer-Schule und lasen im Foyer das große Credo des berühmten Arztes: Ehrfurcht vor dem Leben. Im Zimmer des Rektors mussten sie einen Augenblick warten. Heideblick trat ans Fenster, von dem man auf den Friedhof hinuntersehen konnte. Der Grabstein seiner Eltern war deutlich zu erkennen.
Begraben musste er schließlich auch seine Hoffnung, von der Albert-Schweitzer-Schule einen Großauftrag für neue Schulmöbel und die Neuausstattung der Aula zu erhalten. «Tut mir leid, Herr Heideblick, aber der Stadtrat hat die Mittel nicht freigegeben», erklärte der Direktor.
Heideblick fühlte sich wie ein Boxer, der nach einer krachenden Rechten seines Gegners gerade zu Boden gegangen war und angezählt wurde. Er rappelte sich noch einmal auf. Als sie wieder draußen auf der Karl-Marx-Straße standen, war ihm aber immer noch ein wenig mau.
«Und was tun wir nun, Chef?», fragte ihn Nonnenfürst.
«Ich weiß es nicht. Zunächst einmal muss ich aber ins Gertrauden-Krankenhaus, um meine Tante Gisela zu besuchen.»
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.