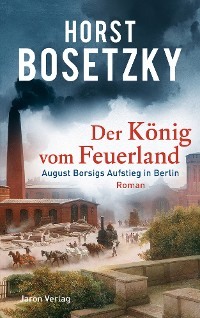Kitabı oku: «Der König vom Feuerland», sayfa 5
»Aber Sträflingskleidung bekommen wir keine?«, murmelte der Zögling, der neben Borsig platziert worden war und auf dessen Namensschild Schäschke stand.
Der Lehrer setzte seine Brille ab und musterte die Versammelten mit dem scharfen Blick eines Criminal-Commissarius, der auf der Suche nach einem Schwerverbrecher war. Das Schweigen wurde immer beklommener. Der Lehrer entschied sich aber, nichts gehört zu haben, und legte das Blatt, von dem er abgelesen hatte, bedächtig in den blauen Aktendeckel zurück.
Borsig schloss die Augen und wünschte sich auf den Dachstuhl zurück, an dem Meister Kiesewetter gerade baute. Unten stand Marie und winkte zu ihm hinauf. In der Ferne zog sich das silberne Band der Oder Richtung Ostsee.
»Der eigentliche Unterricht beginnt nachmittags zwei Uhr.« Damit schritt der Lehrer würdig zur Tür.
Die Zöglinge traten auf die Klosterstraße hinaus und genossen die Herbstsonne, die in diesem Jahr ganz besonders mild war. Es war Zufall, dass Borsig neben Schäschke geriet.
»Wenn der Lehrer das mit der Sträflingskleidung gehört hätte, wärst du gleich geflogen«, sagte Borsig.
Schäschke zuckte mit den Schultern. »Das hätte dieser Sesselfurzer nicht gewagt. Mein Vater kennt zu viele hochgestellte Persönlichkeiten.«
Der alte Schäschke war Juwelier mit einem Ladenlokal in der Nähe des Berliner Schlosses, und Schäschke junior hatte Goldschmied gelernt.
Am Nachmittag erschien Beuth persönlich im Klassenzimmer, um seine Eleven zu begrüßen. Borsig war überrascht von seiner äußeren Gestalt, denn einen Lützow’schen Offizier hätte er sich kraftvoller vorgestellt, vor allem die dünne, helle Stimme des Geheimen Oberfinanzrathes irritierte ihn. Sein altväterlich weit geschnittener blauer Überrock war schon ziemlich abgetragen, da war wohl Friedrich der Große in seinen letzten Tagen in Sanssouci das Vorbild. Hochgewachsen war er und hager, hielt sich aber trotz seiner 42 Jahre noch immer militärisch straff. Den kleinen Kopf bewegte er schnell hin und her, und seine langen Haare wehten dabei durch die Luft wie die eines Kunstmalers oder Pianisten. Mit seinem Halstuch wirkte er auf August Borsig auch eher wie ein Künstler und nicht wie ein Beamter, der für Handel und Gewerbe zuständig war. Ein guter Redner war er, jedes seiner Worte war Aufruf und Mahnung. Er fing die Zöglinge damit ein, dass er von seiner Englandreise erzählte, von der er vor wenigen Tagen zurückgekehrt war.
»Deren hochstehendes Gewerbe hat mich über alle Maßen beeindruckt. Aber was die Engländer können, das können wir auch, wenn wir mit der ganzen Kraft des alten harten Preußentums in die Zeit der Maschinen hinübergehen. Der Fleiß der Gewerbe und der Wille der Handwerker, sich in die Pflicht nehmen zu lassen und Besseres und Vollkommenes zu leisten, sind unseres Glückes Unterpfand. Sich regen bringt Segen. Für jeden Einzelnen wie für unser ganzes Land. Unsere Zukunft wird eine glänzende sein, wenn Sie, meine Herren, in Ihrem Gewerbe glänzen.«
Seine klugen Augen ruhten sekundenlang auf jedem seiner Zöglinge, und Borsig fühlte sich von diesem Blick durchbohrt und bis in die tiefsten Tiefen seiner Seele durchschaut. Schäschke sollte später sagen, Beuth habe jeden derart magisch und intensiv angeblickt, um in ihm ein inneres Feuer zu entzünden.
Doch in August Borsig war dieses Feuer nicht zu entfachen. Im Gespräch, das Beuth mit jedem der Neuen führte, gab er an, Baumeister werden zu wollen und sein Vorbild sei Schinkel. Doch das stimmte nicht. Er war kein Künstler.
Der Herbst ging in den Winter über, die Tage in der Klosterstraße wurden immer trüber, und Borsig litt unter allem. Morgens musste er, wie die Witwe Järschersky es ausdrückte, schon vor dem Wachwerden aufstehen, und oft hetzte er ohne Frühstück durch die dunklen Gassen zum Gewerbehaus. Am schlimmsten war es, wenn von der nahen Spree her die nasskalten Nebelschwaden durch die Straßen zogen. Die Angst, zu spät zu kommen, und der harte preußische Stil nahmen ihm jede Freude am Leben. Beim Einbiegen in die Klosterstraße hörte er das helle, blecherne Gebimmel der Schulglocke. Er war nie ein guter Läufer gewesen und wog auch zu viel, jetzt musste er das Letzte aus seinem Körper herausholen. Atemlos kam er oben an, eine halbe Minute zu spät. Der Lehrer Gänsicke begrüßte ihn wortlos mit einem Blick, der seine ganze Missbilligung zum Ausdruck brachte, griff nach seiner Liste und machte hinter dem Namen Borsig ein Kreuz. Das dritte schon. Beim sechsten flog man von der Gewerbeschule. Als ersten Zögling hatte es gestern den Mechaniker Buttgereit aus Königsberg erwischt.
In der ersten Stunde hatten sie Chemie, und Gänsicke zögerte keinen Augenblick, sich die Zuspätkommer vorzuknöpfen.
»Borsig, sagen Sie uns doch einmal, was Sie über die Theorie der Oxidation wissen, wie sie von de Lavoisier aufgestellt worden ist.«
»Ja, also …« Nichts wusste er von ihr, denn als sie gestern davon gesprochen hatten, war er mit seinen Gedanken dabei gewesen, eine riesige Kuppel für Schinkels neues Museum zu entwerfen.
Alles, was reine Wissenschaft war, und insbesondere die Chemie verabscheute er. Er wollte etwas mit seinen Händen schaffen, egal nun, ob es Holz, Stein oder Eisen war. Was nützte es ihm da zu sehen, wie sich Flüssigkeiten in Gläsern rot oder blau zu färben begannen, wie Gasblasen langsam in kleinen Perlen nach oben stiegen oder wie Stücke von Eisen oder Zink von einer Säure langsam zerfressen wurden?
Als er Beuth zufällig in der Mittagspause allein an seinem Klassenzimmer vorübergehen sah, ging er spontan auf ihn zu und bat ihn, kurz unter vier Augen mit ihm sprechen zu dürfen.
»Gut, Borsig, kommen Sie mit in mein Bureau!«
Dort angekommen, erleichterte August Borsig sein Herz. »Mir ist alles so fremd, und ich will nicht mehr zur Schule gehen – zur dritten schon in meinem Leben! Pardon, aber was ich hier bei Ihnen lerne, das erscheint mir für meine Zukunft unwichtig zu sein, es gibt mir nichts, es bedeutet mir nichts. Ich muss etwas mit meinen eigenen Händen tun, einen greifbaren Stoff vor mir haben, etwas gestalten.«
Beuth hatte ihm aufmerksam zugehört. »Ich kann sie schon verstehen, ganz nach Goethes Faust: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie/Und grün des Lebens goldner Baum. Schön und gut, aber wollen wir fortschreiten in unserem Gewerbe und unserer Industrie, dann müssen wir wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält – und das geht nur mit viel Wissenschaft, also Formeln, Gleichungen et cetera. Und erst recht gilt das, wenn wir Neues schaffen wollen.«
»Ich kann das auch ohne diesen ganzen Firlefanz!«, rief Borsig.
Beuth lächelte. »Sie wollen mich provozieren, Borsig, dass ich Sie verärgert und empört mit einem Federstrich von meiner Anstalt verweise. Aber das tue ich nicht, denn ich halte Sie für den besten Zögling, den wir bislang hatten. In Ihnen steckt etwas, steckt sehr viel, das sagt mir meine Menschenkenntnis, aber das kann sich nur entfalten, wenn Sie noch dazulernen, fremde Gedanken in sich aufnehmen und nicht nur Dampfmaschinen bauen können, sondern auch wissen, welche Gesetze der Physik und der Chemie sie funktionieren lassen. Darum bitte ich Sie: Bleiben Sie noch bei uns!«
Das schmeichelte Borsig, und er sagte zu, sich nun immer strebend zu bemühen und die beiden Jahre an Beuths Gewerbeschule durchzuhalten.
Um sich von all seinen Problemen abzulenken, folgte er am Abend des 23. November einer Einladung Wilhelm Järscherskys, mit ihm zum Kupfergraben zu kommen.
»Da wird erstens Schinkels neue Schlossbrücke eingeweiht, und zweitens gibt es die Hochzeit des Kronprinzen. Vor dem Zeughaus hat man eine Säulenhalle für dreihundert Ehrenjungfrauen errichtet. Mensch, die muss ich sehen! Vielleicht ist auch eine für mich dabei.«
So zogen sie los. Die Hochzeit des Kronprinzen mit der katholischen Prinzessin Elisabeth aus Bayern interessierte Borsig wenig, aber über die neue Brücke wollte er schon schreiten – allein ihres kunstvollen Geländers wegen. Als sie ankamen, war die Brücke aber noch gesperrt. Bei der abendlichen Illumination brachte jemand das Gerücht auf, niemand dürfe heute über die Brücke gehen. Viele wurden nun von der Angst gepackt, nicht mehr rechtzeitig auf die andere Seite der Spree zu kommen und das große Schauspiel der Eheschließung zu verpassen.
»Komm!«, rief Järschersky. »Am Kupfergraben gibt es eine Notbrücke zum Lustgarten hinüber.«
Auf diese Idee kamen aber auch viele andere, und es wurde gedrängelt und gestoßen. Am engen Platz vor der Brücke staute sich alles, und das Geländer am Spreekanal hielt dem Ansturm nicht mehr stand. Es brach weg, und Dutzende von Menschen wurden von den Nachdrückenden über die Kaimauer hinweg ins eisige Wasser gestoßen. So auch August Borsig.
Kapitel fünf 1824
Der Schmiedegeselle Friedrich Hermes aus Breslau war nach Ende eines Wanderjahres in der preußischen Residenz hängengeblieben und hatte Arbeit bei Franz Anton Egells gefunden. Der breitschultrige und bedächtige Westfale hatte Hermes von Anfang an imponiert, zumal er ihn in gewisser Weise an seinen Vater erinnerte.
Heute hatte Egells ganz besonders gute Laune und pfiff immer wieder fröhlich vor sich hin. Alle wussten, woran das lag: Er war frisch verheiratet. Und wenn Egells gut gelaunt war, dann erzählte er gern von seiner Windbüchse: »Meine Waffe schießt ohne Pulver, ohne Feuer, Knall und Rauch – und der habe ich mein Glück zu verdanken. Zu Fuß bin ich von Rheine nach Berlin gelaufen, um dem König meine Erfindung vorzuführen, das schwere Ding über die Schulter gehängt. Und ich durfte sie Friedrich Wilhelm III. auch vorführen. Und zwar im Hof des Schlosses. Die Wachgrenadiere hatten eine Scheibe an die Wand gehängt. Und ich habe gut gezielt an diesem Morgen, Kugel für Kugel fuhr mit leisem Zischen aus meiner Windbüchse und saß. Der König aber winkte ab. ›Büchsen müssen knallen, sonst sind sie doch wirkungslos im Krieg.‹ Aber vergessen war das nicht, und eines Tages wurde ich zu Beuth in die Amtsstube gerufen, und sie haben mich nach England geschickt. Da war ich dann the German spy.«
Hermes gefiel das, und ihm gefiel auch, dass Egells jeden Tag durch die Werkstatt ging und seine Leute fragte, wie es ihnen ginge.
»Na, Hermes, haben Sie schon Anschluss gefunden? Es gibt doch hier in Berlin bestimmt eine ganze Menge Landsleute von Ihnen.«
»Die gibt es sicher, aber ich bin ja erst seit zwei Tagen hier und habe mich noch nicht umhören können. Und ein guter Freund, der August Borsig, soll im November bei der Panik am Kupfergraben umgekommen sein. Das hat mir ein Breslauer erzählt, den ich in Köln getroffen habe. Wir hatten uns aber auch aus den Augen verloren.«
Egells nickte. »Wie das so ist: Aus den Augen, aus dem Sinn.«
Eisen wird technisch gewonnen durch Verhüttung von Eisenerzen mit Kohle in speziellen Hochöfen. Der Hochofen wird von oben abwechselnd mit einer Schicht Kohle und einer Schicht Erz beschickt. Ist man damit fertig, wird die unterste Kohlenschicht entzündet und heiße Luft von unten nach oben durch den Ofen geblasen. Je nach dem Grad der Hitze bilden sich vier Zonen. In der ersten, der unteren Zone, verbrennt die Kohle zu Kohlendioxyd: CO2. In der dritten Zone – das ist die Zone der Rotglut – nimmt das Kohlendioxyd noch ein Atom Kohlenstoff auf und wird zu Kohlenoxyd.
CO2 + C = 2 CO
In der vierten, der heißen Zone, greift dieses Kohlenoxyd das Eisenoxyd an und reduziert es zu Eisen.
Fe2O2 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2
Dieses reine Eisen nimmt jedoch in der Rotglutzone wieder Kohlenstoff auf, schmilzt als kohlenstoffhaltiges Eisen in der zweiten, der Weißglutzone, und fließt unten als Roheisen ab.
So hatte er es von der Tafel abgeschrieben, und dies alles hatte August Borsig zu lernen, und er lernte es auch – wenngleich mit beträchtlichem Widerwillen. Glühendes Eisen war zwar für ihn ein göttliches Material, welche Elemente es enthielt, war ihm aber völlig gleichgültig. Bewunderte er ein Gemälde von Rubens, so spielte es doch nicht die geringste Rolle, welche Stoffe seine Farben enthielten. Die hatte er ganz sicher beim nächsten Händler gekauft und von dem bekommen, ohne chemische Formeln aufsagen zu müssen.
»Ich verplempere doch nicht meine Zeit damit, diesen ganzen Unsinn zu lernen!«, hatte er Järschersky erklärt, und der hatte zustimmend genickt.
Der Lehrer Johann Georg Gänsicke hatte den Zögling Borsig auf dem Kieker und hätte ihn liebend gern von der Anstalt entfernt, musste ihn aber auf Beuths Weisung hin schonend behandeln, denn der Geheime Oberfinanzrath hielt den Breslauer für ein großes Talent. Doch ein wenig piesacken durfte er den widerborstigen Zögling schon. Er wusste, dass sich Borsig über simple Fragen immer ärgerte.
»Borsig, was kann man aus Eisen alles fertigen?«
»Zähne«, knurrte Borsig.
Gänsicke griff nach seiner Kladde. »Das gibt einen Tadel wegen unbotmäßigen Verhaltens.«
»Wieso? Ich habe nur an Friedrich Eisenzahn gedacht, unseren hochverehrten brandenburgischen Kurfürsten.«
»Richtig!«, rief Konrad Schäschke, Borsigs Banknachbar, der ein Faible für die Geschichte Brandenburg-Preußens hatte. »Friedrich II. von Brandenburg, der Eiserne, auch Eisenzahn genannt, geboren 1413 in Tangermünde, gestorben 1471 in Neustadt an der Aisch.«
»Ich glaube nicht, dass dieses Wissen einem Zögling unserer Technischen Schule zum erfolgreichen Abschluss verhelfen wird«, sagte Gänsicke.
August Borsig hasste das Kleinliche und Pennälerhafte an Beuths Schule, sah aber auch ein, dass er ohne ein Mindestmaß an theoretischem Wissen weder ein guter Baumeister noch ein hervorragender Eisengießer und Maschinenbauer werden konnte. Also schleppte er sich jeden Morgen in die Klosterstraße und versuchte, sich die Rosinen aus dem Kuchen zu picken, das heißt nur das in sich aufzunehmen, von dem er annehmen konnte, dass es für sein späteres Fortkommen von Nutzen sein würde. Das Dumme war nur, dass er sein Lebensziel noch immer nicht richtig zu formulieren vermochte. Was ihm so durch den Kopf ging, durfte er keinem anderen erzählen. Reich wollte er werden, Herr sein über viele Arbeiter, von allen geachtet werden – irgendwie unsterblich werden. Er wünschte sich, dass man noch hundert Jahre nach seinem Tod über ihn sprach und dass alle wussten, wer August Borsig gewesen war und was er geleistet hatte, so wie man noch immer Knobelsdorff kannte, der schon 1753 gestorben war, oder gar den genialen Bildhauer Phidias, der große Kunstwerke auf der Athener Akropolis geschaffen hatte.
Wenn er Beuths Schule ertrug, so lag das auch an Konrad Schäschke, mit dem er sich inzwischen angefreundet hatte. Im Mai wurde er von Schäschke nach Hause eingeladen.
»Meine Eltern würden sich freuen, wenn du am Sonntag zum Mittagessen bei uns antrittst.«
Borsig freute sich. »Herzlichen Dank! Wo kann ich euch denn finden?«
»Unter den Linden«, reimte Schäschke. »Auf der Südseite zwischen Kanonier- und Friedrichstraße. Neben dem Bankier Wörlitzer.«
August Borsig fand alles auf Anhieb und riss mit einiger Beklemmung am Klingelzug. Zwischen dem König und den Lumpensammlern gab es viele Bevölkerungsschichten, das wusste er, und so war ihm klar, dass der Juwelier Julius Schäschke um einiges höher stand als der Zimmermann Johann Borsig. Automatisch nahm er eine gewisse Demutshaltung ein, als ihm jetzt geöffnet wurde. Es war das Dienstmädchen, das fragte, wen sie melden dürfe.
Zu sagen, er sei der Zögling August Borsig, fiel ihm schwer, und so murmelte er: »Der Baumeister Karl Friedrich Schinkel.«
Konrad Schäschke hatte das gehört und begrüßte ihn dementsprechend. »Hallo, mein lieber Schinkel, schön, dass Sie mit der Extrapost aus Neuruppin gekommen sind! Mein Vater erwartet Sie schon. Wo haben Sie denn Ihre Pläne für das Schäschke-Schloss draußen in Tegel, gleich neben dem der Humboldts, nur viel größer und schöner und mit einer gewaltigen Kuppel obendrauf?«
»Tut mir leid, die Pläne liegen noch bei Herrn Beuth – ich habe noch keine Note dafür bekommen.«
»Wer lernt bei Beuth, der hat das nie bereut.«
Als Borsig das gute Zimmer der Schäschkes betrat, stockte ihm unwillkürlich der Atem, denn so viel Glanz war ihm noch nie begegnet – den hätte er höchstens im Palais des Kronprinzen vermutet. Gemessen daran hatten sie in Breslau alle in ärmlichen Verhältnissen gelebt – selbst Meister Ihle. Die Wände waren mit leichter mattgrüner Seide bespannt. Um die weiße Decke zog sich eine schmale Goldleiste, und in der Mitte gab es zwei gemalte Rosetten, in denen Leuchter aus Holzbronze hingen. Die Möbel waren weiß lackiert und glänzten im Sonnenlicht. Die Seitenlehnen an den Sesseln und an zwei kleinen Bänken waren Schwanenhälsen nachgebildet. Auf einem Konsoltischchen zwischen den beiden Fenstern stand eine gläserne Glocke, in der sich eine kunstvolle Uhr verbarg. Ein türkischer Soldat mit Schnurrbart und Pluderhosen bewachte sie. In einer Blumenecke standen zwei Gummibäume und eine Zimmerpalme.
Gemütlich und in sich ruhend erschienen ihm die Eltern des neuen Freundes, mit sich und dem Leben zufrieden, und er fühlte, dass sie ihm viel Sympathie entgegenbrachten. Nur Konrads Schwester irritierte ihn ein wenig, denn Auguste Schäschke wich seinem offenen Blick stets aus, musterte ihn aber eindringlich, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Zuerst hatte er gedacht, eine Blinde vor sich zu haben, so gläsern und starr waren ihre Augen, deren Vergissmeinnicht-Farbe etwas Unwirkliches hatte. Groß war sie nicht, fast schien sie ihm ein wenig verwachsen zu sein, doch das konnte täuschen. Die Eltern hatten sie, so vermutete er, fürchterlich verwöhnt, und nun saß sie da, die kleine, nicht eben hübsch zu nennende Prinzessin, und wartete auf ihren Prinzen. Als Borsig der Gedanke kam, er könnte das sein, wurde ihm nacheinander heiß und kalt, und schnell kam er darauf zu sprechen, dass in Breslau seine Braut auf ihn warten würde, die Marie Kiesewetter, Tochter seines letzten Meisters. Auguste überhörte es.
Julius Schäschke berichtete von einer Erfindung, die für sein Gewerbe interessant erschien. »Neusilber nennen sie es. Es handelt sich dabei um Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen mit hoher Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und silberähnlicher Farbe. Es geht zurück auf ein Preisausschreiben des Vereins zur Förderung des Gewerbefleißes. Eine weiße Legierung wollte man haben, die wie Silber aussieht, aber nur ein Sechstel des Silbers kosten würde. Der Geitner in Auerhammer ist als Erster darauf gekommen und hat seine Legierung Argentan genannt, und jetzt haben hier in Berlin die Gebrüder Henniger etwas Ähnliches gefunden, ihr Neusilber. Ich habe aus dem Material bereits Armreifen gefertigt, und die verkaufen sich gut. Der Alfred Krupp will Essbestecke daraus herstellen, denn Bestecke aus Eisen sind ja bis jetzt mit Weißkupfer beschichtet – und das enthält Arsen.«
Konrad Schäschke warf seine Gabel auf den Tisch. »Ihr wollt mich also vergiften?!«
Seine Mutter beruhigte ihn. »Deine Gabel ist aus echtem Silber.«
Als es draußen zu regnen begann, erzählte der alte Schäschke von einer Erfindung aus England. »Da hat ein gewisser Macintosh wasserdichtes Gewebe hergestellt, indem er zwei Stoffbahnen mit einer Gummilösung zusammengeklebt hat.«
»Was Menschengeist so vermag«, sagte Auguste Schäschke.
Ihr Bruder lachte. »Wahrscheinlich ist das nur aus Versehen passiert, und seine Frau hat ihn mächtig dafür ausgeschimpft, dass ihr schönes Tischtuch nun im Eimer ist.«
So verbrachte man zwei gemütliche Stunden miteinander. Als Borsig dann aber wieder in der Münzstraße in seinem Zimmer saß und über alles nachdachte, hatte er kein gutes Gefühl bei allem, denn er empfand Auguste Schäschke als Bedrohung. War sie wirklich entbrannt in Liebe zu ihm und setzte alles daran, ihn zum Traualtar zu führen, dann konnte er schlecht nein sagen, denn sie war eine gute Partie, und alle würden ihn drängen, sie zu nehmen. Mensch, mit dem Geld ihres Vaters kannst du doch der größte Baumeister Preußens werden! Alles schön und gut, aber er konnte Auguste Schäschke nicht leiden, sie war ihm, ohne dass er den Grund dafür gekannt hätte, ganz einfach zuwider.
Und recht eigentlich war er ja mit Marie Kiesewetter verbandelt. Seit er in Berlin war, hatte er ihr mehrere Briefe geschrieben, aber die waren eigentlich nur sachliche Berichte über das, was er an der Spree erlebte, und keine Liebesbriefe. Sie hatte immer brav geantwortet und betont, dass sie auf ihn warten würde, aber von ewiger Liebe und Treue und der Sprache des Herzens war auch bei ihr keine Rede gewesen. Borsig sprang auf. Das musste anders werden! Aber wie? Er war zu vielem in der Lage, aber nicht dazu, einen Liebesbrief zu schreiben. Er probierte es dennoch. Es war aber grausames Zeugs, was er da zu Papier brachte, insbesondere wenn er sich im Reimen versuchte. Sitze ich spätabends hier beim Bier,/Dann lechze ich nach Dir! Nein, so ging das nicht. Gerne hätte er von Goethe abgeschrieben, aber es war kein Gedichtband in der Nähe. So wandte er sich in seiner Not an Wilhelm Järschersky, und der verfasste dann für ihn einen wunderschönen Liebesbrief – er brauchte ihn nur noch abzuschreiben und zur Post zu geben. Als Gegenleistung reparierte er den Dachstuhl der Järscherskys.
Am nächsten Morgen fragte ihn Konrad Schäschke, wie ihm denn seine Schwester gefallen habe, die Auguste.
»Ganz wunderbar.« Wollte er den Freund nicht kränken, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu lügen.
Da waren sie an einem Tag, der halb Winter und halb Frühling war, mit ihrer Klasse unterwegs zu ihrer ersten Exkursion. Beuth wollte, dass seine Zöglinge alle Stätten kennenlernten, in denen das Gewerbe schon blühte. Zu Franz Anton Egells in die Lindenstraße sollte es gehen. Sie liefen im lockeren Klassenverband die Klosterstraße hinunter, überquerten auf der Waisenbrücke die Spree und erreichten über die Wall- die Lindenstraße, deren westliche Seite Teil der Friedrichstadt war, während die östliche zur Luisenstadt gehörte. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, fehlte nur ihr Lehrer. Gänsicke, der in der Nähe wohnte, hatte gleich von zu Hause aus kommen wollen. Fünf Minuten vergingen, ohne dass er erschienen wäre. Zehn Minuten …
»Vielleicht ist er über Nacht verstorben«, sagte Borsig.
Schäschke lachte. »Freiwillig stirbt der nicht, es müsste ihn schon jemand gemeuchelt haben.«
Der Wind blies kräftig von Osten her, und die meisten Zöglinge verzogen sich in den düsteren Torweg. Borsig aber blieb vor dem Gebäude stehen, völlig in Bann geschlagen von dem geheimnisvollen Flackern und dem rötlichen Leuchten hinter den verrußten Fenstern.
Schäschke trat lautlos hinter ihn. »Na, ergötzt du dich wieder an Egells Nachbildung der Hölle?«
»Ich habe eher an einen Vulkan gedacht«, antwortete Borsig. »Magma schießt nach oben.« Die Eisengießerei war für ihn kosmische Schöpfung im Kleinen, der Mensch agierte hier wie Gott. Aus lodernder Materie war die Welt geschaffen worden, aus weißglühendem Eisen schuf der Mensch Maschinen, die seine Kräfte vervielfachten und ihm erlaubten, sich die Erde untertan zu machen.
Schäschke spottete, dass Borsig so aussehe, als hätte ihn ein heiliger Schauder erfasst. Und so war es tatsächlich.
Borsig stellte sich auf die Zehenspitzen. »Ob die Formen wirklich halten, wenn der weißglühende Strom wie ein flüssig gewordener Teufel hineinrast?«
»Bei Schiller hält auch immer alles«, sagte Schäschke und zitierte aus dem Lied von der Glocke:
Wohl, nun kann der Guß beginnen … Rauchend in des Henkels Bogen Schießt’s mit feuerbraunen Wogen. Wohltätig ist des Feuers Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht … Doch furchtbar wird die Himmelskraft, Wenn sie der Fessel sich entrafft …
Gänsicke kam herangefegt, die dünnen Beine schwingend, und sah in seinem abgetragenen und verwaschenen blauen Mantel zum Lachen komisch aus.
»Mir nach!«, rief er, als er im düsteren Torweg angekommen war. »Hinein in die flackernde Innenwelt von Egells Gießerei!«
Egells erschien in der Tür seines winzigen Comptoirs. So breit und kompakt war er, dass er sich ein wenig querstellen musste, um hindurchzukommen. Bedächtig war er, ganz Westfale. Er reichte dem Lehrer die Hand, und sein Händedruck war derart kräftig, dass Gänsicke fast aufgeschrien hätte. Den Gewerbeschülern winkte er kurz zu und begrüßte sie mit herzlichen Worten. »Sie schmelzen wieder«, sagte er, deutete in das Halbdunkel der Halle und blickte auf seine Taschenuhr. »In einer halben Stunde kommt der nächste Guss.«
»Ein Erguss wäre mir jetzt lieber«, murmelte Schäschke.
»Ruhe«, knurrte Borsig, der sich wie bei einem Gottesdienst fühlte und durch keine lästerliche Bemerkung gestört werden wollte.
»Mir nach!«, rief Egells.
Die Zöglinge stampften durch den weichen schwarzen Formsand, der überall in dicker Schicht auf dem Boden lag, und schlängelten sich zwischen Gießkästen und Pfannen hindurch, um den Formgesellen bei der Arbeit zuzusehen. Die schaufelten den Sand in und auf die Holzmodelle und stampften ihn fest. Borsig nahm eine Handvoll auf, um daraus eine kleine Skulptur zu formen. Klebrig war er und von einer Konsistenz, die es zuließ, scharfe Kanten zu bilden. Mit kleinen Schäufelchen, Lanzetten und Stecheisen sorgten die Gesellen für Vertiefungen, die dem gewünschten Rohling entsprachen und in die das glühende Eisen nachher fließen sollte. Ihr Tun erinnerte Borsig an spielende Kinder, außer dass hier äußerste Präzision gefragt und das Ganze hohe Kunst war. Ein Kasten nach dem anderen wurde gebaut und so aufgestellt, dass er mit der Gießpfanne gut erreichbar war.
Von dem Schmelzofen in der Ecke strahlte eine Hitze aus, die Borsig an eine kleine irdische Sonne denken ließ. Neugierig näherte er sich mit Schäschke und einigen anderen dem Stichloch, fuhr aber sofort zurück, denn er hatte das Gefühl, versengt zu werden.
Nun hieß es, bis zum nächsten Abstich zu warten. Borsig ließ seinen Blick durch die Halle schweifen – und konnte nicht fassen, wen er am anderen Ende erblickte. Der junge Schmied, der dort am Amboss stand und den Hammer schwang, das war doch Friedrich Hermes, oder?
Er stürzte hin. »Bist du’s oder bist du’s nicht?«
»Ich bin’s!«
Sie lagen sich in den Armen, doch bald musste Borsig zu seiner Truppe zurück, denn Egells hielt seine Taschenuhr, groß wie ein Gänseei, in der Hand und rief »Abstich!« durch die Halle.
Die Männer in den blauen Arbeitshemden rissen die Gießpfannen vom Boden und schleppten sie an langen Tragestangen zum Ofen. Der Gießmeister rammte eine Eisenstange in das Stichloch und bahnte dem flüssigen Eisen den Weg. Gleißend schoss es aus dem Mund des Ofens, wälzte sich blitzschnell durch die Gießrinne und füllte die Pfannen.
Die düstere, schwärzliche Halle war jetzt in ein magisches Licht getaucht. In ihm trugen die Arbeiter die Pfannen mit der flüssigen Glut zu den Formkästen und gossen die Schmelze vorsichtig in die Formen. Borsig stockte der Atem bei diesem Schauspiel, bei dem der Mensch das feuerflüssige Eisen bändigte und beherrschte. Er fühlte es: Hierher gehörte er, das war seine Welt.
Breslau hatte sich nicht wesentlich verändert, seit August Borsig vor einem Dreivierteljahr nach Berlin gegangen war. Der Bau der Elftausend-Jungfrauen-Kirche, den Karl Ferdinand Langhans 1821 begonnen hatte, war abgeschlossen worden. Vom niedergelegten Nikolaithor hatte man die Sandsteinplastiken, ein Kruzifix, die trauernde Maria und den Apostel Johannes geborgen und an der Außenseite der Kirche eingemauert. Derzeit arbeitete der Baumeister am Blücherplatz, wo die neue Börse entstehen sollte. Die Bezeichnung »Gassen« war in »Straßen« geändert worden, den Königsplatz hatte man neu gestaltet und die Sandgasse in Friedrich-Wilhelm-Straße umbenannt. Als prominenter Gast war August Heinrich Hoffmann von Fallersleben in die Stadt gekommen.
August Borsig saß in der Eilpost nach Breslau, denn die Familie hatte gedrängt, dass er die Schulferien, die Beuth ihm um ein paar Tage verlängert hatte, nutzen möge, seinen zwanzigsten Geburtstag in seiner alten Heimat zu feiern. Am 23. Juli war es so weit, seine Stimmung aber war aus den verschiedensten Gründen nicht sonderlich gut. Zum einen verabscheute er die ewig lange Reise mit den mehrfachen Übernachtungen und hatte schon in Königs Wusterhausen genug von allem. Zum anderen hätte er gern als Held in Breslau Einzug gehalten, doch bis jetzt hatte er so gut wie nichts erreicht – im Gegenteil, er fürchtete, alsbald zu scheitern. Zum Baumeister war er nicht geboren, und ob er als Eisengießer und Maschinenbauer reüssieren konnte, stand in den Sternen. Was die Reise aber erträglich machte und zuweilen sogar amüsant werden ließ, waren drei Reisegefährten, die wie er nach Breslau wollten.
Da war zuerst ein Mann, den Borsig einige Male im Breslauer Rathaus oder auf dem Ring gesehen hatte, der Oberbürgermeister Friedrich August Carl Freiherr von Kospoth. Er war 1767 in Ruppin geboren worden, hatte in Halle studiert und war nach seiner Tätigkeit als Richter in der Provinz Südpreußen 1808 nach Breslau gekommen, wo man ihn 1812 zum Oberbürgermeister berufen hatte. In den Befreiungskriegen wie beim Ausbau der Stadt hatte er sich ein hohes Ansehen erworben.
Wie es Brauch war, hatte man sich miteinander bekannt gemacht, und von Kospoth freute sich, als Borsig erzählte, wie er nach Berlin gekommen war.
»Dann sind Sie ja so etwas wie der Botschafter Breslaus in Preußens Residenz und müssen immer bemüht sein, uns in ein gutes Licht zu rücken.«
»Ich gebe mir alle Mühe«, sagte Borsig etwas hölzern und hoffte nur, dass man noch keinen Bericht nach Schlesien geschickt hatte, in dem man seine Absicht verurteilte, die Schule zu verlassen, weil sie ihn langweile.
»Wie gefällt Ihnen denn Berlin?«, wollte der Oberbürgermeister wissen.
Das war nun eine der abstrakten Fragen, wie sie Borsig gar nicht gerne mochte. »Nun ja … Es ist nicht Breslau. Aber wer in Preußen etwas werden will, der muss wohl oder übel Berliner werden.«