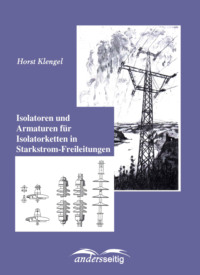Kitabı oku: «Isolatoren und Armaturen für Isolatorketten in Starkstrom-Freileitungen», sayfa 4
1.2. Ketten-Isolatoren
Zu den Ketten-Isolatoren zählen alle Isolatorenbauarten, die in einzelnen oder mehreren Gliedern, meist im Zusammenhang mit Zubehörteilen für die Aufhängung und Abspannung von Leitungsseilen benutzt werden.
Es wird unterschieden in:
Schlingen-Isolatoren (Hewlett insulators). Das sind scheiben- bzw. glockenförmige Isolatoren, deren Isolierkörper zwei im Inneren kreuzweise angeordnete Durchführungskanäle aufweisen. Durch diese Kanäle sind metallene Seilschlingen geführt, die eine Verwendung der Isolatoren einzeln oder in mehreren Gliedern in Trag- oder Abspannlage gestatten.
Der Isolierkörper der Schlingen-Isolatoren wird nur auf Druck beansprucht.
In elektrischer Hinsicht zählen diese Isolatoren zu den durchschlagbaren Isolatoren (Typ B).
Sie werden vorwiegend für Nennspannungen >1 kV einzeln oder in Ketten aus mehreren Gliedern verwendet.
Kappen-Isolatoren (cap and pin insulators). Es sind teller- oder glockenförmige, mit einem oder mehreren Schirmen versehene Isolatoren. Eine über ihrem Isolierkörper befestigte Metallkappe (Isolatorenkappe) und ein in das Innere des Isolierkörpers ragender Metallbolzen (zumeist ein Isolatorenklöppel), gestatten ihre Verwendung einzeln oder in mehreren Gliedern in Trag- oder Abspannlage. Kappen-Isolatoren werden auf Zug beansprucht, wobei der Isolierkörper je nach seiner inneren Bauart mehr oder weniger auf Druck und Scherung beansprucht wird.
In elektrischer Hinsicht zählen Kappen-Isolatoren zu den durchschlagbaren Isolatoren (Typ B).
Kappen-Isolatoren werden für Nennspannungen >1 kV einzeln oder in Ketten aus mehreren Gliedern verwendet.
Vollkern-Isolatoren sind Isolatoren, deren Isolierkörper aus einem Vollzylinder (Vollkern) mit einem oder mehreren Schirmen oder auch mit Rippen besteht. An den Enden des Isolierkörpers sind Metallkappen (Isolatorenkappen) befestigt, die eine Verwendung einzeln oder in mehreren Gliedern in Trag- oder Abspannlage gestatten.
Vollkern-Isolatoren werden auf Zug beansprucht.
In elektrischer Hinsicht zählen sie zu den nicht durchschlagbaren Isolatoren (Typ A).
Diese Isolatoren werden vorwiegend für Nennspannungen >1 kV und nur selten unter 1 kV verwendet.
Langstab-Isolatoren (long rod insulators). Das sind Isolatoren, deren Isolierkörper aus einem langen Vollzylinder (Vollkern) mit zahlreichen Schirmen besteht. An beiden Enden des Isolierkörpers sind baugleiche Metallarmaturen (Isolatorenkappen) angebracht, die eine Verwendung der Isolatoren einzeln oder in mehreren Gliedern in Trag- oder Abspannlage zulassen.
Langstab-Isolatoren werden auf Zug beansprucht.
In elektrischer Hinsicht gehören sie zu den nicht durchschlagbaren Isolatorenbauarten (Typ A).
Sie werden ausschließlich für Nennspannungen >1 kV verwendet.
Verbund-Isolatoren (composite insulators) sind Isolatoren, deren Isolierkörper aus einem langen zylindrischen, massiven Isolierkern (Vollkern) zur Aufnahme der äußeren mechanischen Belastungen besteht, der durch eine aus elastomeren Werkstoff gefertigte Umhüllung, die mit Schirmen versehen ist, geschützt wird. Die Krafteinleitung in den Isolierkern erfolgt an beiden Enden durch unterschiedliche oder gleiche hülsenförmige Metallarmaturen, die auf den Isolierkem aufgepresst sind. Der Isolierkern besteht üblicherweise aus Glasfasern, die mit einer Polymermatrix verbunden werden.
Verbund-Isolatoren können einzeln oder in mehreren Gliedern in Trag- oder Abspannlage eingesetzt werden. Sie werden auf Zug beansprucht.
In elektrischer Hinsicht gehören sie zu den nicht durchschlagbaren Isolatoren (Typ A). Sie werden ausschließlich für Nennspannungen >1 kV eingesetzt.
* * *
Zur Entwicklungsgeschichte der Ketten-Isolatoren:
Für höhere Nennspannungen ist die Verwendung von Stützen-Isolatoren und Freileitungs-Stützern in der Regel begrenzt, da bei diesen
* für die modernen Bauweisen der Freileitungen die Mindestbruchkräfte nicht mehr ausreichen,
* die Überschlagspannungen mit der Vergrößerung der Abmessungen nicht im gleichen Verhältnis zunehmen und
* die eintretende große Zunahme des Isolatorengewichtes Grenzen setzt.
Bedingt durch neue Forderungen beim Ausbau der Freileitungsnetze durch
- Erhöhung der Betriebsspannungen,
- Vergrößerung der Leiterseilquerschnitte und
- Vergrößerung der Spannweiten,
erreichte der Stützen-Isolator schnell seine Grenzen. Es begann Mitte der 20er-Jahre in den Freileitungen mit Spannungen über 30 kV eine Verdrängung der Stützerbauweise durch die Hängerbauweise mit "Ketten-Isolatoren". Das Prinzip der starren Befestigung des Isolators am Mast wurde verlassen.
Stütz-Isolatoren besitzen gegenüber den Ketten-Isolatoren einige entscheidende Nachteile, die ihre Anwendung für Hochspannungs-Freileitungen moderner Bauart in Frage stellen:
* Die feste Verbindung des Leiterseiles mit dem Isolator und die des Isolators mit dem Mast, bildet ein starres System, welches Isolator, Seil, Mast und Gründung zusätzlich belastet.Durch das elastische System der Ketten-Isolatoren wird eine höhere Betriebssicherheit gegenüber äußeren Einwirkungen, wie Sturm und ungleiche Eislast erreicht, da insbesondere die aus Ketten-Isolatoren gebildeten Tragketten durch Ausweichen die Belastungen auf mehrere Spannfelder verteilen können.
* Die mehrscherbigen, zusammengesetzten Stützen-Isolatoren brachen nach einer Reihe von Jahren durch Kräfte, die infolge der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Zement-Kittung und Porzellan zwischen den Einzelteilen des Isolatores entstanden. Der einheitliche keramische Aufbau der Ketten-Isolatoren vermeidet dieses Problem.
* Den Größenabmessungen der Stützen-Isolatoren waren aus technischen und fabrikatorischen Gründen Grenzen gesetzt. Die Herstellungskosten für Stützen-Isolatoren für höhere Spannungen stiegen in viel stärkerem Maße, als die Spannung, die zu isolieren war. Die maximal mögliche Betriebsspannung, für die Stützen-Isolatoren noch hergestellt werden konnten, lag bei 75 kV[22].Bei Ketten-Isolatoren kann im Gegensatz dazu durch Aneinanderreihung von Einzelgliedem die jeweils gewünschte Isolation und Betriebsspannung erreicht werden. Durch Einfügung weiterer Einzelglieder läßt sich leicht die elektrische Sicherheit der Isolation erhöhen.
* Die Sicherheit der Bunde zur Seilbefestigung am Stütz-Isolator ist sehr von den handwerklichen Fähigkeiten der Monteure abhängig. Die Befestigung des Leiterseiles an Isolatorketten aus Ketten-Isolatoren geschieht dagegen mittels Klemmen (Trag- und Abspannklemmen), deren Haltekraft wesentlich weniger von der Montage-Qualität abhängt.
Aus diesen Gründen entschied man sich bereits 1910 bei der Projektierung der ersten europäischen 110-kV-Freileitung von Lauchhammer nach Riesa für den Einsatz von Ketten-Isolatoren [22].
Auch die 1924 einsetzende Entwicklung des Freileitungs-Stützers konnte die oben genannten Nachteile der Stützen-Isolatoren für Freileitungen mit Nennspannungen über 100 kV nicht beseitigen. Erst die Entwicklung der Ketten-Isolatoren, mit denen durch Aneinanderreihung von einzelnen Isolatoren, die durch Metallteile verbunden werden, beliebig lange Isolierstrecken hergestellt werden konnten, brachte den entscheidenden Fortschritt im Hochspannungs-Freileitungsbau.
1936 sah man die Hauptvorteile der Ketten-Isolatoren in folgenden Punkten [42]:
* leichte Lagerhaltung,
* Unterteilung der Spannung auf mehrere Isolatoren,
* hohe Überschlags- und Durchschlagsicherheit,
* geringe Überbrückungsmöglichkeiten durch Zweige und Vögel,
* Ermöglichung großer Spannweiten,
* leichte Auswechselmöglichkeit beschädigter Einzelglieder,
* das Leiterseil ist nicht unmittelbar am Isolator befestigt.
1.2.1. Schlingen-Isolatoren
Aus der Forderung heraus, Porzellan mechanisch nur auf Druck zu beanspruchen, führte die Entwicklung von Ketten-Isolatoren zunächst zu Isolatorenformen, die auf dem Grundprinzip des "Isolier-Eies" beruhten (Bild 221) [189].

Bild 221: Grundprinzip des Isolier-Eies
Die ersten brauchbaren Isolatoren nach diesem Prinzip entstanden 1907 in den USA in Form der "Hewlett-Isolatoren" [22], in Deutschland "Schlingen-Isolatoren" genannt (Bild 222 und 223). Sie wurden zuerst von der General Electric Co. (USA) hergestellt und bereits bei der 110-kV-Freileitung Grand Rapids Muskegon eingesetzt [65], [274].
Bild 222: Original-Hewlett-Hängeisolator
Bild 223: Original-Hewlet-Abspannisolator (link strain typ)
Edward M. Hewlett erfand gemeinsam mit Harold W. Buck diesen Isolator, der in der ganzen Welt lange Zeit den Freileitungsbau beherrschte [20], [190], [191]. So wurden u. a. auch
- die erste kanadische 110-kV-Freileitung zwischen den Niagara-Fällen und Detroit (ca. 500 km) 1908 mit 5-gliedrigen Isolatorenketten aus Hewlett-Isolatoren [192],
- ein System der Freileitung Lauta-Gröditz (Sachsen) und auch
- die Freileitungen des Bayernwerkes der 1. Ausbaustufe damit ausgerüstet.
In Deutschland wurde der Schlingen-Isolator in 2 "normalisierten" Ausführungen hergestellt [88]:
- als Hängeisolator (Bild 224 ) und
- als Abspannisolator (Bild 225).
Die einzelnen Isolierkörper wurden dabei zunächst mit doppelt geführten Seilen, die durch einfache Doppelklemmen geklemmt waren, verbunden [20], [190] und später dann mit Seilschlingen aus Stahl- oder Kupferseil (Querschnitt 35 qmm oder 50 qmm) kettengliederartig umschlungen, so dass bei Bruch eines Isolierkörpers das Leiterseil nicht herabfallen konnte [203].

Bild 224: Hewlett-Hängeisolator, normalisierte deutsche AusführungBild 225: Hewlett-Abspannisolator, normalisierte deutsche Ausführung
Die offenen Seilschlingen der Form "O" (Bild 227) [195], die an den Enden mit Halbkugeln versehen waren, wurden bei der Montage zur Isolatorkette mit Schlingenverbindem verbunden (Bild 226), wobei sich in Deutschland der Schlingenverbinder nach Bay (AEG) [193], [194] besonders bewährte (Bild 226).

Bild 226: Seilschlingen und Schlingenverbinder am Hewlett-Isolator

Bild 227: Seilschlinge für Hewlett-Isolatoren (Form "O")
Die mit einer durchgehenden Bohrung versehenen Halbkugeln an den Schlingenenden, wurden durch kleine Konen mit dem Schlingenseil verbunden.

Bild 228: Schlingenverbinder (System Bay) zum Schließen von Seilschlingen der Form "O"
Der Bay-Schlingenverbinder besteht aus 2 gleichgeformten Schalen zur Aufnahme der Halbkugeln der Seilschlingenenden. Diese Schalen werden beidseitig durch übergeschobene Halbschalen zusammengehalten und durch Splinte gesichert (Bild 229) [193].
Ein weiterer Schlingenverbinder war die Konuskupplung der AEG [20].
Seilschlingen der "O-Form" wurden zunächst nicht nur zur Verbindung der Einzelglieder angewandt, sondern mit Hilfe von Rollen auch zur Verbindung mit den Kettenzubehörteilen an den Enden der Isolatorkette (Bild 229 bis 231) [88].

Bild 229: Doppel-Abspannkette mit Hewlett-Isolatoren und Seilschlingen Form "O"

Bild 230: Einfach-Tragkette mit Hewlett-Isolatoren und Seilschlingen Form "O"

Bild 231: Doppel-Tragkette mit Hewlett-Isolatoren und Seilschlingen Form "O"
Diese Bauweise führte zu sehr langen Isolatorketten. Zu deren Verkürzung wurden deshalb Seilschlingen der Form "U" (Bild 232) entwickelt, die in Verbindung mit sog. "Hänge-Seilschlössem" (Bild 233 und 234), die End-Isolatoren der Ketten direkt mit dem Mast bzw. den Trag- oder Abspannklemmen verbinden konnten [52], [195].

Bild 232: Seilschlinge Form "U"

Bild 233: Seilschlösser mit Ösen-bzw. Klöppelanschluß für Seilschlingen der Form "U"
Bild 234: Fertig montierte Seilschlingen der Form "U" mit Hänge-Seilschlössern
Eine weitere Verbesserung an Hewlett-Isolatorketten wurde durch die Einführung von Seilschlingen der Form "S" und deren Verbindung mit Kreuz-Schlingenverbindem (Bild 235) erreicht [88], [203].

Bild 235: Seilschlinge Form "S" mit Kreuz-Schlingenverbinder
Die Porzellanfabriken Hermsdorf und Freiberg hatten dazu 1921 einen Kreuz-Schlingenverbinder geschaffen [196], [204], dessen 2 gleiche Schalen sich einfach zusammenschieben ließen und sich deshalb durch eine leichte Handhabung auszeichneten (Bild 236).
Bild 236: Schlingen-Isolatoren mit Kreuzschlinge (Seilschlinge Form "S") und Schalen-Schlingenverbinder
Durch die S-Form und die Führung der Seilschlinge durch die Mitte des Kreuz-Schlingenverbinders, konnte das Rutschen der Seilschlingen im Isolierkörper und das Anschlagen der Schlingenverbinder am Isolierkörper verhindert werden. Außerdem trat durch die Kreuzung der Seile
* eine Verkürzung der Isolatorketten,
* eine ca. 15 % ige Erhöhung der Trockenüberschlagspannung und
* eine ca. 10 % ige Erhöhung der Regenüberschlagspannung ein. Nachteilig wirkte sich die Seilkreuzung jedoch auf die Bruchkraft der Isolatorkette aus, die um ca. 15 % sank.
Einfach-Tragketten mit verschiedenen Seilschlingen zeigen die Bilder 237 und 238 [88].

Bild 237: Einfach-Tragkette mit Hewlett-Isolatoren und Seilschlingen Form "O" und Form "U"

Bild 238: Einfach-Tragkette mit Hewlett-Isolatoren und Seilschlingen Form "S" und Form "U"
Das elektrische Feld entlang einer 7-gliedrigen Einfach-Tragkette aus Hewlett-Isolatoren ist in Bild 239 dargestellt [197].
Bild 239: Elektrisches Feld einer Tragkette aus Hewlett-Isolatoren
Besonders interessant ist dabei die elektrische Feldstärke im Bereich der Glieder der Isolatorkette in der Nähe der Befestigung des Leiterseiles (Bild 240).

Bild 240: Elektrisches Feld am leiterseitigen Kettenende einer Hewlett-Isolatorkette
Aus Bild 239 und 240 läßt sich an Hand der eingezeichneten Äquipotentiallinien die ungleiche Spannungsverteilung entlang der Isolatorkette erkennen. Für die Isolatorketten mit Hewlett-Isolatoren wurden auch Lichtbogenhörner entwickelt [196], [274], die neben dem Schutz der Kette vor Lichtbögen, zur Verbesserung der Spannungsverteilung beitragen sollten.
Der Bruch eines Isolierkörpers in Isolatorketten aus Schlingen-Isolatoren bedeutete den Ausfall der elektrischen Isolierfähigkeit eines Kettengliedes, die mechanische Festigkeit der Kette blieb jedoch erhalten.
Beim Betrieb der Freileitungen mit Schlingen-Isolatoren, ergaben sich mit der Zeit entscheidende Nachteile [194]:
- Durch das ständige Scheuern der Seilschlingen in den Kanälen des Isolierkörpers und den dadurch verursachten Abrieb des Seiles sank die Festigkeit der Seilschlingen.
- Die Seilschlingen und auch die Schlingenverbinder waren nicht schwingungsfest und es kam zu deren Bruch, verbunden mit Kettenabstürzen [99].
- Bei einem Lichtbogen über der Isolatorkette konnten die Seilschlingen durchbrennen, da sie für hohe Lichtbogenströme nicht ausreichend bemessen waren [205].
- Der Durchschlagweg des Isolierkörpers ist sehr klein, wodurch nur ein geringes Isoliervermögen des Einzelgliedes vorliegt. Dadurch werden die Isolatorketten sehr lang und haben insgesamt nur eine geringe mechanische und elektrische Sicherheit.
An Stelle der Seilschlingen verwendete man später in Deutschland auch Metallbänder, was in mechanischer Hinsicht einen wesentlichen Fortschritt darstellte (Bild 241) [198]. Die Kanäle im Isolierkörper der Schlingen-Isolatoren wurden dabei rechtwinklig ausgeführt (Porzellanfabrik Rosenthal) [20].

Bild 241: Schlingen-Isolator für flache Metall-Verbindungsbänder
Derartige Isolatoren fanden u. a. 1911 auf der 60-kV-Leitung Dessau-Bitterfeld Anwendung.
Die Herstellung der Isolierkörper der Schlingen-Isolatoren war schwierig. Sie erfolgte entweder durch Drehen oder Gießen [206].
Beim Drehen wird der Porzellanmassehubel von Hand aufgedreht und mittels Formen und Schablonen in eine geeignete Form gebracht. Danach werden die gekreuzten Kanäle in den Drehkörper eingebracht, wobei die dazu angewandten Verfahren von den einzelnen Herstellern geheim gehalten wurden, da hierin der schwierigste Punkt der Herstellung lag. Das Drehen ergibt pozellantechnisch das dichteste und rißfreieste Porzellan. Durch das Einbringen der Kanäle wird jedoch die homogene Struktur erheblich gestört und verletzt.
Beim Gießen wird flüssige Porzellanmasse (Schlicker) in eine Gipsform, in der die Kanäle schon vorhanden sind, gegossen. Der Schlicker ist so angesetzt, dass ein gutes Fließen in der Form und danach ein rasches Trocknen eintritt. Dieses Herstellungsverfahren ist wesentlich einfacher, als das Drehen. Die gegossenen Isolierkörper haben aber bei weitem nicht die Dichte, wie die gedrehten. Im Inneren befinden sich meist Schlieren und Hohlräume.
Ähnliche Entwicklungen von Ketten-Isolatoren, die nach dem Grundprinzip des Isolier-Eies 1924 in England entstanden, die sog. "Interlink Insulator Discs" (Bild 242), verwendeten an Stelle der Seilschlingen geschmiedete Stahlbügel (Schäkel), die die Nachteile der Seilschlingen verminderten.

Bild 242: Englische Kettenisolatoren, nach dem "Isolier-Ei"-Prinzip
1920 wurden von der Porzellanfabrik Hermsdorf Schäkel-Isolatoren für Trag-und Abspannketten entwickelt, die kreuzweise mit Laschenpaaren verbunden wurden und damit das Isolierei-Prinzip verwirklichten (Bild 243) [28].

Bild 243: Isolatorkette aus Schäkel-Isolatoren
Durch die Anordnung des Mittelbolzens und eine den Isolierkörper umfassende Schelle ergibt sich eine hohe Bruchsicherheit, selbst bei völliger Zerstörung des Isolierkörpers. Eingefügte Bleihülsen um den Mittelbolzen sollten alle punkt-und linienförmigen lokalen Druckstellen beseitigen.
1927 berichteten Montandon und Le Moigne [200] über die Lösung schwieriger Isolationsprobleme auf einer 70-kV-Freileitung an der Küste von Marokko: Hoher Salzgehalt, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Normale Hewlett-Isolatoren in 4-gliedrigen Ketten versagten. Es wurden daher die Abspannisolatoren mit einer nahezu geschlossenen Höhlung versehen, die vor einem Salzniederschlag fast völlig schützt (Bild 244). Für die Tragketten fanden Isolatoren mit einer topfartigen, nach oben gerichteten Höhlung, die mit Öl gefüllt wurde, Anwendung. Um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, waren diese Isolatoren an ihrer Unterseite mit einem weit ausladenden Metallschirm versehen, der den darunterliegenden Isolator schützte (Bild 245) [200]. Zur Verbindung der Einzelglieder der Isolatorkette fanden U-Bügel mit speziellen Verbindungsarmaturen (Schlössern) Anwendung. 1931 waren ca. 49 000 solcher Isolatoren in Tragketten eingebaut [202].

Bild 244: Hewlett-Abspannisolatoren für Verschmutzung durch Meeressalz

Bild 245: Hewlett-Hängeisolatoren für Verschmutzung durch Meeressalz
Nach 1930 sind in Deutschland die Schlingen-Isolatoren vom Markt verschwunden. Sie wurden für Leitungsneubauten nicht mehr eingesetzt [207]. Ihr Ersatz in bestehenden Freileitungen durch andere Typen von Kettenisolatoren erfolgte nach und nach (siehe Bild 429).