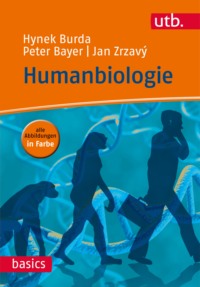Kitabı oku: «Humanbiologie», sayfa 5
Auch die traditionelle Interpretation von modernen, aber sehr alten (115–135 tya) menschlichen Überresten in Israel (Qafzeh and Skhul) als Hinweis auf einen ersten aber erfolglosen Auswanderungsversuch aus Afrika, wird durch aktuelle Molekulardatierung angezweifelt. Demnach scheinen diese Funde ein Beweis für eine frühe Phase erfolgreicher Migration heutiger Menschen aus Afrika zu sein. Darüber hinaus zeigen neue Funde von einander ähnlichen alten Werkzeugen (leider bisher nicht von Skelettresten) offensichtlich nordafrikanischer Herkunft aus weiten Gebieten des Nahen Ostens (bis nach Jebel Faya in den Vereinigten Arabischen Emiraten), dass sich der Mensch dort schon zu einer Zeit erfolgreich ausgebreitet hatte, als er den vorherrschenden Theorien gemäß noch ausschließlich Afrika hätte bewohnen sollen – allerdings ist die Beziehung dieser Population zur heutigen Menschheit ganz rätselhaft. Und auch das umgekehrte Phänomen gibt es, nämlich dass sich Menschen, die morphologisch eher dem „archaischen“ H.sapiens entsprechen, erstaunlich lange gehalten haben: sie überlebten bis ins Holozän in Afrika (Nigeria: Iwo Eleru, 12 tya), und erstaunlicherweise auch in China („Rotwild-Menschen“ aus den Lokalitäten Longlin und Maludong, 11–14 tya), wo sie vielleicht eine eigenständige, in gewissem Sinne parallele Linie zu den europäischen Neandertalern bildeten.
3 Geschichte gegenwärtiger menschlicher Populationen
3.1 Innerartliche Diversität
In der Vergangenheit gab es keine Zweifel darüber, dass der Mensch eine ausdrücklich polytypische Art ist (vergleiche Box 1.2) – und in dieser Hinsicht vergleichbar mit z.B. dem Tiger oder Braunbär. Die unterschiedlichen lokalen Populationen wurden routinegemäß als „Unterarten“ oder „Rassen“ bezeichnet (Box 3.1). Mit dem Konzept der menschlichen Rassen wurde oft auch der „Polygenismus“ verbunden: Die Vorstellung, dass die menschlichen Rassen in einer Isolation auf den einzelnen Kontinenten aus unterschiedlichen lokalen Vorfahren entstanden sind („mongoloide Rasse“ aus Orang-Utan, „negroide Rasse“ aus Gorilla und „europoide Rasse“ aus Schimpansen), überlebte in unterschiedlichen Formen (unterschiedliche Taxonomien der menschlichen „Rassen“) bis in die 1930er-Jahre, obwohl diejenigen Persönlichkeiten, die stellvertretend für die Geburt der Evolutionsanthropologie bereits im 19. Jahrhundert stehen (Darwin, Huxley und Haeckel), den Menschen richtigerweise für eine monophyletische Art gehalten haben.
Box 3.1
Der Rassenbegriff in der Biologie, Anthropologie und Politik
Mit dem Rassenbegriff hängen folgende Fragen zusammen: Kann man die Menschheit in einige wenige Gruppen (Typen) einteilen? Wie groß sind die Unterschiede zwischen diesen Gruppen? Wie sollte man diese Gruppen (falls es sie gibt) nennen? Kann man aus der Existenz der Einteilung in die Gruppen etwas über ihre Wertigkeit ableiten?
Die letzte Frage wurde durch rassistische Ideologien aufgegriffen, die aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse politische Folgen ableiteten, im Sinne, dass einige Rassen wertvoller sind als andere und das Recht oder die Pflicht haben, die „minderwertigen“ zu beherrschen oder sogar zu liquidieren. Der Rassismus kulminierte mit dem deutschen Nationalsozialismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da deren Ideologien die menschlichen Gruppen als Rassen bezeichneten, haben sie den Begriff der Rasse diskreditiert. Man sollte also stets daran denken, dass Rassismus eine Ideologie und keine Wissenschaft ist, auch wenn oft pseudowissenschaftlich argumentiert wird.
Der Begriff Rasse wurde durch den französischen Naturforscher, Georges-Louis Leclerc de Buffon (1701–1788) in die Biologie eingeführt. Er nutzte diesen Begriff nicht im taxonomischen Sinne, sondern bezeichnete damit ganz allgemein eine Gruppe von Organismen, die beliebig festgelegte Eigenschaften miteinander teilten. Buffons Zeitgenosse und Rivale, Carl von Linné (1707–1778) teilte die Menschen in vier unterschiedliche geografische Unterarten ein – er hat sie aber nicht als Rassen bezeichnet. Sein Konzept beruhte auf einer Idealisierung und Verallgemeinerung, nicht auf der Realität. So definierte Linné in seiner Historia naturae (1758) Homo sapiens europaeus albus (also den weißen europäischen H.sapiens) unter anderem mit folgenden Merkmalen: blaue Augen und langes blondes Haar. Auch in seiner Heimat, Schweden, entsprachen jedoch bestimmt nicht alle Menschen dieser Beschreibung – Linné hat hier also einen metaphysischen Archetyp beschrieben und nicht die real existierende Vielfalt.
Erst die nachfolgenden Generationen haben das Konzept von Linné mit dem Buffonschen Begriff fusioniert und so den Begriff „Rasse“ kreiert, der bis in das 20. Jahrhundert regulär in der Anthropologie und Humanbiologie gebräuchlich war. Der Begriff Rasse war – im Sinne von Buffon – nicht begrenzt auf einzelne Kontinente, wurde aber auf eine beliebige Sprach-, Volks- oder Religionsgruppe angewandt („deutsche Rasse“, „jüdische Rasse“). Anfang der 1930er-Jahre wurde der Begriff zunehmend im populationsgenetischen Sinne verwendet. Letztlich fatal für den Begriff war schließlich der politische Missbrauch durch die nationalsozialistische Ideologie, wie aber auch andere rassistische Ideologien (ob in den USA, Südafrika oder anderswo). Da eine Politik den Begriff missverstanden und für ihre Zwecke instrumentalisiert hat, hat ihn die nachfolgende Politik auch missverstanden, in der Wissenschaft tabuisiert und an den Pranger gestellt. (Diese Entwicklung ist nicht überraschend und es ging besonders von Deutschland, den USA und den Ländern mit ehemaliger Kolonialherrschaft aus.)
Da der Begriff Rasse nun tabu, doch es weiterhin offensichtlich war, dass man die Menschheit in bestimmte Gruppen einteilen kann, wurde nach einem Ersatzbegriff gesucht. Erfolgreich hat sich letztendlich der Begriff Ethnie (Volk) durchgesetzt. Als Ethnie wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, denen eine kollektive Identität zugesprochen wird. Zuschreibungskriterien können Herkunftssagen, Abstammung, Geschichte, Kultur, Sprache, Religion, die Verbindung zu einem spezifischen Territorium sowie ein Gefühl der Solidarität sein. Die zugehörige Wissenschaft ist die Ethnologie (Völkerkunde). In diesem (eher Buffonschen als Linnéschen) Konzept liegt der Schwerpunkt der Differenzierung eher auf den kulturellen als auf somatophänetischen oder genetischen Unterschieden. Ethnologie wie auch physische Anthropologie der Nachkriegszeit konzentriert sich auch auf die lokalen bzw. regionalen Adaptationen, nicht auf die kontinentale Differenzierung.
Allerdings kann man die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass selbst jedes Kind, unabhängig auf welchem Kontinent oder in welchem Land, schnell erkennt, dass sich Menschen nach morphologischen Kriterien (anhand von Hautfarbe, Haartyp, Gesichtsform etc.) unterschiedlichen Typen zuordnen lassen. Dies ist natürlich auch Anthropologen und Populationsgenetikern bewusst. So hat der berühmte Populationsgenetiker Luigi Cavalli-Sforza die Rassen als natürliche Kategorien weiter benutzt. Er hat 1974 eine fließende Unterteilung in sieben Großgruppen vorgeschlagen: Afrikaner, Europäer, Nordostasiaten, Südostasiaten, Pazifikbewohner, Australier und Bewohner Neuguineas. Dies steht nicht im Widerspruch mit der Behauptung, dass L.Cavalli-Sforzas Werk stark antirassistisch geprägt ist (Box 4.7). Der nicht weniger renommierte Evolutions- und Populationsgenetiker Masatoshi Nei hat 1993 zusammen mit A.K. Roychoudhury die Einteilung der menschlichen Populationen in fünf Hauptgruppen vorgenommen: Negroide (Afrikaner), Kaukasoide (Europäer von Herkunft), Mongoloide (Ostasiaten und Pazifikbewohner), Amerinde (Indianer und Inuit) und Australoide (Australier und Papuaner).
Eine Rasse im populationsgenetischen und physisch-anthropologischen Sinne wird heute als eine Gruppe von Menschen verstanden, die durch langfristige gemeinsame Evolution verbunden ist, in deren Verlauf gemeinsame morphologische und physiologische Merkmale gebildet wurden. Diese Rassenklassifikation hat eine breite Anwendung in der Biomedizin, Archäologie, forensischen Anthropologie und Kriminologie. Allerdings sind die Übergänge zwischen den Populationen fließend, kontinuierlich und es gibt keine phänotypischen oder genotypischen Merkmale, die die einzelnen Typen eindeutig und zweifellos definieren würden. Daher gibt es auch keine eindeutige Definition menschlicher Rassen. Der berühmte US-amerikanische Evolutionsgenetiker Richard Charles Lewontin (geb. 1929) sprach sich 1972 gegen die Möglichkeit einer natürlichen Einteilung der Art H.sapiens in einige wenige Gruppen aus, in dem er gezeigt hat, dass die genetische Variabilität innerhalb einer, den traditionellen Rassen entsprechenden Gruppe sechsmal größer ist als zwischen den Gruppen.
Eine klassische Rassentheorie mit fest definierten und klar abgegrenzten Gruppen von Menschen wird durch die gegenwärtige Wissenschaft abgelehnt. Man kann jedoch wissenschaftlich von menschlichen Typen sprechen, die nachweislich mit ihrer Herkunftsregion koinzidieren, statt von empirisch festgestellten Konfigurationen von genetischen und physischen Eigenschaften von Individuen. Die Clusteranalyse hat z.B. nachgewiesen, dass sich die genetische Information (DNA) von Menschen, die in derselben geografischen Region leben, sehr ähnelt, wobei es an den Grenzen der Kontinente fließende Übergänge gibt. Zur Differenzierung von regionalen Populationsclustern reichen dabei nur ca. 40 geeignete genetische Merkmale. Die genetischen Daten sind im Einklang mit der Hypothese der afrikanischen Herkunft der Menschheit.
Ob wir diese Cluster als Rassen oder einfach nur als Gruppen bezeichnen (dürfen), ist eine andere Frage. Klar ist jedoch, dass die Bezeichnung „Ethnie“, die eher kulturzentrisch ist, nicht voll zutreffend ist.
Erst die verhängnisvollen Erfahrungen mit dem Rassismus des 20. Jahrhunderts führten dazu, dass das Konzept der menschlichen Polytypie an sich ausführlicher unter die Lupe genommen wurde. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass der überwiegende Teil der Unterschiede zwischen den menschlichen Populationen und Ethnien (diese Begriffe sind manchmal im Einklang, manchmal auch nicht) nicht genetisch, sondern kulturell bedingt ist, und dass die meisten genetischen Unterschiede polymorph sind, d.h. sie betreffen Merkmale, die wir in unterschiedlichen (wenn nicht in allen) menschlichen Gruppen in unterschiedlichen Frequenzen finden. Auch das, was von der genetischen Diversität nach dem Abzug der individuellen Variabilität übrig bleibt, ist großteils von klinaler Natur und ändert sich graduell in Abhängigkeit von geografischen Beziehungen, sodass diese Diversität keine gute Basis für die Abgrenzungen der „Rassen“ bildet.
Die Evolution der Menschheit hat nicht die Form eines phylogenetischen Baumes, denn es kommt ständig zur Vermischung. Auch wenn wir ein paar evolutionäre Einheiten („Rassen“) abgrenzen, ist kaum ein Individuum ein „reiner“ Vertreter irgendeiner dieser Einheiten. Zwei zufällig ausgesuchte Menschen unterscheiden sich in 3–10 Millionen Basenpaaren (~ 0,1–0,3% des Genoms); 85% dieser Unterschiede finden wir innerhalb von Populationen und nur 8% davon (d.h. 0,008% des Genoms) bleiben als Unterscheidungsbasis für traditionelle Rassen. Darüber hinaus ist die gegenwärtige menschliche Population als Ganzes außerordentlich einheitlich. Dies alles stimmt. Die Unterschiede zwischen den evolutionären Einheiten sind sehr gering, aber sie sind konsistent und ausreichend dazu, uns ein Fenster in die ferne Geschichte unserer Spezies zu öffnen. Natürlich ist der soziale Missbrauch des Rassenbegriffs abzulehnen, aber zu behaupten, dass Rassen ein im Zusammenhang mit dem Kolonialismus entstandenes „Sozialkonstrukt“ sind und dass sie gar keinen biologischen Inhalt haben, ist ein schneller Weg, interessante Informationen über die Evolution und Geschichte der Menschheit unter den Teppich zu kehren.
Auf den ersten Blick scheint die Einteilung der menschlichen Population in mehrere anthropologisch unterschiedliche und geografisch konsistente Gruppen sehr auffällig zu sein. Außer der traditionellen Morphologie haben auch die Biochemie und Immunologie (z.B. Verteilung der Blutgruppen) zur Erkenntnis der menschlichen phylogeografischen Diversität beigetragen und allmählich kam die grundlegende west-östliche Differenzierung der Menschheit zum Vorschein, die die alte Vorstellung einer einheitlichen „äquatorialen“ Rasse von Afrika bis nach Australien widerlegt hat. Das Ergebnis war ein Konzept von vier Großrassen aus einem gemeinsamen Vorfahren: Negr(o)ide, Europ(o)ide (Kaukasoide), Mongol(o)ide und Austral(o)ide. Später wurde zudem eine auffällige Heterogenität innerhalb der afrikanischen Populationen (Capoide und Congoide „Rasse“) erkannt.
Wie wir weiter unten lesen werden, kommen wir heute anhand des Studiums des menschlichen Genoms zu praktisch den gleichen Ergebnissen, auch wenn die geringe Größe (und dies muss betont werden!) der Unterschiede die Nutzung des Begriffs „Rasse“ (im Sinne der Rassenideologie) nicht berechtigt. Es ist eigentlich überraschend, wie identisch die Ergebnisse des Studiums von unterschiedlichen Genomteilen sind, unabhängig davon auf welche Art und Weise sie vererbt werden. MtDNA, Geschlechtschromosome, Autosome: Alle weisen auf die Existenz von einigen wenigen Evolutionslinien der gegenwärtigen Menschheit hin.
Damit widerlegen die genetischen Untersuchungen die zwei hauptsächlichen Einwände der Morphologen gegen die Anerkennung der menschlichen Rassen (gemeint sind die wissenschaftlichen Einwände – der Widerwille zur Ideologie und Politik des Rassismus ist eine andere Sache). Nach dem einen Einwand ist die Abgrenzung einzelner „Rassen“ rein subjektiv und beruht nur auf den ausgewählten, „traditionellen“ Merkmalen (Hautfarbe, Schädelform, Haartyp), aber würden wir andere Merkmale wählen, würde die Rassendifferenzierung anders ausfallen. Das, was wir bei unseren Nächsten meist bemerken, sind üblicherweise lokale Anpassungen (dunkle Pigmentierung in den Tropen, Epikanthus, d.h. sichelförmige Hautfalte am inneren Randwinkel des Auges in Wüsten, Kleinwuchs in den Regenwäldern), ohne nennenswerte evolutionäre Bedeutung. Das zweite Argument ist ähnlich, obwohl eigentlich gegensätzlich: Die Rassenzugehörigkeit eines Individuums können wir nur identifizieren, wenn wir sie gänzlich untersuchen, nicht aus den einzelnen Merkmalen. Diese Argumente sind allerdings, zumindest auf der genetischen Ebene, nicht stimmig. Es sei auch betont, dass wir eine Kovarianz zwischen der geografischen Verbreitung, dem Genotyp und Phänotyp auf allen Ebenen finden: von Familien zu Ethnien, von Regionen zu Kontinenten.
Eine Vermischung zwischen den Populationen gibt es natürlich – und zwar sowohl eine alte (Äthiopien, Südindien, Südostasien), wie auch eine relativ rezente (Folge von kolonialen Migrationen in Amerika oder Südafrika, aber auch der russischen Expansion nach Sibirien und Zentralasien) – aber sie stört die langfristige Identität der Evolutionslinien nicht wesentlich; die menschliche Diversität geht nicht verloren, „löst sich nicht auf“. Den Mechanismus der alten Vermischung illustrieren wahrscheinlich seine gegenwärtigen Analogien gut. Auch wenn wir an die Existenz der „Schmelztiegel“ in den USA oder Brasilien glauben, zeigen nähere Analysen, dass die dortigen Situationen von einer zufälligen Kreuzung weit entfernt sind. Zwischenrassische Ehen sind selten (USA 4%, Großbritannien 2%) und sowohl die Mexikaner in Mexiko und Kalifornien wie auch die Puerto Ricaner in Puerto Rico und New York zeigen positive assortative Paarungspräferenzen nach der jeweiligen genetischen Herkunft – und dies, obwohl es keine Indizien für biologische Benachteiligung der Mischlinge zwischen wie auch immer entfernten Populationen des modernen Menschen gibt.
Das evolutionäre Denken allgemein lehnt die Vorstellung einer linearen Leiter ab, die zu Säugetieren, Primaten, Menschen, Weißen zielen würde. Je zwei gegenwärtige Arten (z.B. Mensch und Schimpanse) sind von ihren gemeinsamen Vorfahren gleich entfernt, und man kann erwarten, dass sie auch eine ähnliche Menge von evolutionären Neuheiten ausweisen würden (was sich im Falle von Menschen und Schimpansen auch bestätigt hat). Dasselbe gilt auch innerhalb einer Art: Ohne Rücksicht wie entfernt oder nah sich ein Pygmäe und ein Europäer stehen, die Pygmäen sind bestimmt keine „primitiven“ Vorfahren von Europäern (Chinesen, Bantu…), sondern eine unikate menschliche Gruppe, die darüber hinaus an eine Umwelt angepasst ist, in der wir anderen kaum überleben würden.
3.2 Quellen der Informationen über die Phylogeografie
Die klassische Quelle für Informationen über die Geschichte der menschlichen Populationen war die Morphologie (des Skeletts, Pigmentierung usw.) und später die Biochemie und Immunologie (z.B. Blutgruppen). In jüngster Zeit spielt die Molekulargenetik eine immer größer werdende Rolle. Vom heutigen Standpunkt aus gesehen ist es eigentlich eher bemerkenswert, dass man mit den gegenwärtigen, unvergleichbar ausgeklügelteren Methoden, die eine unvergleichbar größere Menge an Daten zu verarbeiten in der Lage sind, zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt.
Am Beginn der Molekulargenetik stand vor allem das Studium der mitochondrialen DNA (mtDNA) und das des nicht rekombinierbaren Teils des Y-Chromosoms. In beiden Fällen geht es um DNA-Segmente, die eine einfache Stammbaumevolution ohne Rekombinationen ausweisen, was die evolutionäre Interpretation der Ergebnisse einerseits vereinfacht. Auf der anderen Seite handelt es sich bei diesen Stammbäumen um Studien von Abschnitten mit unorthodoxer, sex-determinierter Erblichkeit, sodass ihre Evolution eigentlich nichts Wesentliches über die Phylogenese ganzer Populationen aussagen muss. Erst später hat man angefangen auch andere Chromosomen zu untersuchen und gegenwärtig auch Hunderttausende von Punktmutationen („single nucleotide polymorphisms“, SNP) von ganzen Genomen. Mitochondriale, Y-Chromosom- und autosomale Gene verbreiten sich unterschiedlich, sodass sie kein einheitliches („richtiges“) Bild über die Evolution der Menschheit geben; dafür informieren sie uns aber über die sexuell spezifische Demografie (Endogamie, dispersives Geschlecht) (vergleiche Box 6.7, Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der Veränderungen in Haplotypen (mit unterschiedlichen Farben dargestellt) von mtDNA und Y-Chromosom in zwei hypothetischen Gebieten (A und B) nach einer erfolgreichen Kriegsinvasion. Die Männer im Gebiet B wurden zum großen Teil getötet oder als Sklaven nach A verschleppt; die Frauen wurden vergewaltigt bzw. als Sklavinnen oder Bräute nach A verschleppt. Die mtDNA hat sich im überfallenen Gebiet B nicht verändert, Y-Chromosom-Haplotypen wurden zum Teil ersetzt. Im Gebiet der Sieger (A) erscheinen nun allerdings auch neue Haplotypen.
Beispielsweise ist die Bevölkerung der Mittelmeerinsel Ibiza vom Gesichtspunkt der mtDNA aus ein altes Isolat des karthaginisch-phönizischen Altertums, vom Gesichtspunkt des Y-Chromosoms aus weisen Mutationen auf rezente Beziehungen zu Europa und Afrika hin. Es handelt sich um eine offensichtliche Folge des durch männliche Händler vermittelten Genflusses. Die phylogeografische Analyse wird noch durch ein komplexes Spiel zwischen den Genen und der Kultur verkompliziert. Die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Europa, im Nahen Osten und in Afrika zeigt, dass die Mehrheit der jüdischen Populationen (Sephardim, Aschkenasim) klare Spuren einer nahöstlichen Herkunft tragen, was den Geschichtskenntnissen entspricht. Darüber hinaus kann man bei ost- und mitteleuropäischen Juden (Aschkenasim) auch noch die Molekularspur der kaukasischen Herkunft finden, wodurch die kontroverse „Chasaren-Hypothese“ (die – zumindest teilweise – Herkunft der Aschkenasim von judeisierten Chasaren) wiederbelebt wird. (Das Chasaren Khaganat war im 7. bis 10. Jahrhundert ein mächtiger und einflussreicher Turkstaat zwischen dem Roten und Kaspischen Meer und nördlich davon.) Wohingegen die äthiopischen oder jemenitischen Juden sich von den benachbarten nichtjüdischen Populationen genetisch nicht signifikant unterscheiden.
Für die Datierung evolutionärer Ereignisse (z.B. Bestimmung des Zeitpunkts der Aufspaltung zweier Arten) benutzt man die „molekulare Uhr“. Bei dieser Methode wird die Evolutionsdauer vom genetischen Abstand der untersuchten Arten „abgelesen“. Um dies machen zu können, müssen wir die molekulare Uhr kalibrieren, also die Mutationsrate pro Zeiteinheit kennen. Zum Kalibrieren nutzt man einen bekannten genetischen Abstand zwischen zwei Arten mit deren Stellung auf dem phylogenetischen Baum und Kenntnis des Zeitpunkts ihrer Aufspaltung anhand von datierten Fossilien. Bei der Methode wird angenommen, dass die Mutationsrate (bei dem untersuchten DNA-Abschnitt) konstant in der Zeit und gleich bei allen untersuchten (wie auch bei den zum Kalibrieren verwendeten Referenz-)Arten ist. Die Genauigkeit der molekularen Datierung ist natürlich auch von der Genauigkeit der Kalibrierung abhängig. Und dies ist ein Problem, denn nicht immer ist die Datierung der Fossilien genau genug und verlässlich (Abb. 3.2). Aus der datierten Phylogenese der Hominiden (und altweltlichen Affen im Allgemeinen) ergibt sich auf diese Weise eine Mutationsrate von 10-9 Mutationen pro Nukleotid und pro Jahr.

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der im Verlauf der Zeit steigenden genetischen Divergenz zwischen zwei getrennten Populationen bzw. Arten und der Berechnung der Zeit dieser Divergenz. Wenn wir wissen, dass z.B. bestimmte genetische Unterschiede zwischen Schimpansen und Menschen 30-mal höher sind als durchschnittliche Unterschiede in vergleichbaren Genen zwischen Afrikanern und Nichtafrikanern und wenn wir die Divergenz zwischen den Schimpansen- und Menschenlinien anhand der Datierung der Fossilien kennen, können wir – angenommen, dass die Mutationsgeschwindigkeit in den beiden Linien gleich ist – mittels eines einfachen Dreisatzes bestimmen, wann sich die nichtafrikanische Population von der afrikanischen getrennt hat. Abhängig von der paläontologischen Datierung (in unserem Beispiel 5, 6 oder 7,5 Millionen Jahre) kommen wir zu unterschiedlichen Zeiten (in unserem Beispiel jeweils 166000, 200000 oder 250000 Jahre).
Wenn wir allerdings die Menge der Mutationen zwischen den nachfolgenden Generationen gegenwärtiger Menschen betrachten, ergibt sich eine Geschwindigkeit von ca. 1,3 * 10–8 Mutationen pro Nukleotid und Generation – also nach der Umrechnung auf eine 25 Jahre dauernde Generation – eine Geschwindigkeit von ca. 0,5 * 10–9 Mutationen pro Nukleotid und Jahr. Diese Mutationsgeschwindigkeit unterscheidet sich also von derjenigen aus den datierten phylogenetischen Bäumen abgeleiteten Geschwindigkeit. (Es ergibt sich natürlich die Frage, wie legitim die Evolutionsextrapolationen der Mutationsgeschwindigkeit sind, die auf der Untersuchung von zwei nacheinander folgenden Generationen beruhen.) Eine halbe Mutationsgeschwindigkeit verlangt doppelt so viel Zeit, um die beobachteten Unterschiede in Genomen zu akkumulieren und damit auch die Verdopplung der früheren Schätzungen der Zeiten der Divergenzen in der menschlichen Evolution. Wenn wir diese Zwischengenerationen-Mutationsgeschwindigkeit zur Datierung der Evolutionsereignisse verwenden, kommen wir zu unterschiedlichen Schätzungen: Die Ereignisse erscheinen dann wesentlich älter (z.B. Speziation Mensch – Schimpanse ca. 7,5 mya, Diversifizierung der modernen Menschheit ca. 250 tya) – was in beiden Fällen aber auch besser den Fossilaufzeichnungen entspricht.
Da sich die zeitliche Skala der Schlüsselereignisse in der menschlichen Evolution ändert, ändert sich auch der geografische und klimatische Kontext, in dem sich diese Ereignisse abgespielt haben, und plötzlich öffnet sich auch der Raum für eine neue Interpretation vieler fossiler Funde.
3.3 Eva der Mitochondrien und Adam des Y-Chromosoms
Studien der mitochondrialen DNA führten zur Hypothese der „mitochondrialen Eva“ („Eva der Mitochondrien“). Als mitochondriale Eva wird der gemeinsame Vorfahr der gegenwärtigen Menschheit in der mütterlichen Linie bezeichnet. Diese hypothetische Person lebte vor ca. 140–230 Tausend Jahren (nach neuerer Datierung vielleicht auch früher) in Ostafrika. Ihr Gegenpart, der letzte Vorfahre väterlicherseits, der sogenannte „Adam des Y-Chromosoms“, war etwas jünger, wahrscheinlich 120–200 Tausend Jahre (frühere Schätzungen gingen von einem noch jüngeren Alter aus) und bewohnte ebenfalls Afrika. Man muss sich klar machen, dass es sich in beiden Fällen um sogenannte Koaleszenz-Punkte handelt, also um Punkte, in denen sich alle matri- bzw. patrilinearen Linien begegnen (Box 3.2, Abb. 3.3). Ein Individuum wird zu so einem Vorfahren nur in dem Fall werden, wenn alle seine Nachkommen (und ihre Nachkommen) bis heute mindestens einen fruchtbaren Nachkommen des jeweiligen Geschlechts hatten. Wenn wir eine Generationszeit von ca. 25 Jahren annehmen, stehen zwischen uns und der mitochondrialen Eva ca. 8000 Generationen – tiefer reichen unsere Genealogien nicht, was bedeutet, dass die älteren Nachkommen nicht mit einer ununterbrochenen Linie mit uns verbunden sind; einer Linie die nicht gleichzeitig auch Eva oder Adam einschließen würde. Ergänzen wir aber, dass der „genealogische gemeinsame Vorfahr“ der Menschheit wohl noch jünger, nur ein paar Tausend Jahre alt, ist. Unsere genealogischen Vorfahren (zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern) nehmen nämlich exponentiell zu, und unsere Genealogien beginnen schnell sich zu überlappen („pedigree collapse“). Menschen haben oft Kinder mit ihren fernen Verwandten, ohne dass sie es eigentlich wissen. Hierzu müssen wir noch zusätzliche Verschmelzungen der zeitweilig isolierten Populationen durch spätere Migrationen zurechnen. Und so z.B. charakterisieren europäische Gene in der ursprünglichen amerikanischen Population beginnend mit 1492 eigentlich nicht einen gemeinsamen Vorfahren, der mehrere Zehntausende Jahre alt wäre, sondern schon einen nur noch ein paar Hundert Jahre alten gemeinsamen Vorfahren.

Abb. 3.3: Vererbung bzw. Substitution der mitochondrialen DNA, des Y- und des X-Chromosoms und beliebiger auf Autosomen lokalisierter Allele im Verlauf mehrerer Generationen. Das Schema illustriert ein Missverständnis des Konzepts „Eva der Mitochondrien“ bzw. „Adam des Y-Chromosoms“. Obwohl die mtDNA und das Y-Chromosom selbst nach einigen Generationen in unserem Schema alle von einer Frau bzw. einem Mann stammen, ist es klar, dass die Population nicht von einem einzigen Paar gegründet wurde und dass Allele auf Autosomen und X-Chromosomen der Gründer aller Vorfahren auch in den nächsten Generationen vertreten sind. Unterschiedliche Farben repräsentieren unterschiedliche Haplotypen (Allel, mtDNA bzw. Chromosom).
Box 3.2
Die „Eva der Mitochondrien“ und der „Adam des Y-Chromosoms“
R. L.Cann, M.Stoneking und A.C. Wilson publizierten 1987 das Konzept der „Eva der Mitochondrien“. Es beruht auf der Tatsache, dass Mitochondrien vorwiegend in mütterlicher Linie vererbt werden und eine eigene DNA (mtDNA) besitzen, die eine hohe Mutationsrate aufweist. Aufgrund der Analyse mitochondrialer Genome von 147 Menschen aus fünf geografisch verschiedenen Populationen stellten sie die Hypothese auf, dass diese gesamte mtDNA von einer Frau stammt, die vor etwa 200000 Jahren wahrscheinlich in Afrika lebte. Alle untersuchten Populationen, mit Ausnahme der afrikanischen Population, sind multiplen Ursprungs, wodurch impliziert wird, dass jede Region wiederholt kolonisiert wurde. Diese Arbeit sorgte sowohl in Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit für sehr viel Aufregung und inspirierte zahlreiche weitere Forschungen. Die Analyse und ihre Interpretation wurden bestätigt, aber auch kritisiert. Abgesehen von den Vorwürfen, dass die mtDNA, wie man heute weiß, nicht ausschließlich in der mütterlichen Linie (matrilinear) vererbt wird und dass auch bei der mtDNA Rekombination möglich ist (wobei beide Phänomene die Ergebnisse aber wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflussen), führten unterschiedliche Studien zu teilweise (jedoch nicht dramatisch) unterschiedlichen Berechnungen des Zeitraums, wann die „Eva der Mitochondrien“ lebte. Heute wird meistens eine Zeit vor ca. 140000 Jahren angenommen. Allerdings wurde (und wird immer noch) die Interpretation der Ergebnisse oft missverstanden. Die Autoren sagten, dass die gesamte mtDNA der untersuchten Menschen von einer Frau stammt. Das heißt jedoch nicht, dass diese Frau der einzige und älteste gemeinsame Vorfahre aller untersuchten Menschen wäre. Es gab in der Zeit, als die „Eva der Mitochondrien“ lebte, (und davor) auch andere Frauen, und auch deren Gene tragen wir. Die „Eva der Mitochondrien“ war nur der jüngste gemeinsame Vorfahre der gesamten heutigen mtDNA (Abb. 3.3).
Während Mitochondrien matrilinear vererbt werden, werden Y-Chromosomen, ähnlich wie in manchen Gesellschaften die Familiennamen (Abb. 3.4), patrilinear weitergegeben. Der jüngste gemeinsame Vorfahre der Männer (der „Adam des Y-Chromosoms“) lebte vor etwa 120000 Jahren (die Schätzungen schwanken zwischen 30000 und 200000 Jahren), also nach der „Eva der Mitochondrien“, und stammte ebenfalls aus Afrika. Die „Eva der Mitochondrien“ und der „Adam des Y-Chromosoms“ waren also kein Paar. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Männer einen viel höheren Fortpflanzungserfolg haben können als Frauen. Zwei Beispiele: Während die Kaiserin Maria Theresia (1717–1780) 16 Kinder gebar (was schon sehr beachtlich ist), hatte ihr Zeitgenosse Mulai Ismail (1646–1727), Sultan von Marokko, angeblich mindestens 888 Kinder. Eine Frau braucht also viel mehr Generationen, um ebenso viele Nachkommen zu erreichen wie ein Mann. Kürzlich wurde festgestellt, dass ca. 8% der Männer in Asien vom Kaspischen Meer bis zur Pazifikküste zu einer spezifischen Y-Chromosom-Linie gehören, die offensichtlich ihre Herkunft im mongolischen Raum vor ca. 1000 Jahren hat. Es wird vermutet, dass diese Linie von Dschingis Khan abstammt – dass es sich also um seine Nachkommen handelt.