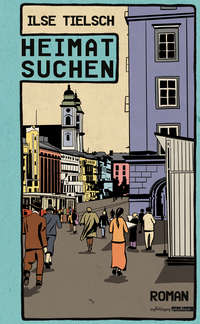Kitabı oku: «Heimatsuchen», sayfa 2
(Ein von der Obrigkeit ausgesandter Zeichner ist, wie der Chronist festhält, dem Zorn der Bürger von B. nur mit knapper Not entkommen. Er hatte seine Bitte, die Stadt ABREISSEN zu dürfen, auftragsgemäß vorgebracht und war in seiner Absicht mißverstanden worden. Die dennoch im Jahre 1727 angefertigte Zeichnung dürfte von einem der Hügel aus heimlich und ohne Zustimmung des Stadtrates entstanden sein. Sie stellt die von Mauern und Friedhof umgebene Pfarrkirche mit von einer großen und einer darübergesetzten kleineren Zwiebel gekröntem Turm, die große Zwiebel von vier Türmchen gesäumt, in den weiten, von Bürgerhäusern umrandeten Marktplatz hinein, umgibt den Kranz der Häuser mit Mauern, Türmen und Toren, setzt kleinere Häusergruppen vor die Mauern der Stadt in die Felder, zieht zwei Häuserreihen einen steil ansteigenden Hügel aufwärts, weist mit zierlicher Schrift darauf hin, man habe diese, außerhalb der Mauern gelegene Siedlung DAS BÖHMENDORF genannt.
Der Schluß liegt nahe, daß die Stadt selbst zu jener Zeit ausschließlich von Deutschen bewohnt gewesen ist.)
B., ein Ort, zu dem die Gedanken immer wieder zurückkehren, den sie umkreisen. Früher als in anderen Gegenden erntete man das Getreide, die Obstbäume blühten schon im April, auf den Südhängen reifte die Mandel, die Nachtigall schlug IN TAUSEND AKKORDEN.
Der Zwang, diesen Ort nachzuzeichnen, sein sich im Lauf der Jahrhunderte änderndes Bild anhand der Aufzeichnungen von Chronisten zu verfolgen, sich mit seiner Geschichte vertraut zu machen. Lange Vergangenes mit erlebter Gegenwart, die ebenfalls schon längst Vergangenheit geworden ist, in Verbindung zu bringen, ein Ganzes entstehen zu lassen, ein möglichst vollständiges Bild des Ortes zu malen, den man schon einmal verlassen hat, dem man sich noch einmal nähern will, um sich dann endlich für immer von ihm zu entfernen.
DIESE STADT IST ALT, DENN SIE WAR SCHON IM JAHR 893 EIN HALTBARER ORT, schreibt Franz Joseph Schwoy in seiner 1793 publizierten Topographie vom Markgrafthum Mähren, das VOR DEN HUNGARN FLÜCHTIGE HEER DES MÄHRISCHEN KÖNIGS SWATOPLUK habe sich in ihre Mauern gerettet.
Die Chronik hält die erste urkundliche Erwähnung in einem von König Wenzel I. 1240 gefertigten Schreiben fest, die Erhebung zur Stadt durch Kaiser Maximilian II. 1572, erwähnt in Verbindung mit diesem Ereignis das verliehene Recht, MIT ROTEM WACHS ZU SIEGELN, was anderen Städten gegenüber, denen nur MIT GRÜNEM WACHS ZU SIEGELN erlaubt war, eine Erhöhung des Ansehens bedeutet hat. Sie beschreibt, nach Kriegs- und Notzeiten, nach Pest und Cholera, einen aufblühenden, durch große Jahr- und Wochenmärkte, vor allem durch Viehmärkte weithin berühmten Ort, Umschlagplatz für allerlei in Gewerbe und schließlich sich entwickelnder Industrie gefertigte Waren, nennt als wesentlichsten Fehler, der weiterer günstiger Aufwärtsentwicklung hinderlich gewesen sei, den Beschluß, die 1839 von Wien nach Brünn gelegte Bahnlinie nicht durch die Stadt zu führen. Man habe, heißt es, eine Beeinträchtigung der Fuhrwerksunternehmen gefürchtet, kurzsichtig auf die Chance, einen Bahnhof an der Hauptbahnlinie zu besitzen, verzichtet, ein Schaden, der durch die später gebaute Lokalbahn nicht zu beheben gewesen ist.
Denkbar, daß damals, durch diesen Mangel an Weitblick, das Schicksal von B., zur VERTRÄUMTEN KLEINEN LANDSTADT abzusinken, besiegelt worden ist, denn obwohl es noch Höhepunkte in der Entwicklung gab, Zeiten, die zur Hoffnung berechtigten, obwohl B. zum Beispiel frühzeitig eine Poststation erhielt, vorübergehend Sitz eines Divisionskommandos war, sich sogar zur Bezirksstadt emporschwang, war der Abstieg zur Bedeutungslosigkeit der verschlafenen Kleinstadt nicht aufzuhalten. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Herbst 1938 und dem darauf folgenden Anschluß an Deutschland wurden alle wichtigen Ämter in eine Stadt verlegt, die einen Bahnhof im Stadtgebiet besaß.
Ich rufe mir schon Gesagtes ins Gedächtnis zurück, hole es herüber in diese von mir weiterzuerzählende Geschichte, erinnere an die Enttäuschung, die Heinrich, damals neunundzwanzigjährig, erfaßte, als er, aus Wien kommend, an einem vor Hitze flirrenden Junimittag des Jahres 1924, den vor dem gelb gestrichenen, einsam zwischen Mais-, Rüben- und Getreidefeldern träumenden Bahnhofsgebäude haltenden Zug verließ, endlich, nach längerem Zögern, den Wunsch, auf den aus Brünn kommenden Gegenzug zu warten und in die Großstadt zurückzukehren, unterdrückte, sein altes, im Gepäckwagen des Zuges mitgebrachtes Fahrrad bestieg, schließlich in B. eintraf. Ich erinnere daran, daß er, der von einem Leben in Wien geträumt hatte, sich unter dem Zwang der Not, dieser Hungerzeit zwischen den Kriegen, entschlossen hatte, die freigewordene Stelle eines Landarztes anzunehmen, daß ihn, als er auf seinem Fahrrad in die Stadt B. einfuhr, beinahe der Mut verließ, ja daß ihn, angesichts der sich dehnenden, vor allem der mit Rüben bewachsenen Felder, der menschenleeren Gassen, des ebenso leeren Marktplatzes mit Dreifaltigkeitssäule, Sparkasse, Pfarrkirche und neugotischem Rathaus, den gegen die Sonne mit Tüchern verhängten Schaufenstern einer Bata-Filiale eine in Worten schwer zu beschreibende Melancholie überkam. Der Ausspruch eines Mannes, der von ihm damals nach dem Weg gefragt worden ist, wurde von ihm später häufig wiederholt: HIER WERDEN SIE ES NICHT AUSHALTEN, HIER IST DAS ENDE DER WELT.
(Die Erinnerung hält jedoch fest, daß Heinrich in der zweiten Hälfte seines Lebens, die mit dem Durchwaten des Grenzbaches im Juni 1945 begann, der kleinen, in die Hügel gedrängten Stadt B. immer mit Zärtlichkeit, ja mit HEIMWEH gedachte.)
Eine große Anzahl von Fotografien, im Lauf der Jahrzehnte gesammelt, von Freunden, Verwandten, Bekannten geschenkt, überlassen, in Kopien zugeschickt, zeigen, nebeneinandergelegt, die kleine Landstadt B. mit allen wichtigen Gassen, Gebäuden, Wegen, Wegkreuzen, Kapellen, mit Pfarrkirche, Rathaus, Dreifaltigkeitssäule, mit dem Trinkwasserbrunnen im unteren Teil des großen, annähernd quadratischen Platzes. Ein steinerner Poseidon hält eine Amphore auf den Schultern, Wasser plätschert in dünnem Strahl in das steingefaßte Becken, Lindenbäume umgeben ein Steinkreuz neben der Kirche, Johannes von Nepomuk steht auf seinem Postament, die Sparkasse leuchtet mit blinkenden Scheiben, hohe Baumkronen umgeben die alte Schule, Brücken überwölben den Bach, zum kleinen Lokalbahnhof führt eine von hohen Akazien und Kastanienbäumen gesäumte Allee.
Zwischen den schönen Bürgerhäusern, auf den weißen Kopfsteinen aus den Pollauer Bergen, läuft das Kind Anni hin und her, es lehnt sich aus einem Fenster, sieht die Kette der Pollauer Berge sich bläulich vom Himmel abzeichnen, das Gipfelkreuz ist deutlich erkennbar, das Kind drängt sich auf dem in eine Budenstadt verwandelten Stadtplatz zwischen feilschenden Hausfrauen und Händlern durch, steht staunend, mit offenem Mund, vor den Buden mit den Puppen, Stofftieren, Trompeten, sieht ein Äffchen an der Leine tanzen, läuft eine lange Straße entlang, die zum Böhmendorf führt, betritt den Hof der Großeltern Josef und Anna durch ein breites hölzernes Tor. Schneeweiße Gänse schnattern, Milchkannen klappern, Pferde wiehern, die Großmutter, zierlich und klein, rührt im blau gekachelten Herd in großen Kasserollen, der Großvater putzt sein Jagdgewehr, hantiert beim Bienenhaus, das Kind sitzt auf seinem Lieblingsplatz unter dem Maulbeerbaum, hält ein Stückchen blaues Glas vor sein rechtes Auge, kneift das linke Auge zu, träumt, was Kinder aus wasserarmen Gegenden manchmal träumen: DAS MEER. Nur wenig von jenen immer stärker werdenden Spannungen, die damals sogar in der stillen kleinen Landstadt B. zwischen den Einwohnern verschiedener Muttersprache bestanden haben, ist dem Kind Anni zu Bewußtsein gekommen.
(Der Chronist berichtet, daß die vorwiegend deutsche Bevölkerung zu Anfang des Jahrhunderts mit einer tschechischen Minderheit so lange in Frieden zusammenlebte, bis EINIGE HITZKÖPFE PROVOZIEREND DAS FRIEDLICHE ZUSAMMENLEBEN STÖRTEN.
Es habe für die wenigen tschechischen Familien einen Volksrat, eine Sparkasse, ein Vereinshaus gegeben. Erst anläßlich der Eröffnung einer tschechischen Schule im Jahre 1909 sei es zu Reibereien gekommen. Die Regierung habe der Minderheit Schutz gewährt, den Ausnahmezustand verhängt und verstärkten Polizeischutz geboten. Fünfunddreißig Gendarmen hätten eine Art Besatzung gebildet. Die Lage habe sich jedoch in den folgenden Jahren IMMER MEHR ANGESPANNT. Im November 1918 sei B. von einer slowakischen Brigade mit zwei Maschinengewehren besetzt worden, die Besetzung habe sich jedoch IN ALLER RUHE vollzogen. Die Bezirkshauptmannschaft, die Post, die Eisenbahnstation und das Rathaus seien besetzt, das Verbot, andere Farben als die tschechischen zu tragen, sei erlassen worden. Zum erstenmal in der Geschichte der Stadt habe es nacheinander zwei tschechische Bürgermeister gegeben. Zahlreiche tschechische Beamte und Lehrer seien in die Stadt gekommen, die Zahl der Tschechen in der Stadt habe ständig zugenommen. Die deutschen Beamten seien ihrer Posten enthoben, durch tschechische Beamte ersetzt worden.
Wirtschaftlich habe sich die Abtrennung von den ehemaligen Absatzgebieten für landwirtschaftliche Produkte, aber auch für im Gewerbe und in der Industrie hergestellte Waren, bemerkbar gemacht. Die Ziegelwerke seien geschlossen worden. Die drei Mühlen hätten mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Die kleinen Handwerksbetriebe hätten sich zwar als Bedarfsträger des dichtbesiedelten bäuerlichen Umlandes schlecht und recht durchbringen können, die Konkurrenz sei jedoch groß und ungesund gewesen. Die für landwirtschaftliche Produkte gezahlten Preise hätten kaum noch das Notwendigste eingebracht. Ganz besonders hätte der Weinbau unter den herrschenden Verhältnissen gelitten, die Zahl der Weingärten habe sich ständig verringert. Allerdings hätten nicht nur die deutschen, sondern auch die tschechischen Bauern unter der herrschenden Not zu leiden gehabt, unter der furchtbaren Arbeitslosigkeit hätten in südmährischen Industriestädten tschechische und deutsche Einwohner in gleichem Maß gelitten.
Wegen der hohen Kosten habe man erst spät mit der Elektrifizierung der Stadt beginnen können, der Bau einer Wasserleitung stellte sich als finanziell untragbar heraus, an eine Kanalisation war nicht zu denken. Einzig das Baugewerbe blühte, Schulen und Häuser für die neuen tschechischen Beamten wurden gebaut. Für das neu errichtete tschechische Gymnasium habe es zu wenige Schüler gegeben, man habe die Schüler von weither holen müssen.
Die nationalen Spannungen hätten SIEDEHITZE erreicht. Die deutschen Truppen im Herbst 1938 seien deshalb mit Jubel empfangen worden.
Sei bis dahin, seit 1918, von tschechischer Seite eine falsche, die Deutschen benachteiligende Politik betrieben worden, habe in der folgenden Zeit Hitlers Politik, die IN JEDEM SLAWEN EINEN MENSCHEN ZWEITER KLASSE gesehen habe, alle Hoffnungen zunichte gemacht.)
Heinrich, der von einem Leben in der Musik- und Theaterstadt Wien geträumt hatte, blieb in B., eröffnete eine Praxis, nahm zwei Jahre später die Bauerntochter Valerie zur Frau. Er versah seinen Dienst als praktischer Arzt mit immer gleichbleibender Geduld, machte bei seinen Patienten keinen Unterschied, was Sprache oder Religion betraf. Über die Geburt der Tochter soll er sich gefreut haben. Söhne, soll er gesagt haben, seien immer und zu allen Zeiten KANONENFUTTER gewesen.
Am 15. April 1945 wurde die kleine, in die südmährischen Hügel gedrängte Stadt B. vom Krieg überrollt.
SEI FROH, DASS DU ES NICHT ERLEBT HAST, sagt die heute alt gewordene Mutter Valerie.
Sei froh, daß du nicht dabeigewesen bist, sagen Schulfreundinnen der Tochter Anni, die es erlebt haben. ES, DAS FURCHTBARE, DAS UNBESCHREIBLICHE, das auch heute, nach dreieinhalb Jahrzehnten, immer noch nicht erzählbar geworden ist.
Diesmal war die Not mit dem Ende des Krieges nicht vorüber, wie dies in früheren Jahrhunderten meist der Fall gewesen war.
Ich möchte den Weg genau kennen, den Heinrich und Valerie, Vater und Mutter, damals am 16. Juni 1945 hinter Wundrascheks klapprigem Wägelchen gegangen sind, bitte die Mutter, ihn mir zu beschreiben, lege die alte Landkarte auf den Tisch. Auf dieser Karte sind nicht nur die Straßen, es sind auch die allerkleinsten Wege, Feldwege, Hohlwege eingezeichnet, auch die Namen der Hügel, die Bäche, die Wegkreuze, die Obstbaumalleen. Es ist eine Karte, wie man sie heute nicht mehr bekommen kann.
Die Mutter hat eine alte Freundin eingeladen, weil sie nicht sicher ist, ob sie sich noch an Einzelheiten erinnert. Zwei Stunden nach Mitternacht sind sie damals aufgebrochen, der Vater und sie, im Hof ihres Elternhauses haben noch jene drei Erwachsenen und die zwei Kinder gewartet, von denen in diesem Zusammenhang schon die Rede gewesen ist, auf Wundrascheks Wagen sind schon Gepäckstücke gelegen, sie haben ihre beiden Rucksäcke und den Koffer dazugelegt.
(Mehr haben wir nicht mehr gehabt, sagt die Mutter, mehr hat uns nicht mehr gehört.)
Sie haben sich von Valeries Eltern, Josef und Anna, und von Hedwig verabschiedet, sie haben ABSCHIED GENOMMEN, es ist ihnen sehr schwer gefallen, denn, sagt die Mutter, sie haben ja nicht gewußt, ob sie einander noch einmal wiedersehen würden.
Dann sind sie losgezogen, auf jener Straße, über die Heinrich zwanzig Jahre vorher auf seinem alten Fahrrad gekommen war.
Ein Stück vor dem Bahnhof sind sie rechts auf die Straße, die nach dem Ort Tracht führt, abgebogen.
Ja, sagt die Freundin, das stimmt, nur so könnt ihr gegangen sein, verfolgt mit dem Finger den Weg auf der Landkarte, nennt weitere Ortsnamen: Unter-Wisternitz, Ober-Wisternitz, Bergen. Nein, sagt die Mutter, wir sind ÜBER DIE FELDER gegangen. IN TRACHT IST EIN POSTEN GEWESEN. (Vor diesem Posten hätten sie Angst gehabt.) Sei seien nicht bei Unter-Wisternitz über die Thaya gegangen, sie könne sich, sagt die Mutter, überhaupt nicht daran erinnern, die Thaya überquert zu haben.
Man muss über die Thaya, sagt die Freundin, ein längerer Wortwechsel folgt. IHR KÖNNT JA NICHT ÜBER DIE THAYA GESPRUNGEN SEIN! (Auf der Landkarte ist deutlich zu sehen, daß man den Fluß überqueren muß, wenn man zur Grenze will.)
DAS NEUE WIRTSHAUS haben wir nicht gesehen.
(Auch der Feldweg, der nach dem Dorf Unter-Tannowitz führt, ist auf der alten Karte eingezeichnet.)
Von dort weg ist Gertrud, die Arzttochter, die mit Anni das Gymnasium besucht hat, mit ihnen gegangen und hat ihnen den Weg zur Grenze gezeigt.
(Ob sie Angst gehabt hat? Nein, sagt Gertrud heute, damals sei so etwas selbstverständlich gewesen. Sie habe diesen Weg sehr gut gekannt, mehrfach Leute zur Grenze gebracht, auch Soldaten, die sich versteckt hatten. Sie habe Heinrich, Valerie und die anderen, so weit es nötig gewesen sei, begleitet, ihnen dann gezeigt, wo sie den Bahndamm zu überqueren hätten, sei dann wieder umgekehrt. HINTER DEM BAHNDAMM IST DER GRENZBACH GEWESEN.)
2
Hü! rief Wundraschek, und sein Pferd setzte sich in Bewegung.
Die fünf Erwachsenen und die beiden Kinder standen wie verloren neben den Gepäckstücken und blickten dem Wagen nach, der, eine Staubwolke hinter sich herziehend, langsam davonrumpelte, dann bückten sie sich nach ihren Rucksäcken und Koffern und kletterten über den Bahndamm und die Eisenbahnschienen.
Bis zum Bach waren es nur wenige Schritte. Sie durchwateten ihn, die Rucksäcke auf dem Rücken, einer der Männer, der von Valerie R. genannt worden ist, trug die Kinder und das restliche Gepäck ans andere Ufer, sie fanden eine trockene schattige Stelle zwischen den Weidenbüschen, fielen müde ins Gras, redeten nicht, die Kinder weinten leise vor sich hin.
Valerie war es, die sich schließlich bewegte, die Hand ausstreckte, nach Heinrichs Hand griff, nicht nur, weil sie das Gefühl seiner Nähe brauchte, das Gefühl, nicht allein zu sein mit all diesem Jammer, sondern auch, um ihm dieses Gefühl zu vermitteln. Wir leben, wollte sie ihm auf diese Weise sagen, wir sind davongekommen, wir sind nicht verlassen, solange wir einander haben.
Heinrich wandte ihr sein Gesicht zu, nickte zum Zeichen, daß er sie verstanden habe, und sagte leise: Ich habe heute Geburtstag.
Er war an diesem Tag genau fünfzig Jahre alt geworden.
Der Schmerz war beinahe erstickt gewesen von der Müdigkeit des Körpers, jetzt erwachte er, Valerie fühlte, wie er in ihr hochkroch, sie würgte, sie hatte das Gefühl, erbrechen zu müssen, aber es war ihr nicht möglich, aufzustehen, sich aufzuraffen, von diesem Krampf, der ihr den Hals zuschnürte, zu befreien. Sie ließ Heinrichs Hand los, drückte das Gesicht ins Gras, wartete auf das Nachlassen des Krampfes, auf das Abklingen der durch den wiedererwachten Schmerz hervorgerufenen Übelkeit, wartete auf Tränen, die nicht kamen. So muß sie längere Zeit gelegen sein, beinahe bewußtlos vor Erschöpfung, vielleicht sind es die Stimmen der Kinder gewesen, die sie schließlich zurückholten, vielleicht war es auch nur der Durst, den sie beim Nachlassen der Verkrampfung, des Ekels, zu spüren begann, der sie dazu brachte, sich aufzurichten. Sie griff nach ihrer Handtasche, holte die kleine Sliwowitzflasche hervor, die Wundraschek zur Hälfte leergetrunken hatte (sogar das bißchen Sliwowitz hat er uns weggetrunken), wandte sich an Heinrich und sagte leise: Gib mir den Becher.
Heinrich hatte seit seiner Gymnasialzeit eine Vorliebe für Becher gehabt, die man in der Tasche tragen konnte. Er griff in seine Rocktasche, holte eine kleine, flache Aluminiumschachtel hervor, Valerie öffnete sie, faßte von den darin konzentrisch ineinandergelegten Ringen aus dünnem Aluminium den größten, hob ihn aus der Schachtel, die übrigen, ineinanderpassenden Teile und der in der Mitte liegende kleine Boden formten sich zum Trinkgefäß. Sie ging damit zum Bach, füllte es zu zwei Dritteln mit Wasser, goß etwas von dem Schnaps hinein und trank. Dann füllte sie den Becher wieder, kam damit zu den auf dem Grasplatz Liegenden, reichte ihn der Frau.
Sie tranken alle von dem mit dem Schnaps gemischten Bachwasser, auch die Kinder tranken davon. (Wir sind nicht krank davon geworden, sagt die Mutter, es ist ein sehr starker Schnaps gewesen, er hat das Wasser wahrscheinlich desinfiziert.)
Nachdem sie getrunken hatten, kramten sie hervor, was sie an Eßbarem hatten. Ein Stück Brot, ein Stückchen Speck, dann suchte jeder für sich eine Stelle am Bach, wo er sich, ungesehen von den anderen seiner Kleidung entledigen und waschen konnte.
Dann saßen sie wieder unschlüssig im Gras, konnten sich nicht dazu aufraffen, aufzustehen und weiterzugehen. Während des ganzen, mehr als zwanzig Kilometer langen Fußmarsches hatten sie Angst gehabt. Es war eine Folge dieser Angst gewesen, daß sie, trotzdem sie Papiere mit der amtlichen Bewilligung zum Grenzübertritt in der Tasche trugen, nicht den offiziellen Grenzübergang gewählt, sondern heimlich den Grenzbach und seine sumpfigen Ufer durchwatet hatten. Jetzt, da sie die Landesgrenze im Rücken wußten, hätte es eigentlich keinen Grund mehr zur Furcht gegeben. Trotz dieser Gewißheit jedoch, trotz des befreienden Gefühls, ENDLICH AUF ÖSTERREICHISCHEM GEBIET zu sein, wurden sie diese Angst nicht los, sie hatten sich zu sehr an sie gewöhnt.
Dazu, sagt die Mutter, sei dieses schreckliche Gefühl gekommen, ZUM BETTLER geworden zu sein, von Haus zu Haus gehen, um ein vorübergehendes Obdach, um etwas Nahrung bitten zu müssen. Ihr Ziel sei ja Wien gewesen, dort hätte jeder von ihnen Verwandte, wenigstens Bekannte aus besseren Tagen gehabt.
Aber bis Wien sei es noch weit gewesen.
Schließlich habe sich ein Bauernwagen auf sie zubewegt, ein Bauer aus dem nächstgelegenen Dorf sei unterwegs gewesen, um Klee zu holen. Heinrich hat die Begegnung mit dem Bauern in einem Notizbuch beschrieben: ER ERKLÄRTE SICH DAZU BEREIT, UNS BEI SICH AUFZUNEHMEN, VORSICHT SEI ABER GEBOTEN, DA IM DORF DIE RUSSEN SEIEN. ER WÜRDE JETZT NACH HAUSE FAHREN, DEN KLEE ABLADEN UND NOCHMALS ZURÜCKKOMMEN. DANN SOLLTEN WIR UNSER GEPÄCK AUF DEN WAGEN GEBEN, ER WÜRDE KLEE DARÜBER BREITEN UND ZU SEINEM HOF FAHREN. WIR SOLLTEN IHM IN GRÖSSEREM ABSTAND FOLGEN. SO GESCHAH ES DANN AUCH.
Heinrich, an Wundrascheks Entlohnung denkend, bot dem Bauern das einzige Stück von einigem Wert an, das Valerie gewagt hatte, in ihrer Handtasche mitzunehmen, eine silberne Puderdose. Der Bauer wies die angebotene Gabe zurück, er wollte für seine Hilfe keinen Lohn. (Das werde ich nie vergessen, sagt die Mutter.)
Sie trotteten hinter dem Kleewagen nach, jenen Feldweg entlang, der sich, hellbraun, mit einem Stich ins Graue, zwei Fahrspuren, in der Mitte eine mit Erdstaub bedeckte Rinne, vom Grenzbach weg, zwischen Weizen- und Rübenfeldern, in Richtung des Dorfes Ottenthal im niederösterreichischen Weinviertel hinzog. (Es ist der gleiche Feldweg gewesen, den ich, Anna, auf der im Juni des Jahres 1981 entstandenen Farbfotografie wiederfinde.)
ES SIND GUTE LEUTE GEWESEN, sagt die Mutter.
Die Bäuerin schlug Eier in eine Pfanne, gab ihnen ein Stück Brot dazu. Die Männer durften in der Scheune schlafen, Frauen und Kindern wurden zwei aneinandergeschobene Betten als Nachtlager angewiesen. Ob es ihnen etwas ausmache, daß in dem Bettzeug die Russen geschlafen hätten? Nein, es machte ihnen nichts aus.
Sie blieben mehrere Tage, arbeiteten auf den Feldern, wurden dafür, soweit dies möglich war, mit Nahrung belohnt.
Heinrich operierte eine Frau, die einen Abszeß im Hals hatte, mit seinem Taschenmesser. Der für den Ort zuständige Arzt war vor der heranrückenden Front in den Westen geflüchtet.
Vielleicht hätten sie bleiben können, da der Ort ohne ärztliche Versorgung war, aber sie entschlossen sich weiterzuziehen. Ihr Gepäck ließen sie zurück. Sie gingen nach Mistelbach, übernachteten in einem Zimmer des Krankenhauses, wurden von dem für das Gebiet verantwortlichen ärztlichen Leiter nach Stronsdorf verwiesen.
Auf der Landkarte, die vor mir auf dem Schreibtisch liegt, sind die Entfernungen zwischen den an der Hauptstraße gelegenen Orten angegeben. Auch wenn ich die Möglichkeit von Abkürzungen über Feldwege in Erwägung ziehe, ist für den Weg von Ottenthal nach dem Städtchen Mistelbach eine Entfernung von rund dreißig Kilometern anzunehmen, von dort über Eichenbrunn nach Stronsdorf werden es wieder etwa fünfundzwanzig Kilometer gewesen sein. DAS ALLES ZU FUSS, sagt die Mutter.
Sie gingen hügelauf, hügelab, zwischen Feldern, an kleinen Wäldchen vorbei, an Obstbäumen, die vom Wind alle in die gleiche Richtung gezaust waren.
In Stronsdorf sei DER GANZE PLATZ VOLLER RUSSEN gewesen. Hier bleibe ich nicht, sagte Valerie.
(Der Marktplatz von Stronsdorf, auf dem die vielen russischen Soldaten gelagert haben, ist auf mehreren, im Juni 1981 entstandenen Fotografien zu sehen. Es ist ein großer, kahl wirkender, heute beinahe zur Gänze asphaltierter oder betonierter Platz, von niedrigen Häusern gesäumt, die eine Seite abgeschlossen durch einen Gasthof mit glatt verputzter Fassade, auf der anderen Seite eine Mariensäule, umgeben von Grün. Schwierig, sich vorzustellen, wie dieser heute friedlich wirkende Platz damals ausgesehen hat, nicht schwierig, die Angst nachzuempfinden, die Valerie beim Anblick der vielen russischen Soldaten überkam, ihre entschiedene Weigerung, in das heute noch unveränderte Arzthaus einzuziehen, obwohl ihr das angeboten worden ist.
Auch dieser Arzt war geflüchtet, auch die Bewohner von Stronsdorf waren ohne ärztliche Betreuung geblieben. Zwei alte Frauen, auf dem Weg zur Andacht in die wuchtige Pfarrkirche, zu der mehrere Steinstufen hinaufführen, erinnern sich: Ja, damals sei es furchtbar gewesen. Sie seien mit ihren Kindern alle UNTER DER KIRCHE gewesen. Nein, nicht möglich, das zu vergessen. Aber man habe es ja überstanden. Gott sei Dank.)
Heinrich und Valerie waren von dem ärztlichen Leiter des Mistelbacher Krankenhauses an eine bestimmte Adresse verwiesen worden, hatten das Haus gefunden, an die Tür geklopft, warteten. Endlich wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet, sie wurden nach ihren Wünschen gefragt. Heinrich nannte den Namen des Arztes in Mistelbach. Längeres Zögern, schließlich schob eine Hand die Sicherheitskette zurück, eine alte Frau öffnete die Tür, bat einzutreten, schloß sofort wieder ab, legte die Kette vor. (Man habe erkennen können, daß die Bewohner des Ortes in ständiger Angst gewesen seien.)
Sie wurden in ein Zimmer mit alten Möbeln geführt, mit Tee bewirtet, durften sich ausruhen, ein wenig schlafen, wurden dann an den Bürgermeister verwiesen, dort freundlich aufgenommen, zum Haus des Arztes gebracht. Obwohl das Haus zur Gänze eingerichtet, alles Notwendige vorhanden war, obwohl sie von der Frau des geflüchteten Arztes gebeten wurden, zu bleiben, beharrte Valerie auf ihrer Weigerung.
Hier bleibe sie nicht einen Tag länger, sagte sie.
Zurück nach Mistelbach, sagt die Mutter, sie seien an einer Schlucht vorbeigekommen, seien so erschöpft, so mutlos, traurig gewesen, daß sie nahe daran gewesen seien, in die Schlucht zu springen.
SPRINGEN WIR, soll der Vater gesagt haben. Da habe ihn Valerie an die Tochter Anni erinnert, die vielleicht noch am Leben sei. Daraufhin hätten sie einander an der Hand genommen und seien weitergegangen. Unterwegs habe ein russisches Lastauto angehalten, der Fahrer habe sie bis knapp vor Mistelbach mitgenommen. Das Lastauto habe junge Zwiebeln geladen gehabt, ihr Kleid und ihre Unterwäsche, sagt die Mutter, seien ganz grün von den Zwiebeln gewesen.
In Mistelbach habe man ihnen einen anderen Ort genannt, dessen Arzt ebenfalls geflüchtet war, sie gingen weiter bis dorthin, es waren nur wenige Kilometer, sie seien es schon so gewöhnt gewesen, zu gehen und zu gehen, im Traum, sagt die Mutter, habe sie noch ihre Füße bewegt.
Ich, Anna, suche das Dorf W. südlich von Mistelbach auf der Landkarte, in dem sie schließlich für längere Zeit geblieben sind. Die Frau eines Schusters nahm sie auf, sie lebte mit ihrer Schwiegermutter, Frau O., im gemeinsamen Haushalt, der Schuster war noch nicht wieder heimgekehrt, man hatte keine Nachricht von ihm, sein letzter Feldpostbrief war aus Rußland gekommen.
Man wies ihnen ein Zimmer zu, zwei Betten, ein kleiner Tisch, zwei Stühle, ein Heiligenbild.
Heinrich hatte sechs, mehrere Kilometer voneinander entfernt liegende Dörfer zu betreuen, er hat die Namen in seinem Notizbuch notiert.
Ich stelle mir vor, wie er, mager, mittelgroß und schwächlich, mit ständig schmerzenden Magengeschwüren, bei Tag und Nacht zu seinen Kranken unterwegs gewesen ist. Nicht einmal ein altes Fahrrad hatte er, wie er es damals am Anfang in B. besessen hatte, nur wenige Medikamente, die er aus dem Mistelbacher Krankenhaus bezog, kaum Instrumente. Mit unzureichenden Mitteln kämpfte er ununterbrochen gegen Seuchen, Infektionskrankheiten, Geschlechtskrankheiten an. STÄNDIG WAREN FLÜCHTLINGE, VERTRIEBENE AUF DEN STRASSEN UNTERWEGS!
(Flüchtlinge, Vertriebene überall, an den Straßenrändern kauernd, auf den Feldern liegend, ein Mann, der zu dieser Zeit nach Wien gegangen ist, beschreibt sie, WIE SCHAFE zusammengedrängt, oder WIE KRÄHEN auf abgemähten Getreidefeldern hockend, Hunderte, TAUSENDE Menschen, vor allem Frauen, alte Leute, Kinder, Tausende auch auf dem Überschwemmungsgebiet an der Donau bei Wien, schon im Stadtgebiet. Alte Frauen hätten sich, auf diesen Feldern und Wiesenflächen sitzend, ihre Röcke gegen den Regen über den Kopf gezogen, als wollten sie nichts mehr von all dem sehen, was um sie herum vorging, was sich ereignete. In Wien übernachteten sie in Hausfluren, irgendwo unter freiem Himmel, neunhundert Vertriebene aus der Gegend von Pilsen lagerten, nachdem sie über drei Wochen von Preßburg nach Wien zu Fuß gegangen waren, einen Tag und eine Nacht lang auf dem Wiener Heldenplatz.)
Im leerstehenden Haus des aus W. geflüchteten Arztes hatte man Vertriebene untergebracht, die an Ruhr erkrankt waren.
DU KANNST DIR DAS NICHT VORSTELLEN, sagt die Mutter, wie das ausgesehen hat, wie fürchterlich das gewesen ist. Die Kranken sind in den Zimmern auf dem Fußboden gelegen, der Kot ist über die Treppe heruntergeronnen. Viele sind gestorben. EIN WUNDER, DASS WIR NICHT KRANK GEWORDEN SIND.
An einem einzigen Tag dreißig an Typhus Erkrankte in den umliegenden Dörfern, Heinrich hat es in seinem Notizbuch aufgeschrieben. Er eilte, unterernährt, geschwächt, selbst von Schmerzen geplagt, ununterbrochen auf den Feldwegen zwischen den Dörfern hin und her. Man bezahlte ihn mit einem Löffel Schmalz, mit einem Mittagessen am Familientisch, mit einigen Kartoffeln, einem Ei.
Bilder: Ein russischer Lastwagen hält vor dem Haus des Schusters, der Lastwagen hat geschlachtete Kühe geladen, der Fahrer, ein Russe, steigt aus, klopft an die Haustür. Valerie will nicht öffnen, der Russe gibt nicht nach, klopft immer wieder, will den Doktor sprechen, verlangt ein bestimmtes Medikament.
Schließlich öffnet Valerie, sieht das Fleisch auf dem Lastwagen. Sie habe, sagt die Mutter, EINE IDEE GEHABT. Als der Russe seine Forderung nach dem Medikament wiederholt, zeigt Valerie auf den Wagen, erklärt, sie würde das Medikament geben, wenn sie dafür Fleisch bekäme.
Der Russe verlangt ein Beil, Valerie holt die große Holzhacke der Frau O., der Russe steigt auf den Wagen, hackt die Hälfte einer halben Kuh ab, wirft sie vom Wagen herunter, steigt ab, schleppt das Fleisch an Valerie vorbei in den Hausflur hinein, Valerie bezahlt mit dem gewünschten Medikament.
Sie hat Mut gehabt, immer schon, sie hat es mehrfach bewiesen.
Die alte Frau O. allerdings, sagt die Mutter, die eben, als dieser Handel vollzogen wurde, aus der Kirche kam, aus dem SEGEN, habe ihr Vorwürfe gemacht. MIT EINEM RUSSEN, habe sie gesagt, das Wort RUSSEN dabei betont, sie bringe ja das ganze Dorf in Verruf.
ABER DAS FLEISCH UND DIE SUPPE HABEN IHR GESCHMECKT, sagt die Mutter. Das Beil allerdings habe von dem Zerhacken der Knochen Scharten bekommen.