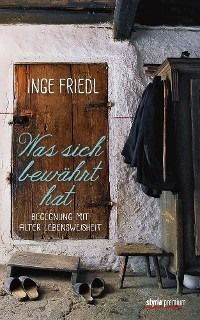Kitabı oku: «Was sich bewährt hat», sayfa 2
DAS GLÜCK DER ZUFRIEDENHEIT
Ein erster Schritt zur Gelassenheit

ZUFRIEDENHEIT IST EINE ENTSCHEIDUNG. Das klingt einfach und ist es vielleicht auch. Man sagt „Danke, das genügt!“, und ist zufrieden. Man beschließt, dass das, was man hat und was man ist, gut genug ist. Man ist nicht unentwegt getrieben von der Idee, etwas Besseres, etwas Anderes oder eine größere Auswahl zu finden. Man hat sich entschieden, zufrieden zu sein und bleibt dabei. Die Wissenschaft nennt solche Menschen Satisficer. Das Wort setzt sich aus den englischen Wörtern satisfying (zufriedenstellend) und suffice (genügen) zusammen. Ein Satisficer begnügt sich mit der ersten besten Möglichkeit, die seinen Zielen entspricht. Er entscheidet sich: „Es genügt. Ich bin zufrieden. Ich brauche nicht mehr.“
Heinrich Böll schrieb eine wunderbare Kurzgeschichte zu diesem Thema. Er nannte sie „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“. In einem Hafen treffen ein Tourist und ein Fischer aufeinander. Der Fischer liegt entspannt in seinem Boot und döst. Der Tourist fotografiert diese idyllische Szene. Klick, klick und noch einmal klick. Der Fischer wacht auf und die beiden kommen ins Gespräch. Der Tourist fragt ihn, ob er nicht an diesem Tag noch ein zweites Mal auf Fischfang gehen wolle, da das Wetter doch günstig sei. Der Fischer schüttelt den Kopf. Nein, er werde nicht ausfahren. Er habe heute bereits so viel gefangen, dass er auch für den nächsten und übernächsten Tag genug habe.
„Aber“, sagt der Tourist, „stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht gar zehn Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das mal vor.“ Wenn der Fischer das täglich tun würde, so der Fremde, könnte er sich in einem Jahr einen Motor für sein Boot, in zwei Jahren ein zweites Boot, irgendwann einen oder sogar zwei Kutter leisten. Dann könnte er sich ein kleines Kühlhaus bauen, eine Räucherei, später vielleicht eine Fabrik. Er könnte mit einem Hubschrauber die Fischschwärme suchen und per Funk den Kuttern Anweisung geben. Er könnte ein Fischrestaurant eröffnen und Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren. Und dann, ja, dann könnte er beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. „Aber das tue ich doch schon jetzt“, sagt der Fischer, „ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Ihr Klicken hat mich gestört.“
Der Fischer ist der Prototyp des Satificer, der selbst entscheidet, wann es genug ist und wann er zufrieden sein kann. Eigentlich ist jemand wie er eine Provokation in einer Welt, in der alles immer größer, schneller und besser sein muss.
Diese Erzählung von Heinrich Böll ist zwar sehr schön, aber dennoch erfunden. Wahr hingegen ist folgende Begebenheit: Der Besitzer eines kleinen Kaufmannsladens3, der alles führte, was das Dorf so brauchte, der aber gerade nur so viel abwarf, dass die Familie bescheiden davon leben konnte, fasste seine Lebensphilosophie in einem Satz zusammen: „Solange wir unser Auskommen haben, gibt es nichts zu jammern.“
Der Fischer und der Kaufmann, beide sind zufrieden, wenn auch auf unterschiedliche Art. Sie haben beide eine Art Stopp-Schild gegen die Unzufriedenheit aufgestellt, auf dem steht: „Ich habe alles, was ich brauche!“ Auch der Kaufmann hat eine Entscheidung getroffen.
Er und seine Familie haben die eigenen Ziele den Umständen angepasst. Sie waren bescheiden in ihren Lebensträumen und waren zufrieden, wenn sie genug verdienten, um einigermaßen gut leben zu können.
DAS WICHTIGSTE, WAS MAN ÜBER ZUFRIEDENHEIT WISSEN MUSS, ist, dass sie immer das Ergebnis eines Vergleichs ist. Dazu eine weitere Geschichte. Eine 1935 geborene Frau, Juliane, die Tochter eines Kleinbauern, meinte, dass ihre Familie nach heutigen Maßstäben eigentlich arm gewesen ist. Bis zum Alter von etwa 12 Jahren wäre ihr so ein Gedanke nie gekommen, weil ihr der Vergleich gefehlt hätte. In ihrer Kindheit hatte sie nie den Eindruck gehabt, dass sie zu kurz kommt, denn alle im Dorf hatten gleich viel oder gleich wenig – je nachdem, wie man es betrachtete.
Die Familie hatte sieben Kinder und besonders während des Krieges eine schwere Zeit. Der Vater war Soldat und die Mutter musste die ganze Last der Arbeit alleine tragen. Man hatte drei, vier Kühe, ein paar Hühner und zwei Schweine. Ein Schwein wurde jährlich verkauft, das andere musste den Fleisch- und Fettbedarf der Familie für ein Jahr decken. Geld war nur vorhanden, wenn das Schwein oder eines der Kälber verkauft wurde – das heißt, Geld war absolute Mangelware. Für die Kinder bedeutete dies: keine (gekauften) Spielsachen und neue Kleidung oder Schuhe nur für die ältesten Geschwister. Die Kleineren mussten „nachtragen“, was den Großen nicht mehr passte.
Juliane erinnert sich noch gut an den Moment, als ihr das erste Mal klar wurde, dass ihre Familie arm war, und dass ihr fehlte, was andere besaßen. Zu diesem Zeitpunkt ging sie bereits in die Hauptschule. An einem heißen Tag wollte sie in einem kleinen Stausee baden. Da der Weg dorthin steinig und voll Schotter war, zog sie ihr einziges Paar Schuhe an. Dies war im Sommer ungewöhnlich, denn die meisten Kinder gingen in der warmen Jahreszeit barfuß, um die kostbaren Schuhe zu schonen. Juliane aber hatte an diesem Tag keine Lust dazu. Sie ließ sich auch nicht von ihrer Mutter überreden, die sie wiederholt aufforderte, doch die Schuhe zu sparen und bloßfüßig zu gehen.
Und so geschah es dann – beim Baden wurden ihr die Schuhe gestohlen. Juliane traute sich nicht, ihren Eltern davon zu erzählen und ging am nächsten Tag barfuß in die Schule. Erst dort realisierte sie, dass sie die einzige Schülerin ohne Schuhe war. In der Volksschule waren fast alle Kinder bloßfüßig gewesen, aber jetzt war sie die einzige an der ganzen Schule. Die Hauptschule besuchten damals fast nur die Kinder der besser gestellten Eltern und alle besaßen selbstverständlich mehrere Paar Schuhe. Juliane schämte sich für ihre Armut. Sie wurde zwar nicht von den Mitschülern gehänselt, aber es war ihr äußerst peinlich.
Ein paar Tage ging das so, bis die Eltern bemerkten, was los war. Sie mussten wohl oder übel ihrem Kind neue Schuhe kaufen – eine unvorhergesehene, große Geldausgabe. Bis zu diesem Zeitpunkt war es Juliane völlig egal gewesen, dass sie nur ein einziges Paar Schuhe besaß. Ihrer Ansicht nach war das absolut ausreichend. Doch nun wurden ihr die Augen geöffnet, indem sie sich mit anderen vergleichen konnte, die mehr besaßen als sie.
Von Søren Kierkegaard stammt der Ausspruch „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“. Genau das macht uns heute Stress. Der Nachbar hat ein größeres Auto, die Kollegin ein höheres Einkommen und die Freundin bucht den teureren Urlaub. Das wollen wir auch. Der zuvor erwähnte Dorfkaufmann aber sagte sinngemäß: „Wenn du genug hast, dann sei zufrieden.“ Das klingt nach Bescheidenheit und das kommt heute gar nicht gut an. Sich-Bescheiden, das klingt nach Sich-zufrieden-Geben, wo man doch noch immer mehr haben könnte.
Die Kaufmannsfamilie, von der oben die Rede ist, war zufrieden, weil die Kluft zwischen ihrer realen Situation und dem, was sie sich erträumten und wünschten nicht besonders groß war. Sie haben „Frieden“ mit ihren Sehnsüchten geschlossen und so ihre Seelenruhe gefunden. Nicht umsonst steckt das Wort „Friede“ im Begriff Zufriedenheit.
ICH KENNE ZAHLREICHE EXPERTEN FÜR ZUFRIEDENHEIT. Sie sind weder Psychologen noch Soziologen noch haben sie studiert. Es sind weise und lebenserfahrene Menschen, die alle von einer Zeit berichten können, in der scheinbar „andere Gesetze“ herrschten. Es handelt sich dabei um die Zeit – bei uns am Land – bis etwa in die 1960er-Jahre.
Immer wieder fragte ich meine Gesprächspartner, was denn „die gute alte Zeit“ wirklich ausgemacht hat, was sie heute vermissen würden. Und immer wieder tauchten vor allem zwei Begriffe als Antwort auf: Zufriedenheit und Gemeinschaft. Stellvertretend für viele steht die Aussage einer älteren Bäuerin: „Obwohl man kein Geld gehabt hat, hat man trotzdem alles gehabt, was man gebraucht hat.“
Kein Geld – das ist fast wörtlich zu nehmen. Die Menschen waren Selbstversorger und lebten äußerst sparsam. Das galt für alle, für Arme und für Reiche. Reich war, wer Landbesitz, ein großes Bauerngut und viel Vieh hatte. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass viel Bargeld vorhanden war und noch weniger, dass man es ausgab.
Der große Gleichmacher am Land war früher der Mangel an Bargeld. Alle besaßen gleich wenig davon. Lediglich der Bauer selbst, der Besitzer, konnte größere Ausgaben tätigen, alle anderen lebten (fast) ohne Geld.
Eine Innviertler Bauerntochter erzählte, dass sie in ihrer Jugend über weniger Geld verfügte als eine Magd, die zumindest ein kleines, aber regelmäßiges Einkommen erhielt. Wenn sie hingegen Geld benötigte, musste sie ihre Mutter um ein paar Groschen bitten. Jede Bäuerin hatte einen kleinen Zuverdienst durch den Verkauf von Hühnereiern. Das war übrigens das einzige Bargeld, über das die Bäuerinnen frei verfügen konnten. Die Mutter zweigte vom „Hühnergeld“ ein wenig ab und gab es der Tochter, die damit vielleicht beim Kaufmann ein Stück Stoff oder eine Kleinigkeit am Kirtag kaufte.
Wo wenig Geld vorhanden war, wurde wenig Geld ausgegeben. Ein sparsamer Lebensstil war nicht nur Pflicht, sondern die einzige Möglichkeit, sein Auskommen zu finden. Es ist paradox, dass gerade diese Zeit von meinen Gesprächspartnern als die zufriedenste bezeichnet wird.
Sparsamkeit – nicht zu verwechseln mit Geiz und Knausrigkeit – macht tatsächlich zufrieden. Die US-Psychologin Miriam Tatzel sorgte international für Schlagzeilen, als sie behauptete: „Sparsame Menschen sind sehr glücklich!“ Sie wollte herausfinden, welcher Typ von Konsument am zufriedensten ist. Der Schnäppchenjäger? Der, der sich alles leisten kann? Der Konsumverweigerer? Das Ergebnis war überraschend. Am zufriedensten sind zwei Konsumententypen: Die Sparsamen und die Genießer. Der Genießer gibt sein Geld für Erlebnisse, etwa für Reisen oder für Konzerte aus. Der Sparsame ist nicht einer, der nach Sonderangeboten jagt, sondern jemand, der Nein zu Kaufverlockungen sagen kann und der weiß, wann es genug ist. Eher unzufrieden und nicht sehr glücklich sind hingegen Menschen, die nach Statussymbolen, nach teuren Autos, Villen, Kleidung, Schmuck streben. Diese Menschen haben oft Schulden und sind eher impulsive Käufer.
Dass Geld nicht auf Dauer glücklich macht, merken wir, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Geld spielt durchaus eine große Rolle, wenn wir arm sind. Aber ab einem ausreichenden Einkommen steigt unsere Zufriedenheit nicht weiter an, wenn wir mehr Geld verdienen. Eine Gehaltserhöhung macht nur kurzfristig glücklich, und zwar genau so lange, bis wir uns an den scheinbar besseren und auf jeden Fall teureren Lebensstil gewöhnt haben. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir noch zufrieden, wenn wir ein oder zwei Fernsehkanäle in Schwarz-Weiß empfangen konnten. Heute erwarten wir, Dutzende von Sendern empfangen zu können, selbstverständlich farbig und in HD.
DIE QUAL DER WAHL. Die Last, eine Entscheidung angesichts einer unüberschaubaren Auswahl treffen zu müssen, kennt heute wohl jeder. Es beginnt bei der Berufsausbildung. Eine Lehre? Wenn ja, welche? Oder lieber doch eine weiterführende Schule, eine berufsbildende Schule oder gar eine Lehre mit Matura? Alles geht. Soll man danach gleich arbeiten oder lieber eine Hochschule, Universität oder Fachhochschule besuchen? Ein Auslandssemester – ja oder nein? Wehe, man trifft die falsche Entscheidung!
Und erst die Frage nach dem richtigen Lebenspartner. Auch hier scheint alles möglich. Soll man im Bekanntenkreis suchen oder doch lieber im Internet? Und hat man jemanden gefunden – ist er oder sie wirklich der oder die Richtige? Wartet nicht irgendwo da draußen vielleicht noch ein „perfekterer“ Partner?
Eine große Drogeriekette warb mit dem Slogan „Mehr Auswahl als es Wünsche gibt“. Ist es nicht genau das, was sich Konsumenten wünschen? Man stelle sich vor, eine Kundin will ein Parfum kaufen.
Nun hat sie in diesem Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. Sie kann unter vielleicht hundert Düften wählen. Sie will den einen, den für sie richtigen Duft auswählen und riecht einmal an dem einen Flakon, einmal an dem anderen. Sie prüft lange, bringt einige Parfums in die engere Auswahl und entscheidet sich schließlich nach langem Hin und Her für eines. Aber nein, sollte sie nicht doch ein anderes nehmen … Vielleicht ein billigeres, ein teureres, ein blumigeres oder doch lieber eines mit einer Zitrusnote?
Hätte die Kundin nur vier oder fünf Parfums zur Auswahl gehabt, dann wäre sie am Ende mit ihrer Wahl wahrscheinlich zufrieden gewesen. So aber bleibt der Zweifel: Wäre nicht doch ein anderer Duft besser gewesen?
Wir stecken in einem Dilemma: Je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto unzufriedener und unschlüssiger werden wir. Barry Schwartz beschreibt das sehr treffend in seinem Buch „Anleitung zur Unzufriedenheit“: Je mehr Möglichkeiten es gibt, desto mehr Hätte-ich-Dochs lassen sich finden. Und so wird die Zufriedenheit mit der getroffenen Wahl ständig ein bisschen kleiner. Jeder kennt das Phänomen an der Supermarktkassa. Wo auch immer man sich anstellt, die andere Schlange ist die schnellere, und man denkt sich: „Hätte ich doch …!“
Wir können uns vor lauter Möglichkeiten schwer oder gar nicht entscheiden, welchen Weg wir einschlagen sollen. Eine ganze Generation ist unentschlossen und hin- und hergerissen: „Vielleicht ja, vielleicht nein.“ Der Autor des Buches „Generation Maybe“ drückt es so aus: „Ich bin ein Maybe. Ich wäre zwar gern keiner, aber es ist nun mal so. Ich tue mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Mich festzulegen. Mich einer Sache intensiv zu widmen. Ich sehe all die Optionen vor mir, die Verlockungen einer ultramodernen Welt, in der alles möglich ist. Egal, was wir wollen, was ich will, es ist meist nur einen Mausklick entfernt.“ So viele Angebote! Und mit jedem Angebot geht die Gefahr einher, sich falsch zu entscheiden und zu scheitern.
DIE GUTE ALTE DORFGREISSLEREI IST EIN GUTES BEISPIEL für Überschaubarkeit. Unendlich viele Wahlmöglichkeiten gab es hier nicht. Wer zum Kaufmann ging, hatte seine Kaufentscheidung schon vorher getroffen, denn erstens hatte man kaum Geld und zweitens gab es dort keine große Auswahl.
Ich traue mich wetten, dass die Kunden der alten Dorfkaufleute zufriedener mit ihren Einkäufen waren als Kunden eines heutigen Supermarktes mit gigantischer Produktauswahl. Dass eine kleinere Auswahl zufriedener macht, lässt sich sogar wissenschaftlich beweisen. In einem Delikatessengeschäft wurden den Kunden zwei Probiertische mit Marmeladen angeboten, einer war mit sechs, der andere mit vierundzwanzig Sorten bestückt. Tatsächlich blieben deutlich mehr Kunden beim Tisch mit der größeren Auswahl stehen. Allerdings konnten sich nur wenige von ihnen zum Kauf entscheiden. Sie grübelten, zweifelten und wirkten verunsichert. Ganz anders dagegen die Kunden, denen die kleine Auswahl vorgesetzt wurde. Sie schienen genau zu wissen, was sie wollen und kauften ein.
Je kleiner die Auswahl, desto sicherer können wir Entscheidungen treffen. Das gilt nicht nur für Marmelade, sondern auch für alle anderen Entscheidungen im Leben. Es muss kein Nachteil sein, nur zwischen wenigen Berufen wählen zu können oder gar einen von den Eltern vorherbestimmten Beruf ausüben zu müssen. Eine Bauerstochter wusste, sie kann entweder als Magd am Hof bleiben, den der Bruder übernimmt, oder einen anderen Bauern heiraten. Der Sohn eines Schmiedes wurde selbst Schmied. Die Tochter eines Gastwirtes übernahm den Betrieb. Diese Menschen wussten schon als Kind, was auf sie zukommt. Die Arbeitswelt der Eltern war ihnen nicht fremd, wie es heute oft der Fall ist. Die allermeisten dieser Menschen waren sehr zufrieden mit dem ihnen zugefallenen Beruf – ausgesucht haben sie ihn ja nicht.
Wir entscheiden heute über Dinge, die früher nicht zur Diskussion standen, etwa ob man Kinder bekommt oder nicht. Das überfordert uns oft und ist anstrengend. Zusätzlich müssen wir noch jeden Tag Tausende kleine Blitzentscheidungen treffen. Welchen Sender stelle ich im Radio ein? Beantworte ich ein E-Mail sofort oder später? Welche der unzähligen Kekssorten kaufe ich?
Früher waren viele Dinge vorhersehbar. Jeder Tag hatte seinen eigenen gleichbleibenden Rhythmus, jede Arbeitswoche endete in der Sonntagsruhe und jedes Jahr hatte seine immer gleichen Ruhezeiten, Festzeiten und Arbeitszeiten. Diese Regelmäßigkeit schuf Sicherheit. Auf Arbeit folgten Ruhephasen, auf den Alltag ein Fest, auf den arbeitsreichen Sommer der Herbst und der ruhige Winter.
Diese Überschaubarkeit machte zufrieden. Es gab einen roten Faden, der sich durch das Leben zog. In den meisten Fällen, hat man so gelebt, wie schon der Vater und die Mutter gelebt haben. Lebenswege waren vorgezeichnet und festgelegt. Berufsentscheidungen, ja sogar die Partnerwahl waren vorhersehbar. Die Arbeit war zeitweise hart, das Leben auch damals schon ungerecht – aber die Lebenslinien waren klarer als heute. Heute hat man das Gefühl, dass man theoretisch alles erreichen könnte, was man will. Alles scheint machbar, wenn man nur die richtigen Entscheidungen trifft und sich genügend anstrengt.
Die Alten waren gelassen, weil sie zufrieden waren. Diese Gelassenheit war eine Art Urvertrauen: „Es wird schon werden!“ Eine innere Sicherheit, die langsam reifen durfte, weil das Leben so überschaubar war. Man war zufrieden, weil man sich in seinem Leben auskannte.
DAS FACH „GLÜCK“ WIRD HEUTE SOGAR IN DER SCHULE UNTERRICHTET. Interessanterweise lässt sich aber keine einzige Schule finden, die das Fach „Zufriedenheit“ auf ihrem Stundenplan hat. Alle wollen glücklich sein, aber keiner sucht nach Zufriedenheit?
Von Glück war in meinen Gesprächen eher selten die Rede. Manchmal erzählten Menschen von einer glücklichen Kindheit – interessanterweise mehr Frauen als Männer. Die eine oder andere Sennerin bezeichnete die Zeit auf der Alm als „glücklich“. Sonst kam das Wort Glück praktisch nie vor. In über 100 Stunden Gesprächszeit mit Dutzenden Personen in fast ganz Österreich wurde Glück als Gemütszustand nur ein paar Mal erwähnt, dafür war unzählige Male von Zufriedenheit die Rede.
Was können wir von den Alten lernen? Ein zufriedenes Leben macht mehr aus, als sich den Stress einer übergroßen Auswahl zu ersparen. Mehr als die Entscheidung zu treffen, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein und sich keine unerreichbaren Ziele zu stecken. Es ist das Gesamtpaket der alten Lebensweise, auf die wir schauen sollten: auf den Lebensrhythmus, auf die Gemeinschaftspflege, auf die Rituale und Gewohnheiten, auf die Art und Weise, mit Tempo und Zeit umzugehen. Auch die Kleinigkeiten, die letztlich große Bedeutung haben, sollten wir nicht außer Acht lassen: Humor, Dankbarkeit, Vorfreude, Warten Können, Singen und Musik. Und nicht zuletzt, das Wissen und die Weisheit der Alten zu achten und zu respektieren. All das macht zufrieden, ja, vielleicht sogar glücklich.
DER UMGANG MIT DER ZEIT
Eines nach dem anderen statt alles auf einmal

EIN BAUERNSOHN ERZÄHLTE folgende Geschichte: Der Schmied seines Dorfes trat jeden Tag um Punkt 12, wenn die Glocken läuteten, vor seine Werkstatt, nahm seine Kappe ab und betete ein „Gegrüßet seist du Maria“. Kam nun eines der Dorfkinder gerade dazu, musste es sich auch dazustellen und mitbeten. An ein Vorbeikommen war nicht zu denken. Das „Zwölfebeten“ war der Brauch und wurde eingehalten.
Diese kleine Geschichte zeigt, wie das Läuten der Glocken den Tag der Menschen prägte und einteilte. Ein französisches Sprichwort sagt: „Eine Stadt ohne Glocken ist wie ein Blinder ohne Stock.“ Das Morgenläuten, Mittagsläuten und Abendläuten zeigte nicht nur die Stunde an und rief zum Arbeitsbeginn, zum Mittagessen und zum Feierabend, es rief auch zu einem kurzen Innehalten und Gebet auf. In Bayern zeigten die Glocken sogar an, bis zu welchem Zeitpunkt man Weißwürste essen durfte. Man sagte: „Die Weißwürscht dürfen das Elfeläuten nicht hören!“ Gemeint ist damit, dass die leicht verderblichen Weißwürste in Zeiten ohne Kühlschrank zur Vormittagsjause gegessen werden mussten.
Die Uhren der Glockentürme zeigten wohl die Zeit an, wenngleich sie lange, bis ins 19. Jahrhundert, nur einen einzigen Zeiger hatten, nämlich den Stundenzeiger. Der Minutenzeiger wurde nicht gebraucht. Es kam nicht auf die Minute an!
Pünktlichkeit bezog sich auf Zeiträume, nicht auf einen Zeitpunkt. Ein schönes Beispiel dafür sind die sogenannten Besuchstage. Es gab einige traditionell festgelegte Tage im Jahr, an denen Verwandte und die Taufpatin besucht werden konnten. Das war zu den Weihnachtsfeiertagen meist der 26. Dezember für die Verwandten und zu Allerheiligen und Ostern für die Patin. Im Winter wurden die Rosse eingespannt und man fuhr mit dem Schlitten, in den anderen Fällen ging man aber zu Fuß – und das stundenlang. Man kam an, wenn man da war – das war von Jahr zu Jahr unterschiedlich – meist irgendwann im Laufe des Vormittags.
Robert Levine beschreibt in seinem Buch „Eine Landkarte der Zeit“ wie unterschiedlich in den verschiedenen Ländern der Erde Zeit wahrgenommen wird. Er fand heraus, dass das Lebenstempo in der Schweiz am höchsten und in Mexiko am niedrigsten ist. Er unterscheidet Uhr-Zeit und Ereignis-Zeit, wobei er die westlichen Kulturen der Ersteren zurechnet. Der Zeitforscher Karlheinz Geißler warnt vor einer Zerstörung der fremden Zeitkulturen, in der weniger die Uhrzeit als Rhythmen und Zyklen eine Rolle spielen.
Auch die alte Zeitkultur, von der hier die Rede ist, und die sich nicht in Minuten und schon gar nicht in Sekunden messen ließ, ist stark bedroht oder bereits zerstört. Diese Zeit war nicht geprägt durch die Uhrzeit, die den Tag taktet, in Stücke zerlegt und in kleine Scheibchen gliedert, sondern sie war aufgabenbezogene Ereignis-Zeit. Jeder Tag, jede Woche, jede Jahreszeit hat bestimmte Aufgaben und einen unverwechselbaren Rhythmus.
WENN ES LICHT WURDE, begann der Arbeitstag. Er dauerte im Sommer länger und war im Winter kürzer. Der natürliche „Lichttag“ war auch lange Zeit die Definition für den „Tag“ überhaupt. Die Römer sahen den Sonnenaufgang als Tagesbeginn. Wenn wir in der Osterliturgie hören, dass Jesus um die neunte Stunde gestorben ist, dann heißt das, von 6 Uhr morgens gezählt, um 3 Uhr Nachmittag.
Zeitgeber war nicht die Uhr, sondern die Sonne als Naturzeitmaß. Ein Tag begann mit dem Aufgang der Sonne und endete mit ihrem Untergang.
Selbstverständlich kannten unsere Alten die Uhrzeit-Stunde, aber sie spielte kaum eine Rolle. Nicht einmal die Arbeitszeit wurde danach bemessen. Ein arbeitsreicher Tag war einer, der von „der Finstern zur Finstern“ dauerte, also im Morgengrauen begann und in der Dunkelheit endete. Ein Taglöhner wurde nicht nach Stunden entlohnt, sondern arbeitete einen „ganzen Tag“, einen „Halbtag“ oder einen „Vierteltag“.
Ein Tischlermeister in Waizenkirchen in Oberösterreich bezeichnete in einem Gespräch das Viertel eines Tages noch als „Isetz“. So nannte man in dieser Gegend die Zeit vom Morgen bis zur Vormittagsjause, von da bis Mittag, von Mittag bis zur Nachmittagsjause oder von dieser bis zum Abend. Man brauchte diese Festlegungen vor allem bei Gemeinschaftsarbeiten wie dem Dreschen. Jeder Bauer half beim anderen jeweils so viele Tage, Halbtage und Vierteltage mit, wie es seinem eigenen Grundbesitz entsprach. Das abstrakte Zeitgitter der Stundeneinteilung war nicht nötig. Das heißt, es kam in dieser Kultur nicht auf die Stunde und auch nicht auf die Minute an.
Interessanterweise entspricht diese alte Tageseinteilung ziemlich genau den täglichen Gebetszeiten nach den Ordensregeln des heiligen Benedikt: Sonnenaufgang, Mitte des Vormittags, Mittag, Mitte des Nachmittags, später Nachmittag und Sonnenuntergang (sowie Mitternacht).
Auch die Namen vieler Berggipfel erinnern uns an die Sonne als Zeitgeber: Zwölferkogel, Mittagsspitz, Neunerkogel, Elfer, Zehner, Einser. Der Gipfel diente als eine Art Sonnenuhr. Man wusste, steht die Sonne senkrecht über dem Mittagskogel, ist es 12 Uhr Mittag. In Sexten in Südtirol kann man gleich eine komplette Bergsonnenuhr betrachten. Vom Standpunkt Bad Moss aus gesehen, wandert die Sonne vom Neuner zum Zehner und Elfer, dann zur Mittagsspitze und von dort weiter zum Einser. Der Name Sexten kommt vermutlich aus dem lateinischen sexta hora, sechste Stunde, für 12 Uhr Mittag.
WANN IST ES ZEIT? Der Kochofen ist ein markanter Berg in den Schladminger Tauern. Die Bauern des Sölktales beobachteten ihn im späten Frühjahr besonders genau, denn er zeigte den richtigen Zeitpunkt für die Almfahrt an. Jeder im Tal kannte den dazupassenden Spruch: „Ist der Kochofen wie eine gscheckate Kalm (gescheckte Kalbin), oft fahren Broatlahner auf die Alm. Ist der Kochofen wie ein grüner Hut, ist es auf allen Almen gut.“ Das heißt: Wenn am Kochofen noch Schneereste zu sehen sind, kann man nur auf die Breitlahnalm auffahren. Erst wenn die Weide schön grün ist, können alle Almen befahren werden.
Der richtige Zeitpunkt war eine Sache der Erfahrung und der guten Beobachtung. Wann soll gesät und wann angepflanzt werden? Wann soll das Holz geschlagen werden? Eine Person, meistens der Bauer, traf nach reiflicher Überlegung diese Entscheidung: Jetzt ist es Zeit!
Viele alten Rauchküchen hatten ein erstaunliches Detail: der Kamin über dem offenen Feuer, durch den der Rauch abzog, war oft aus Holz. In einem Kärntner Bauernhaus existierte ein derartiger Holzkamin mehr als 300 Jahre lang ohne je Feuer gefangen zu haben oder morsch geworden zu sein. Man sagt, das Holz für diesen Kamin wurde zum richtigen Zeitpunkt geschlagen.
Das Prinzip des rechten Zeitpunkts ist nach und nach durch den optimalen Zeitpunkt abgelöst worden. Der feine Unterschied liegt darin, dass der optimale Zeitpunkt aktiv mitgestaltet wird, während der rechte Zeitpunkt durch die Natur und durch überlieferte Erfahrungswerte mehr oder weniger vorgegeben ist. Nehmen wir das Holz. Der rechte Zeitpunkt, um Bauholz zu schlagen, ist in der Zeit der Saftruhe im Winter bei abnehmendem Mond. Der optimale Zeitpunkt (für ein Unternehmen) hingegen ist dann, wenn genügend Holzarbeiter verfügbar sind, die Umstände passen und das geschlägerte Holz bald verkauft werden kann. Das kann heutzutage durchaus im Sommer sein, dann wird das Holz eben vakuumgetrocknet.
„Michaeli ist der Erdäpfel fertig und zu Allerseelen das Kraut.“ Das ist altes Erfahrungswissen einer oberösterreichischen Bauernfamilie. Um den 29. September war der richtige Zeitpunkt, um die Kartoffeln zu ernten. Allerseelen war von altersher der Stichtag, um das Kraut einzubringen und im Dezember, um den Nikolotag herum, wurde es gehobelt. „Bartlmei schlagt’s Groamat auf’s Hei“ bedeutet, dass zu Bartholomäus, am 24. August, der zweite Heuschnitt, das Grummet, erfolgen sollte.
Man beachte, dass diese Stichtage nicht als Kalendertage festgelegt sind. Auch das ist eine Eigenart der alten Zeitkultur, niemals einen Tag als Datum festzulegen, sondern ihn immer mit dem entsprechenden Heiligennamen zu nennen. Damit wird das Jahr nicht durchgezählt, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, sondern es wird rhythmisch gegliedert über Josefi, Georgi, Laurenzi, die Jakobstage, den Andreastag, den Leonhardstag bis Martini, Leopoldi und Kathrein. Die Letzte übrigens, auch ein Stichtag, „stellte den Tanz ein“. Ab dem Kathreinstag, dem 25. November, bis zum Faschingsbeginn, dem Dreikönigstag am 7. Januar, herrschte Tanzverbot. Schlimm? Nicht unbedingt. Ganz offiziell durften jetzt ruhige, besinnliche Wochen des Innehaltens beginnen. Der Kathreinstag sagte es an: „Jetzt ist es Zeit.“
EINE GESCHICHTE ÜBERS ZEITSPAREN. Die Mäher wussten, dass sich taunasses Gras mit der Sense leichter schneiden lässt. Deshalb begannen sie in der Nacht um 2 oder 3 Uhr zu mähen und hörten erst auf, wenn die Sonne den letzten Tau getrocknet hatte, also gegen neun. Ein guter „Mahder“ war ein hochangesehener Mann. Er mähte nicht mit Kraft, sondern mit Geschicklichkeit. Deshalb konnte ein guter Sensenmäher bis zu fünf Stunden ohne Pause durcharbeiten.
Die Mäher standen in einer festgesetzten Formation. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte Mäher, hintereinander in abgesetzter Reihe. Sie mähten in gleichmäßigem Rhythmus und bewegten sich dabei langsam vorwärts. Stehen blieb man nur, um die Sense am Wetzstein, den jeder in einem Horn an seinem Gürtel mitführte, zu wetzen. Die Klinge selbst hatte jeder bereits am Vorabend gedengelt, also geschärft. Das typische Geräusch, wenn der Hammer dabei auf die Sensenklinge traf, war an den warmen Sommerabenden in allen Dörfern zu hören.
Alte, erfahrene Mäher führten die Reihe an, die Schwächeren und Jüngeren folgten. Es war eine Schande und dem Betroffenen äußerst peinlich, wenn er eingeholt wurde. Jetzt hektisch zu werden half auch nicht, denn beim Mähen konnte man Tempo nicht erzwingen. Es war die Frucht langer Übung.
Nach dem Mähen verstreuten die Frauen das Futter, wie das gemähte Gras gemäß seiner Endbestimmung genannt wurde, mit der Heugabel gleichmäßig über die ganze Wiese, damit es trocknete. Dann, nach einer Weile, meist am Nachmittag, wurde das Heu „umgekehrt“, das heißt gewendet. Gegen Abend wurde es zu kleinen Heuhaufen zusammengerecht. Am nächsten Tag das Gleiche wieder, verstreuen und wenden. Nun endlich war das Heu ganz leicht und dürr geworden, es raschelte und duftete und wurde mit dem Pferdegespann heimgeführt und auf dem Heuboden gelagert.
Heute wird die gleiche Arbeit von einer einzigen Person in nur drei Tagen erledigt. Früher, als noch mit der Hand gemäht wurde, brauchten mehrere Leute für die gleiche Fläche drei bis vier Wochen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.