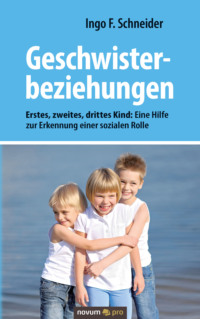Kitabı oku: «Geschwisterbeziehungen», sayfa 2
Die beiden älteren Kinder haben inzwischen zu zweit ihre Kinderwelt aufgebaut und sind fixiert in der Polarität ihrer Beziehung. Sie werden kleine elterliche Aufgaben übernehmen, werden das dritte Kind mit Interesse und Neugier betrachten, aber kaum auf die Idee kommen, das «süsse Kleine» in die polare Dynamik ihrer gewachsenen Zweierbeziehung einzubeziehen.
Erst- und zweitgeborene Erwachsene drücken sich gelegentlich über den Drittgeborenen aus: «Er ist anders als wir». Dabei ist interessant, dass sie von «wir» sprechen, gerade sie beide, die so gegensätzlich sind. Sie empfinden also ihre Polarität als eine Ganzheit, in welcher jeder seine eigene Identität im Spiegel seines Gegenübers findet; die Andersartigkeit des Drittgeborenen bedeutet, dass sie ihn als ausserhalb ihrer Polarität empfinden.

Was die konkreten Äusserungsformen betrifft, übernimmt das dritte Kind Verhaltensmuster von beiden Älteren. Diese Tendenz kann dann von den beiden anderen als Öffnung und Erweiterung in ihrer Identitätsfindung aufgenommen werden. Erwachsene sagen etwa von ihrem dritten Geschwister: «Bei ihm suchen wir Rat, wenn wir in Schwierigkeiten sind», oder sie wird als Bedrohung aufgenommen und als Andersartigkeit abgedrängt.
Von den gegensätzlichen Charakteristiken der ersten beiden Kinder wählt das dritte Kind meistens nur die eine oder die andere; es gibt nur ausnahmsweise eine dritte Möglichkeit. Aber es kann von einem gegensätzlichen Charakteristikpaar die Möglichkeit des ersten Kindes, von einem anderen diejenige des zweiten Kindes wählen. Dies führt zu einer häufig angetroffenen, scheinbaren Widersprüchlichkeit zwischen einzelnen Ausdrucksformen des dritten Kindes.
Wir finden also bei dritten Kindern in ihren konkreten Ausdrucksformen eine viel grössere individuelle Verschiedenheit als für die beiden anderen und man kann weniger über eine aufzählende Beschreibung aus der vergleichenden Befragung zu einem bildhaften Gesamteindruck kommen. Wir müssen gleichsam die Ebene wechseln und wir erfahren über das Funktionieren von Drittgeborenen viel mehr von Erwachsenen als von Müttern über ihre dritten Kinder. So kommen von erwachsenen Drittgeborenen immer wieder Äusserungen, die auf eine Auseinandersetzung um das Existentielle des Lebens schliessen lassen:
Eine drittgeborene Patientin erklärte mir, dass sie oft an eine nahe gelegene Böschung einer Autobahn gehe, um die vorbeirasenden Fahrzeuge zu betrachten. Ein drittgeborener Mann erzählte mir, dass er wiederholt die Kriegsgräber im Nord-Osten Frankreichs besuchte. Es wurde die Faszination beschrieben, zu beobachten, «zu was der Mensch fähig sei».
Zur Sensibilität höre ich gelegentlich Äusserungen wie: «Damit ich die Ereignisse wahrnehmen kann, müssen sie mich durchdringen. Wenn es mir schlecht geht, durchdringen sie mich auch, sonst würde ich sie nicht wahrnehmen können, aber sie erschüttern mich in meinem Innersten». Dies steht im Gegensatz zum Erstgeborenen, der eher einen Schutzwall um sich aufbauen würde, um sich nur ja nicht durchdringen zu lassen, und zum Zweitgeborenen, der eher weggehen und eine Beschäftigung suchen würde, um sich vom unangenehmen Ereignis abzulenken.
Zeit und Raum scheint von Drittgeborenen in anderer Weise als von den beiden Älteren wahrgenommen zu werden. So kommt es immer wieder vor, dass Patienten mir beschreiben, wie gehetzt sie sich fühlen, wenn sie einem Zeitprogramm folgen müssen, bei dem sich eine Arbeit an die andere reiht.
Der dritte Aspekt der Polarität: Das Spiel mit Raum und Zeit
Wie können wir, um die Funktionsart des dritten Kindes zu verstehen, die Ebene wechseln? Dazu ist es sinnvoll, bei den beiden älteren Kindern zu beginnen und zu überlegen, welche Gesetze ihrer alltäglichen polaren Dynamik beim dritten Kind zur Wirkung kommen.
Wie in Anhang 3, «ein dynamisches Konzept der Polarität», näher erklärt wird, können Polaritäten rhythmische Zyklen auslösen. Auch ist in der Natur ein Zyklus nie identisch mit dem vorhergehenden, sondern ist ihm ähnlich. Diese Ähnlichkeit führt dazu, dass sich Zyklen nicht im Kreis bewegen, sondern in ihrer Folge eine Spirale bilden. Da die Spirale in ihrer Achse richtunggebend ist, zeigt sie neben den beiden gegenläufigen Wirkungen der Pole eine neue, dritte Bewegungsrichtung. Diese dritte Bewegung, oder der «dritte Aspekt» der polaren Bewegung3, finden wir in allen zyklischen oder rhythmischen Phänomenen der Natur. Jeder Zyklus weist die gleiche Grundstruktur wie der vorhergehende auf, hat aber innerhalb dieser Grenzen neue Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten. Der dritte Aspekt wäre damit eine Voraussetzung für Wachstum, Reifung, Entwicklung und Entfaltung.
Diese Dreigliedrigkeit der Polarität ist die Grundlage der Dreierfolge in den Geschwisterstellungen. Die ersten beiden Kinder leben in einer polaren Dynamik: Sie spielen und streiten miteinander und erleben tagtäglich das Anderssein des anderen. In ihrer Beziehungsdynamik erfahren sie ständig, wie sich ihre Gegensätzlichkeiten ergänzen oder aufeinanderprallen. Dauernd wechseln sie zwischen Bewunderung und Verachtung, zwischen Neugier und Gleichgültigkeit, zwischen Sympathie und Antipathie. Bei jedem Wechsel zwischen diesen Polen machen sie Erfahrungen, hinter denen die Gesetzmässigkeit des dritten Aspektes polarer Zyklen zu erkennen ist. Erst die Erfahrung schreibt sich in die Zeitachse ein; ein identischer Zyklusdurchgang ist nie mehr möglich.
So kommt es, dass eine Geschwisterschaft von nur zwei Kindern dauernd das Doppelgesicht ihrer Polarität erlebt und diese über die Erfahrung im dritten Aspekt der Polarität entwickelt, auch ohne die Gegenwart eines dritten Kindes. Bei der Ankunft des dritten Kindes ist dieser dritte Aspekt der Polarität also bereits als Platzhalter vorgegeben. Das dritte Kind hätte dann keine andere Wahl, als diesen Platz einzunehmen und in dieser Rolle seine geschwisterliche Identität zu finden.
Was bedeutet es für das dritte Kind, ausserhalb der Polarität der beiden Älteren zu stehen? Welche soziale Rolle mit welchen konkreten Äusserungsformen kann man erwarten? Ich kann für diese Fragen keine abschliessende Erklärung geben. Von Erwachsenen bekomme ich gewisse Hinweise, die durch die typischen Ausdrucksformen des dritten Kindes bestätigt werden. So haben Drittgeborene eine andere Wahrnehmung von Zeit und Raum. Zum Beispiel beklagen sich drittgeborene Erwachsene regelmässig darüber, wie schwer es ihnen fällt, mit der Zeit zurechtzukommen. Gegenüber der objektiven Zeitstruktur mit Stundenplänen und Zeitprogrammen (Metron) hat bei ihnen das subjektive Zeitempfinden (Chronos) eine viel grössere Wichtigkeit als für die beiden Älteren. Auch die zum Raumempfinden gehörende Auseinandersetzung zwischen Abgrenzung und Zugehörigkeit zur Familie scheint sich bei Drittgeborenen in anderer Weise abzuspielen als bei den beiden anderen.
***
Zusammenfassung:
Die polare Beziehungsdynamik zwischen den ersten beiden Kindern bildet den Platzhalter für das dritte Kind:

… und die folgenden Kinder
Ein viertes Kind ist geboren worden.
Es sieht fünf Gesichter. Zwei gehören wiederum den beiden Eltern, die es umsorgen, und die anderen drei gehören drei Kindern, die untereinander einen in sich abgeschlossenen Zyklus bilden. Die beiden älteren Kinder haben ihre polaren Rollen übernommen und diese Polarität hat zu deren Entwicklung geführt, während das dritte Kind diese Entwicklung der Polarität, das heisst den dritten Aspekt der Polarität, als seine geschwisterliche Rolle übernommen hat.
Die drei älteren Kinder zeigen in ihren Rollen eine solche Abgeschlossenheit, dass es einem weiteren Kind nicht möglich ist, sich hier in einer eigenen, vierten Rolle zu entfalten. Angesichts dieser Abgeschlossenheit findet das vierte Kind also die gleiche Situation vor wie das erste Kind bei seiner Ankunft: Es findet zwei Eltern vor, die sich über ihre Sozialisationen in die Gesellschaft integriert haben. Die Eltern werden begleitet von drei älteren Kindern, die bereits begonnen haben, sich in dieser Familienspirale zu integrieren. Das vierte Kind entwickelt also, wie vor ihm das erste Kind, seine Partnerschaft zur Erwachsenenwelt.
***
Mit der vergleichenden Befragung wird die, schon 1958 von Karl König4 beschriebene, Dreigliedrigkeit der Geschwisterstellungen bestätigt. Es zeigte sich auch, dass sich diese Dreierstruktur in sehr grossen Familien mit acht und mehr Kindern bis zu den Jüngsten mit der gleichen Deutlichkeit zeigt. Man kann also annehmen, dass der Dreierrhythmus nicht durch einen anfänglichen Auslöser bestimmt wurde und sich mit der Zeit abschwächt, sondern dass ihm eine innere Gesetzmässigkeit zugrunde liegt, die beim Durchlaufen eines jeden Zyklus ständig neu angetrieben wird.
1 Alfred Adler: Kindererziehung, (1989) Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main
2 Siehe unter „Statistische Resultate“ von Christine Bruchez am Schluss dieses Buches.
3 Wenn wir von der klassischen Auffassung der Polarität mit der Gegensätzlichkeit von zwei Polen ausgehen, haben wir hier ein drittes Element. Für dieses «Dritte» eine Bezeichnung zu finden, ist schwierig. Wir könnten von dritter Bewegung, Kraft, Tendenz, Aktivität, Element sprechen, ich ziehe aber vorläufig den «dritten Aspekt» der polaren Bewegung vor, da bei diesem Ausdruck der Blickwinkel, von dem aus wir die Polarität und ihre Dynamik betrachten, mitbestimmend ist. (Vergl. Anhang 3)
4 Karl König: Brüder und Schwestern – Geburtenfolge als Schicksal (2013), Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
III Die typischen Zeichen der einzelnen Geschwister
Wohlsein und Unwohlsein
Den Geschwisterrollen können keine Krankheiten zugeordnet werden. Die typischen Ausdrucksformen zeigen sich vor allem, wenn das Kind gesund ist und sich günstig entwickelt. Liegen dagegen chronische oder immer wiederkehrende Krankheiten vor oder wenn in einem Familiensystem Beziehungsprobleme vorliegen, können typische Ausdrucksformen verwischt und nicht mehr erkennbar sein. Zum Beispiel kann ein hyperaktives erstes Kind viele Zeichen zeigen, die wir sonst, in weniger extremer Form eher beim zweiten Kind erwarten würden, wie die Schwierigkeit, sich zu konzentrieren, die allgemeine Fieberhaftigkeit oder die Ruhelosigkeit im Schlaf. Spielt dieses Kind mit dem jüngeren Geschwister, zeigt es unkontrollierte, brüske Bewegungen, die wehtun können, weshalb das zweite Kind ängstlich und schüchtern werden kann, was seinerseits nicht zu den typischen Äusserungsformen eines zweiten Kindes gehört.
Üblicherweise werden Gesundheit und Krankheit als Gegensätze gesehen, doch handelt es sich hier nicht um eine echte Polarität (s. Anhang 3). Dagegen erleben wir in unserer Alltagsrealität echte, sich ergänzende Pole im stetigen Wechsel unserer Befindlichkeit. Wir fühlen uns manchmal wohl und zu anderen Zeiten unwohl, wir erleben angenehme und unangenehme Augenblicke, haben gute und schlechte Tage. Beide Zustände lösen sich ständig ab, bewegen sich in Zyklen verschiedener Länge, wechseln von einem Augenblick zum anderen oder können sich über Tage und Wochen oder über ganze Lebensabschnitte erstrecken. Zyklen verschiedener Länge können sich so gegenseitig überlagern.
Fall 15: Wohlsein und Unwohlsein
Nikolas ist 5-jährig und das dritte von drei Kindern. Er leidet seit zwei Jahren an wiederholten Halsentzündungen, die jedes Mal eine ärztliche Intervention erfordern. Anfangs kamen diese Halsentzündungen alle zwei bis drei Monate vor, seit einem Jahr auch häufiger. Durch diese ständige Wiederholung der Krankheit merken die Eltern schliesslich im Voraus, wenn das Kind krank wird, denn Nikolas zeigt regelmässig schon Tage oder Wochen vor dem Auftreten der Krankheit die gleichen Verhaltensformen. Diese treten in folgender zeitlicher Reihenfolge auf:
lutscht häufiger den Daumen
isst ohne Freude
wird langsam; wenn man ihm etwas sagt, braucht er lange, bis er reagiert
verteidigt sich nicht mehr, aber kommt zur Mutter petzen
redet wie ein Baby; will lustig sein, ist es aber nicht
stellt sich in den Schatten; wenn man keine Zeit für ihn hat, zieht er sich in sein Zimmer zurück und man vergisst ihn
müde, legt beim Spiel seinen Kopf ab
wird klettenhaft
überempfindlich auf kleine Bemerkungen; geht still in eine Ecke und weint
will nicht mehr selbst essen; man muss ihn füttern
Beim Auftreten der letzten zwei Zeichen bricht die Krankheit regelmässig innerhalb von einem oder zwei Tagen mit Fieber und Halsweh aus. Alle anderen Zeichen können auch ausserhalb vom Krankheitsgeschehen vorkommen, aber je nach den Umständen nur als isolierte Zeichen, oder mehrere Zeichen zusammen, die aber nur einen oder zwei Tage oder auch nur während Stunden bleiben. Alle diese Zeichen sind bei diesem Kind Teil seines Unwohlseins, welches im Alltag in ständigem Wechselspiel mit seinem Wohlsein abwechselt. Letzteres wird von der Mutter so beschrieben:
ein freudiges Kind, das singt und lacht
humorvoll
die Sonne in der Familie
seine Lebensfreude
will alles machen wie sein Bruder und seine Schwester
Wissensdurst
schmusig
das strahlende Kind, alle mögen es
aktiv, übernimmt Initiativen; ist schnell, hat grosse Ausdauer beim Laufen
beschäftigt sich gut alleine, zeichnet, grosse Vorstellungskraft
verteidigt sich
Die Krankheit ist in ihrer chronischen, sich wiederholenden Form nicht das eigentliche Problem. Das Kind lebt normalerweise in einem ständigen, gesunden Wechsel zwischen Wohlsein und Unwohlsein. Die Krankheit tritt auf, wenn die Zeichen des Unwohlseins vollständiger und aufdringlicher werden, und wenn sie verharren, das heisst, wenn sie nicht mehr mit den Zeichen des Wohlseins abwechseln. Das eigentliche Problem ist also, dass das Kind in einem der beiden Zustände des Befindens festgefahren ist. Die Heilung der Krankheit sollte darauf abzielen, den Organismus wieder in das Wechselspiel zwischen dem Wohlsein und dem Unwohlsein zu führen. Dann verlieren die Krankheitssymptome ihre Existenzgrundlage und verschwinden.
Die meisten üblichen Krankheiten stellen einen Versuch des Organismus’ dar, mit ausserordentlichen Ausdrucksformen, das heisst den Krankheitssymptomen, eine Änderung im festgefahrenen Alltag herbeizuführen. Diese Änderung bewirkt dann in den meisten Fällen, dass das Kind wieder in das Wechselspiel seines Befindens zurückfindet. Das Kind bleibt zu Hause, hat Fieber, schläft viel und hat für ein paar Tage seine Mutter ganz für sich, um dann wieder in seinen gewohnten Alltag zurückzufinden.
Wenn wir diese beiden Befindenszustände gedanklich trennen, erkennen wir im Wohlsein Freude, Lust, Offenheit und Neugier und wenn diese Qualitäten nicht vom Unwohlsein zurückgehalten würden, würde sich das Wohlsein in Erregung, Verzettelung, Ruhelosigkeit, in einen Dauerzustand von übertriebener Euphorie und schliesslich in Auflösung verlieren. Umgekehrt erleben wir im Unwohlsein, Rückzug, und Selbstbesinnung, welche schliesslich, ungebremst durch das Wohlsein, in Verschlossenheit, Verhärtung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Umfeld führen und sich in Schwäche, Schmerz, Verzweiflung und in Erstarrung verkrampfen. Es handelt sich also beim Wohlsein und beim Unwohlsein um eine echte Polarität, denn beide Zustände sind für sich alleine nicht mit dem Leben vereinbar. Solange Leben besteht, bemüht sich der Organismus ständig, diese beiden Befindenszustände in einem dynamischen rhythmischen Gleichgewicht, weitab von den Polen zusammenzuhalten. Es ist diese alltägliche Bewegung zwischen den Polen des Wohlseins und des Unwohlseins, die wir als Gesundheit erleben.
Man muss sich davor hüten, Wohlsein und Unwohlsein einfach als den guten und den schlechten Zustand aufzufassen. Beide sind notwendige Teile eines steten Wechsels. «Wohl» und «Unwohl» des Befindens weisen mehr auf unsere subjektive Empfindung gegenüber dem Wechsel hin. So kann es abends leicht in uns denken: «Schade, der Tag ist vergangen, die Nacht kommt …». Stellen wir uns aber vor, es gäbe keine Nacht mehr, würden wir sie bald sehnsüchtig herbeiwünschen.
Im obigen Fallbeispiel sehen wir, dass auch das Wohlsein des Kindes, ungebremst durch das Unwohlsein, in Überdrehtsein, berauschende Euphorie führen würde, wobei diese Zustände in ihrer Ungebremstheit ihrerseits Krankheiten herbeiführen können.
Meine berufliche Tätigkeit bringt es mit sich, dass ich ständig kranken Kindern begegne. Es ist aber immer auffallend, mit welcher Gleichförmigkeit mir die Eltern diese Vorzustände der Krankheiten beschreiben. Dabei ist es interessant, dass diese Beschreibungen überwiegend dem charakteristischen Unwohlsein oder Wohlsein der Geschwisterposition des Kindes entsprechen. Beim ersten Kind wird die Zeit zum Einschlafen lang und das Kind macht sich um unwichtige Dinge Sorgen. Es wird müde, schüchtern, wagt nichts mehr oder zeigt einen Hochmut gegenüber seinen Geschwistern. Beim zweiten Kind findet man eher Verhalten mit Wutanfällen, fixen Ideen oder das Gegenteil: Passivität und Langeweile. Das dritte Kind wird freudlos, stellt sich in den Schatten, isst wie im obigen Beispiel nicht mehr und muss gefüttert werden.
***
Eine Beschreibung der Geschwisterrollen muss also der Tatsache Rechnung tragen, dass sich alles Typische und Wesensartige einer Geschwisterrolle in dieser lebendigen Bewegtheit zwischen dem Wohlsein und Unwohlsein ausdrückt. Diese beiden beeinflussen die Ausdrucksformen in einschneidender Art und erst in dieser Dynamik erkennen wir die typischen Bilder der verschiedenen Geschwisterrollen.
Ich werde deshalb im Folgenden die typischen Ausdrucksformen paarweise darstellen, sowohl im Wohlsein als auch im Unwohlsein, wobei ich die Zeichen des Wohlseins am linken Seitenrand, dagegen diejenigen des Unwohlseins am rechten Seitenrand anbringe.
1 Wohlsein und Unwohlsein des ersten Kindes
Der Säugling, der die Aufmerksamkeit der Eltern sucht
Jeder Säugling sucht einen intensiven Kontakt zu seinen Eltern. Aber im Gegensatz zum nächsten Kind sucht der erste Säugling den ständigen Austausch mit den Eltern. Sobald die Mütter ihre Kinder vergleichen können, sagen sie, dass es der erste Säugling war, der sie am meisten in Anspruch nahm. Er will, dass die Eltern bei ihm bleiben, ihn anblicken, mit ihm reden und mit ihm spielen. Später will das erste Kind der Mutter beim Kochen zuschauen oder es will, dass die Mutter neben ihm sitzt, ihm zuschaut, es aufmuntert und es zeigt ihr immer wieder, was es gemacht hat: «Schau ».
Im Unwohlsein kann diese Beanspruchung bis zur Erschöpfung der Eltern gehen. Keine Minute können sie diesen Säugling allein lassen, ständig müssen sie bei ihm bleiben, mit ihm spielen oder ihn tragen.
Abends versteht das erste Kind nicht, warum es ohne die Eltern ins Bett gehen muss, und seine Wachheit stellt die Eltern vor Probleme. Sie klagen, dass sie stundenlange Rituale entwickeln müssen, damit das Kind endlich schlafe. So fängt die häufige Einschlafschwierigkeit des ersten Kindes nicht selten schon im Säuglingsalter an.
Auch das Gegenteil kann gelegentlich vorkommen: der Säugling, der ständig schläft. Dies kann bis zur Trinkschwäche gehen. Das Kind saugt schwach, schläft beim Trinken immer wieder ein und muss von der Mutter geweckt werden. Später, wenn dieses Kind gehen kann, will es bei Spaziergängen ständig getragen werden, oder man muss es hinter sich herziehen, und es fragt immer wieder, wann man heimgehe. Zu Hause legt es bei Tisch oder beim Spiel den Kopf ab, als wäre dieser zu schwer.
Das beobachtende Kind
Eine der grossen Fähigkeiten, die beim ersten Kind beschrieben wird, ist seine Beobachtungsgabe. Die Eltern drücken ihr Erstaunen darüber aus, welche Einzelheiten ihm im Gedächtnis bleiben. Es geht nicht, wie sein zweitgeborener Bruder, sofort auf ein Objekt oder auf ein anderes Kind zu, sondern nimmt zunächst alles um sich herum wahr.
Es beobachtet nicht nur Orte, mehr noch die Menschen, die sich hier bewegen. Es beobachtet, was sie tun, ihren Umgang untereinander, wie sie sich begegnen, und dabei fällt es durch seine Klarsicht auf, mit der es Unterschiede bei ihnen wahrgenommen hat. Es hört zu, kein Wort der elterlichen Unterhaltung entgeht ihm, auch wenn es im Spiel oder in ein Buch vertieft scheint.
Es ist ein kognitives, ein denkendes Kind. Es beobachtet, hört zu, vergleicht, es wägt ab, testet. Es kommt über eine denkende Wahrnehmung zu seinen Gefühlen.
Blick und Wort sind die Kommunikationsinstrumente, die das erstgeborene Kind in besonderem Masse entwickelt. Körperliche Berührung ist weniger wichtig. Es wird allgemein als weniger schmusig beschrieben als das zweite Kind, so kommt es nur für kurze Zeit auf den Schoss, und wenn es müde ist, lehnt es sich eher an, als dass es sich, wie das zweite Kind, anschmiegen würde oder es gibt einen kurzen Kuss und geht wieder.
Im Unwohlsein kann das erste Kind in seiner Fähigkeit des Beobachtens verharren. Das Beobachten führt es zum Wunsch, mit einem anderen Kind zu spielen, aber es kann sich nicht aufraffen, auf das andere Kind zuzugehen. Es wagt nicht, zur Handlung überzugehen, und wird dann als reserviert oder scheu beschrieben. Sehr oft ist diese Schüchternheit der eigentliche Grund, weshalb die Eltern ihr erstes Kind zur Behandlung bringen.
Das erste Kind ist allgemein schüchterner als das zweite, aber ausserdem unterscheiden die Eltern oft, dass es eher auf unbekannte Erwachsene, das zweite Kind dagegen eher auf unbekannte Kinder zugehe.
Auch wird oft gesagt, dass das erste Kind vor lauten, stürmischen Kindern Angst habe. Mit Erwachsenen hat das erste Kind die Erfahrung gemacht, dass sie sich an den menschlichen Verhaltenskodex halten. Mit Kindern, insbesondere ruhelosen Kindern, hat es die Erfahrung gemacht, dass sie unerwartete oder heftige Reaktionen zeigen können. Unerwartete Situationen mag es aber nicht und wagt nicht, sich solchen auszusetzen. So bleibt dieses Kind bei seiner Mutter oder alleine in einer Ecke und schaut zu den anderen Kindern, wagt aber nicht, mit ihnen zu spielen.
Die Beziehung zum Alter Ego und zur Gruppe
Das erste Kind sucht das menschliche Gegenüber, das Alter Ego, das Lebewesen, das wie es selbst beschaffen ist. Es beobachtet und vergleicht die einzelnen Menschen untereinander und vergleicht auch sich selbst mit den anderen.
Seine Stellung in der Gruppe ist dem ersten Kind besonders wichtig. Es möchte Teil der Gruppe sein. Es sucht die Rolle, die es gegenüber den Eltern einnehmen kann, später seine Position unter den Geschwistern und noch später seine Stellung in der Schulklasse gegenüber den Gleichaltrigen. Wenn es Freunde zu Besuch hat, umsorgt es diese und bemüht sich um ein Gleichgewicht zwischen seinen und den Wünschen der anderen. Die Sorge um seinen Platz unter den anderen ist ein immer wiederkehrendes Thema, das von erstgeborenen Erwachsenen oder von Eltern über ihr erstes Kind angeschnitten wird. Um diesen, seinen Platz zu finden, möchte es immer allen gerecht werden.
Mit dem Wunsch, alles möglichst gut zu machen, kann das erste Kind so hohe Anforderungen an sich selbst stellen, dass seine Gewissenhaftigkeit immer mehr in Pedanterie übergeht und das Kind schliesslich in sein Unwohlsein fällt. Wir erkennen nun das sorgenvolle Kind. Es macht sich Sorgen, dass es nichts gut genug macht und dass es das Erstrebte nie erreichen wird. So drücken die Mütter ihre Beunruhigung aus, wenn es seine Zeichnung verzweifelt und wütend zerreisst oder sich beklagt, dass es die Hausaufgaben nie schaffen werde. Oft kommt es vor, dass es morgens vor der Schule Bauch- oder Kopfweh hat.
Auch erwachsene Erstgeborene drücken regelmässig das Gefühl aus, nicht genug oder nichts gut genug zu tun. Sie beklagen sich auch, dass sie nicht «nein» sagen können oder dass sie, wenn sie eine Bitte zurückweisen, Schuldgefühle haben. Da sie oft allen helfen wollen, können sie sich viele Pflichten aufhalsen, bis sie sich überfordert fühlen und noch mehr befürchten, nicht genug zu tun.
Die Sorgenhaftigkeit führt auch zu den langen Einschlafzeiten, welche eines der am häufigsten beschriebenen Zeichen des ersten Kindes ist.
Schon im Wohlsein kann diese bis zu einer halben Stunde betragen und erwachsene Erstgeborene, denen es gut geht, beschreiben diese Zeit oft als angenehm, sie denken an das Heute und Morgen und schaffen gedanklich Ordnung in den Ereignissen. Das Kind wird sagen, dass es an eine lustige Bemerkung der Lehrerin denkt oder dass es sich fragt, was es wohl morgen bei einem Schulausflug alles zu sehen bekomme.
Im Unwohlsein kann sich die Einschlafzeit auf Stunden ausdehnen, aber viel charakteristischer für dieses Unwohlsein sind die Sorgengedanken, die es am Einschlafen hindern. Die Eltern sagen, dass es immer wieder zu ihnen komme, frage, ob sie auch wirklich nicht weggingen, ob die Katze nicht draussen vergessen wurde oder ob die Mutter morgen nicht vergesse, es von der Schule abzuholen, aber auch, dass es Geräusche gehört habe oder dass ein Wolf im Zimmer sei. Es macht sich wegen Nebensächlichkeiten Sorgen und die Sorgengedanken führen zu neuen Ängsten. Eine kleine Bemerkung wird bis in tiefe Gründe hinterfragt, eine noch so geringe Wahrscheinlichkeit wird schon als sicheres Unglück gesehen.
Das mutige Kind
In seinem Drang, es den Erwachsenen gleichzutun, nimmt das erste Kind gerne Herausforderungen an. Bei körperlichen Leistungen kann es seinen Wagemut zeigen, ohne waghalsig wie das zweite Kind zu sein. Auch wenn es ein Wagnis auf sich nimmt, wägt es vorher alle Gefahren gegeneinander ab und ist bei allem Mut vorausschauend. Wenn es zum ersten Mal auf einen Stuhl klettert wird es sich langsam emporarbeiten, indem es sich bei jeder Bewegung vergewissert, ob es noch genügend Halt hat. Wenn es schliesslich oben angekommen ist, sieht man ihm die Freude und den Stolz am Gelingen an.
Im Unwohlsein verliert es diesen Mut, die Angst vor möglichen Gefahren gewinnt gegenüber dem Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten die Oberhand und wir erkennen hier das ängstliche Kind. In diesem Zustand werden immer wieder alle Ängste des ersten Kindes beschrieben. Es hat Angst, alleine zum Schulbus zu gehen, Angst vor Fremden, in der Menschenmenge, vor ruhelosen Kindern oder allgemein vor Menschen, aber auch Angst vor Geistern, vor Sturm, Donner, Knall, oder Angst «vor allem und jedem».
Auch die Beziehung zu den anderen wird nun getragen von einem ängstlichen Misstrauen. Es antwortet nicht auf Fragen und wenn man es zu lange anblickt, weint es oder versteckt sich hinter der Mutter.
Das vaterorientierte Kind
Mit seiner Neugier für alles was die menschlichen Beziehungen und die menschlichen Möglichkeiten betrifft, interessiert sich das erste Kind besonders für den Vater.
Versetzen wir uns an die Stelle des ersten Kindes und stellen wir uns vor, wie es jeden Abend den Vater «von draussen» heimkommen sieht. Es stellt sich dann alle Menschen vor, denen der Vater tagsüber begegnete und mit denen er den Alltag teilte. Er wird so gleichsam Symbol für die interessante und geheimnisvolle soziale Aussenwelt, von der sich dieses Kind so angezogen fühlt und in die es seine Zukunft projiziert.
Die elterlichen Gesetze, die Regeln des Haushaltes
Das erste Kind wird als folgsam beschrieben.
Es kommt vor, dass es protestiert oder Regeln testet, indem es absichtlich Verbotenes macht und dabei die Eltern herausfordernd anschaut. Dies macht es, um die Gültigkeit der Regeln zu testen, und die Mütter erklären, dass es willig folgt, wenn man ihm die Notwendigkeit solcher Regeln erklärt. Oft hat man sogar den Eindruck, dass es die Erklärung noch gar nicht verstehen kann, aber es genügt ihm, zu spüren, dass es eine Erklärung für die Regel gibt. Dann assimiliert das erste Kind Regeln und Gesetze. Diese sind, wie alle menschlichen Konventionen, eine Hilfe im alltäglichen Zusammenleben. So benützt das erste Kind die Regeln auch und fordert von den anderen deren Einhaltung. Es erinnert den heimkommenden Vater daran, die Schuhe auszuziehen, oder macht die Mutter beim Autofahren darauf aufmerksam, dass die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt ist.
Im Drang, alles so wie die Eltern zu machen, nimmt das erste Kind Entwicklungsschritte vorweg. Es will alles wie die Grossen machen, und dies kann so weit gehen, dass ihm immer weniger kindliche Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Es ist dann in einem unentwirrbaren Netz der Vernunft gefangen; wir haben dann das altkluge Kind vor uns.
Integration und Autonomie
Von Anfang an ist für das erste Kind die Frage wichtig, welchen Platz es unter den anderen findet. Bis zum 5./6. Altersjahr sucht es seinen Platz in der Familie. Es hat die Tendenz, seine persönlichen Wünsche unterzuordnen. Erst ab dem 4./5. Altersjahr, mit der Entwicklung seines Egos, beginnt es, die Berechtigung persönlicher Bedürfnisse zu erkennen. Es erkennt nun das Individuum mit seinen Eigenheiten. Es versucht, ein Gleichgewicht zwischen seinem Autonomiebedürfnis und seiner Art, zu funktionieren, einerseits sowie seiner Integration in der Gesellschaft anderseits zu finden.
Dabei beobachtet es die anderen, es versucht, das Besondere eines jeden Menschen zu erkennen. Es ist auch darauf angewiesen, von den anderen in seiner menschlichen Eigenart akzeptiert zu werden. Es soll das Wesenhafte eines jeden erkannt und gleichzeitig das gemeinsame Menschliche anerkannt werden. Dies sehen wir, wenn die ersten zwei Kinder im Wohlsein zusammenspielen. Trotz ihren Verschiedenheiten können sie zusammen fröhlich sein, Interesse aneinander zeigen und eine freundschaftliche und komplizenhafte Gemeinsamkeit finden. Sie können dann stundenlang miteinender spielen und komplexe Gebilde erschaffen. Die Idee des einen erzeugt Ideen des andern. Diese gegenseitige Anerkennung als Mensch und das gleichzeitige Erkennen der Besonderheit eines jeden entwickelt sich beim ersten Kind zu einem wichtigen Ideal menschlichen Zusammenlebens.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.