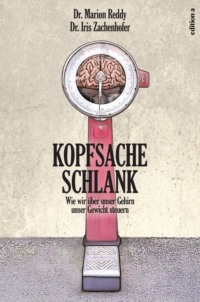Kitabı oku: «Kopfsache schlank», sayfa 2
Die Erleuchtung kommt von oben
Der Rest dieses grauen und nasskalten Herbsttages verlief zunächst unspektakulär. Nach meinem Termin beim Zahnarzt wollte ich die Wintersachen für meine jüngste Tochter heraussuchen, um mich mental darauf einzustimmen, dass der Sommer nun endgültig vorbei war.
Ich wohne in einer Altbauwohnung mit hohen Räumen. Im Kinderzimmer steht ein über drei Meter hoher Jugendstilschrank. In dessen oberen Fächern lagerten neben einigem anderen Kram, in einer Plastiktasche, die Sachen, die ich suchte.
Ich war zu faul, die Leiter zu holen und hochzuklettern. Deshalb streckte ich mich und fischte nach den Trageschlaufen der Tasche. Als ich sie endlich zu fassen bekam, zog ich daran, bis sich die Tasche bewegte. Sie kam mir entgegen, doch es rutschten noch ein paar andere Sachen mit, die anscheinend oben drauf gelegen waren. Etwas Schweres traf mich an der rechten Schläfe und polterte zu Boden. Es war ein Buch. Ich sprang zurück, während die Tasche mitsamt dem übrigen Kram vor meinen Füßen landete.
Verärgert versetzte ich dem Buch einen Tritt. Es flog nicht weit, denn es war dick und schwer. In der Mitte des Kinderzimmers blieb es aufgeschlagen liegen. Ich griff mir an die Schläfe und hatte keine Lust mehr, Winterkleidung zu sortieren. Zuerst die Sache im Bus und jetzt auch noch das. Es war einfach nicht mein Tag. Morgen ist dafür auch noch Zeit, dachte ich, und stopfte alles zurück in den Schrank.
Als ich auf dem Weg nach draußen schon das Licht abdrehen wollte, lag da noch immer das Buch. Es war ein Fachbuch aus meiner Anfangszeit an der Neurochirurgie. Ich bückte mich danach und sah das Kapitel, an dem es aufgeschlagen war. »Die Basalganglien«, so lautete es. Der Titel rief in mir Erinnerungen an alte Zeiten wach und so saß ich bald auf dem Boden neben einer Lego-Antarktis-Basisstation und blätterte darin.
Wie lange das alles her war! Es war so ähnlich, wie nach zehn Jahren Fotos einer alten Liebe wiederzufinden. Das Buch war ein Teil von vier Bänden über operative Neurochirurgie und ich hatte alle vier geliebt. Ich sah mir die Abbildungen der Basalganglien an, die mich schon als Studentin fasziniert hatten, weil sie längst nicht restlos erforscht waren und immer wieder neue Informationen darüber auftauchten. Ich hatte sie in der Neurochirurgie und in meiner Ausbildung zur Psychiaterin von jeweils unterschiedlichen Seiten kennengelernt. Die Basalganglien liegen unter der Großhirnrinde und sind vor allem für unsere Gewohnheiten und automatischen Bewegungen wichtig, etwa für das Gehen, das Radfahren oder das Klavierspielen.
Ich saß am Boden des Kinderzimmers, inmitten des Antarktis-Basislagers, mit dem drei Kilogramm schweren Neurochirurgie-Buch auf den Oberschenkeln und dachte über die Basalganglien nach. Eigentlich sind sie nicht nur für das Gehen, das Radfahren oder das Klavierspielen zuständig, überlegte ich, eigentlich sind alle unsere täglichen Verhaltensroutinen, über die wir nicht mehr nachdenken, während wir sie ausführen, in den Basalganglien gespeichert.
Mir fiel ein Satz ein, den ich als Psychiaterin schon oft gehört hatte.
Falsche Verhaltensmuster sind erlernt und können daher auch wieder verlernt werden. Neue Verhaltensmuster müssen geübt werden.
Ich dachte darüber nach, wie viele von meinen täglichen Routineabläufen ich wirklich bewusst wahrnahm, wenn ich aufstand, meine Hausschuhe anzog, ins Bad ging, die Zähne putzte, die Kinder weckte und so weiter.
Nicht nur diese Dinge liefen automatisch ab, sondern auch meine Gewohnheiten, etwa wie lange ich schlief, wie ich zur Arbeit fuhr, wann und wie oft ich mich bewegte und was, wann und wie viel ich aß. Diese Tatsache, die mir seit langem vertraut war und die für mich seit jeher selbstverständlich gewesen war, erschien mir jetzt neu und überraschend:
Meine Art, mich zu ernähren, besteht aus Verhaltensmustern, die ich irgendwann erlernt habe und die in meinen Basalganglien abgespeichert sind.
Ich hatte das Gefühl, eine richtig große Entdeckung machen, als ich den Satz aus meiner Weiterbildung diesem gegenüber stellte:
Falsche Verhaltensmuster sind erlernt und können daher auch wieder verlernt werden. Neue Verhaltensmuster müssen geübt werden.
Auf einmal schien alles ganz simpel!
Der Alltag holte mich ein und unterbrach meinen Gedankenfluss. Meine beiden kleinsten Kinder warteten mit der Zahnbürste in der Hand auf meine Hilfe. Doch ich konnte das Buch nicht einfach so wieder zur Seite legen. Ich markierte das Kapitel über die Basalganglien mit einer am Boden liegenden Uno-Karte und legte es ins Wohnzimmer. »Operative Neurochirurgie, Band 3«, wie lange war das her! Und trotzdem schöpfte ich neue Hoffnung daraus.
Das Gehirn hat vier Systeme, die uns beim Abnehmen helfen können. Die Basalganglien, den Hypothalamus, das Belohnungssystem und den präfrontalen Cortex. Wir müssen nur die Basalganglien neu programmieren, den Hypothalamus austricksen, das Belohnungssystem umpolen und den präfrontalen Cortex aktivieren. Klingt kompliziert, ich weiß, aber es ist ganz einfach! Auf jeden Fall ist es einfacher als Hungern.
1. Die Basalganglien umprogrammieren
Abnehmen ist wie Klavierspielen
Das darauffolgende verlängerte Wochenende war ein besonderes für mich. Gregor war schon am Freitag zu einem Seminar gefahren und die Kinder waren bei meinen Eltern. Ich verbrachte gerne Wochenenden mit meiner Familie, aber ich fand, dass ich mir ein bisschen Zeit für mich allein verdient hatte. Entspannen, das hieß diesmal nicht, für die ganze Bande Essen zu kochen und die Wäsche der vergangenen Woche zu waschen. Diesmal hieß es Schokolade und drei Zeitschriften zum Frühstück. Milchkaffee mit meiner besten Freundin und den ganzen Nachmittag mit meinen Lieblingsserien am Sofa verbringen. Den Kopf komplett abschalten, Füße hochlagern, Mikrowellenpopcorn und natürlich Baguette mit Nutella. Herrlich würde das werden, zumindest hatte ich mir das ein paar Tage zuvor noch so vorgestellt.
Doch alles kam anders an diesem Samstag. Es fing damit an, dass ich bereits um sechs Uhr morgens von selbst aufwachte, was gar nicht zu mir passte. Freiwillig bereits um sechs Uhr morgens wach war ich höchstens bei Nachtdiensten (und das war genau genommen auch nicht freiwillig) oder wenn ich mit ein paar Freundinnen unterwegs war und nicht bereits, sondern noch immer wach war. Doch an diesem Samstagmorgen lag ich im Bett und schaute auf mein Handy, das »06:03« anzeigte. Ich war hellwach, keine Spur von Müdigkeit.
Eine Weile sah ich vom Bett aus dem Morgen beim Dämmern zu. Dann schlurfte ich in die Küche. Da stand ich nun in meinem alten T-Shirt und hatte keine Ahnung, was ich mit diesem Morgen anfangen sollte. Auf eine Riesenladung Milchkaffee mit Schokokeksen hatte ich nach dem Vorfall im Bus keine richtige Lust. Ich stellte den italienischen Espressokocher auf die Herdplatte und trank den Kaffee im Stehen.
Ich überlegte, ein Vollbad zu nehmen. Ich liebe Vollbäder. Ich verfüge über eine Sammlung von Badeölen und meine Zeitschriften sind vom Badewasser immer am unteren Ende ausgefranst. Mein Traum war immer ein Zeitschriftenhalter für die Badewanne, aber so etwas habe ich nie gefunden.
Seit Monaten hatte ich kein Vollbad mehr genommen, schon weil ich meinen Körper nicht mehr ansehen wollte und deshalb lieber rasch duschte. Jetzt ließ ich das Wasser in die Wanne laufen und gab Badeöl dazu. Dampf stieg auf und vermischte sich mit dem Duft des Öls. Wie früher bereitete ich mir eine Tasse Tee zu und stieg damit in die Wanne, noch während das Wasser lief.
Als ich meinen Körper jetzt von oben bis unten betrachtete, wurde ich traurig. Wie hatte ich mir das nur antun können? Warum war es soweit gekommen und wie hatte ich auf die Idee kommen können, dass irgendwelche Fitnesstrainer oder selbst ernannte Diät-Gurus mir helfen konnten? Menschen, die vielleicht einmal ein paar Kilos abgenommen hatten und nun dachten, die Welt belehren zu müssen? Wie hatte ich Tipps von Menschen befolgen können, die mich gar nicht kannten, die mich noch nie gesehen hatten und die trotzdem zu wissen behaupteten, wie ich mit meinem Körper umgehen sollte?
Es heißt, dass Buddha bei der Meditation unter einem Baum die Erleuchtung zuteil wurde. Meine Erleuchtung fand, von der Badewanne aus betrachtet, in drei Schritten statt. Den ersten Schritt markierte die freche Äußerung des Typen im Bus, den zweiten das leichte Schädelhirntrauma beim Aufprall eines neurochirurgischen Fachbuches auf meiner Schläfe. Der dritte Schritt fand gerade im heißen Ölbad statt. Denn jetzt wurde mir klar, welcher Spezialist mich wieder auf den richtigen Weg bringen konnte: Ich selbst.
Mir wurde klar, dass ich als Neurochirurgin und Psychiaterin über das Wissen verfügte, mit dem ich den Kern des Problems angehen konnte, statt mit Diäten immer nur seine Symptome zu bekämpfen. Das Wissen über die Funktionsweisen des Gehirns, das Wissen also über jenes meiner Organe, das auf die eine oder andere Weise für alle meine Handlungen und deren Konsequenzen verantwortlich war.
Im ersten Moment kam mir das ganz einfach vor. Ich musste bloß auf Basis dieses Wissens und meiner Erfahrungen eine fundierte Anleitung für mich selbst entwickeln, eine Anleitung, die meine Kilos verschwinden lassen würde und die auf den beiden Erkenntnissen beruhte, die mich schon seit einigen Tagen im Hinterkopf beschäftigten.
Meine Art, mich zu ernähren, besteht aus Verhaltensmustern, die ich irgendwann erlernt habe und die in meinen Basalganglien gespeichert sind.
Falsche Verhaltensmuster sind erlernt und können daher auch wieder verlernt werden. Neue Verhaltensmuster müssen geübt werden.
Ich fragte mich, warum ich noch nicht früher auf die Idee gekommen war, meinen eigenen Abnehmplan zu entwickeln. Es lag wohl daran, dass wir Ärzte manchmal eigenartig sind, wenn es um uns selbst geht. Chirurgen, die täglich zwei Patienten mit Lungenkrebs operieren, rauchen mehrere Packungen Zigaretten am Tag. Es gibt Ernährungsmediziner mit massivem Übergewicht. Ein Kollege hatte vor ein paar Tagen seinen Nachtdienst gemacht, obwohl er eine schwere Grippe hatte. Wir kümmern uns oft voller Engagement um unsere Patienten und machen uns über uns selbst keine Gedanken. Unser Wissen in unseren eigenen Dienst zu stellen, scheint uns schwer zu fallen. Ich machte mir als Hirnspezialistin jeden Tag Gedanken über meine Patienten, hatte mich aber mit meinen eigenen Gehirnfunktionen, die verantwortlich für meine Ernährung und damit immerhin für mein derzeit größtes Problem waren, noch nie auseinandergesetzt. Jetzt, da ich es endlich tat, war mir sofort klar, wie es laufen musste.
Da mein erlerntes Verhaltensmuster in meinen Basalganglien gespeichert war, musste es mir gelingen, sie zu knacken und ein neues Verhalten einzuspeichern.
Das musste der Anfang sein. Danach würde ich nach und nach und mit neuen Augen all meine Gehirnbereiche betrachten, die für meine Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielten. Wer sollte dafür besser geeignet sein, als ich selbst?
Ich cremte mir die Füße ein, holte mein neues Lieblingsbuch, »Operative Neurochirurgie, Band 3«, und ging damit ins Wohnzimmer. Ich hatte vor ein paar Monaten im Internet ein Sofa mit Ohren wie bei einem großen alten Ohrensessel gekauft. Es war geradezu perfekt dazu geeignet, um darin lesend einen Vormittag zu verbringen. Ich schlug das Buch auf der Seite mit der Uno-Karte auf und sah mir noch einmal die Abbildung der Basalganglien an.
Selbst nach vielen Jahren der Beschäftigung hatte das Gehirn nie aufgehört, mich zu faszinieren. Wenn wir zum Beispiel nach einem Glas greifen, sind in unserem Gehirn mehrere Systeme gleichzeitig aktiv. Zunächst steuert der sogenannte Gyrus praecentralis die Bewegung. Das ist die für die Motorik zuständige Hirnrinde. Alle Muskelgruppen sind in dieser Hirnrinde unterschiedlich stark vertreten. Gesicht und Hände etwa sind stärker vertreten als Füße, weil sie feinere und präzisere Bewegungen ausführen müssen, an denen mehr Muskeln beteiligt sind. Das Gehirn überträgt die gewünschte Bewegung dann über mehrere Ebenen in die motorischen Zellen des Rückenmarks, von wo aus sie zu den Muskelgruppen gelangen, die sie ausführen.
So weit, so gut. Bloß können wir uns nicht jede kleine Bewegung ständig neu überlegen. Vielmehr erlernen wir Schritt für Schritt teils komplexe Bewegungsmuster, die dann automatisch ablaufen. Gehen, Radfahren und Klavierspielen zum Beispiel. Indem wir diese Bewegungsmuster erlernen, speichern wir sie im Gehirn in den Basalganglien ab, die sie dann ohne unser weiteres Zutun in unsrem Sinne ausführen. Wir wären ja völlig überfordert, müssten wir jede Bewegung beim Gehen oder Radfahren ständig neu durchdenken. Besonders schlimm wäre das bei einer Eiskunstläuferin. Müsste sie sich bei einem dreifachen Rittberger in jedem Moment genau überlegen, was sie da gerade tut, würde sie stürzen. Deshalb betreiben wir sozusagen Outsourcing mit diesen Bewegungsmustern. Aus ökonomischen Gründen verlagern wir sie, vor allem in unsere Basalganglien.
Wie wir das machen, kann jeder beobachten, der einem Kind zusieht, das zum Beispiel Radfahren lernt. Am Anfang ist es vollkommen konzentriert auf jede einzelne Bewegung. Es achtet darauf, den Lenker gerade zu halten, regelmäßig in die Pedale zu treten und nicht zu schnell oder zu langsam zu fahren. Wenn es etwas ablenkt, etwa eine Katze, die vor das wackelige Rad zu laufen droht, stört das die Konzentration des Kindes und es stürzt. Wenn es gestürzt ist, steigt es wieder auf und probiert es aufs Neue, auch wenn seine Knie zerkratzt und seine Ellbogen aufgeschürft sind. Es steigt immer wieder auf und übt weiter. Je mehr es übt, je weiter es fährt, umso sicherer wird es. Ab dem Moment, in dem es nicht mehr über das Radfahren nachdenken muss, sind die dafür nötigen Bewegungsabläufe in seinen Basalganglien abgespeichert.
Wie sehr die Basalganglien unser Verhalten sozusagen an uns vorbei steuern, erleben wir regelmäßig in Alltagssituationen. Wir wollen den Müll rausbringen und wissen, sobald wir beim Auto ankommen, nicht mehr, ob wir es getan haben oder nicht. Oder wir wissen, nachdem wir das Haus verlassen, nicht mehr, ob wir die Heizung ausgeschalten haben oder nicht. Solche Tätigkeiten sind so sehr über unsere Basalganglien automatisiert, dass sie unser Bewusstsein kaum noch beanspruchen und spurlos daran vorbei ablaufen können.
Ich blätterte weiter in dem Buch. An einer Stelle war von einem Versuch mit Bildern aus der funktionellen Magnetresonanztomographie (kurz: fMRT) die Rede. Bei der fMRT liegen Patienten in einer Röhre und führen bestimmte Tätigkeiten aus. Gibt es in einer Gehirnregion keine oder wenig Aktivität, bleibt die jeweilige Region grau. Gibt es viel Aktivität, leuchtet sie in vielen bunten Farben und die Ärzte können von den Farben Rückschlüsse auf die Art der Aktivitäten ziehen.
Ich hatte diese Technik oft zur Planung von Operationen genutzt. Besonders bei Patienten mit Tumoren im Bereich der motorischen Gehirnrinde war nie etwas so, wie es im Lehrbuch stand. Der Tumor verschob meist die Gehirnstrukturen. Damit ich wusste, wo ich besonders vorsichtig sein musste, um keine bleibenden Schäden zu verursachen, machten wir vor der Operation solche Bilder. Sonst hätte es passieren können, dass ich einen Tumor komplett entfernte, der Patient aber eine Hand nicht mehr heben oder nicht mehr gehen konnte.
Bei der Studie in dem Buch, die mit Hilfe der fMRT entstanden war, ging es um das Lernen. Die Versuchspersonen lagen in der Röhre und erlernten dort motorische Aufgaben. Zu Beginn waren viele Gehirnregionen aktiv: der präfrontale Cortex, über den wir Handlungen planen, der motorische Cortex, über den wir willkürliche Bewegungen steuern, das Kleinhirn, das für Koordination, Feinabstimmung, unbewusste Planung und das Erlernen von Bewegungsabläufen zuständig ist, und die Basalganglien. Je besser die Versuchsteilnehmer die betreffende Tätigkeit erlernten, umso weniger Gehirnregionen waren aktiv. Die Basalganglien übernahmen die Tätigkeiten nach und nach.
Wegen dieser Arbeitsteilung des Gehirns nehmen wir automatische Tätigkeiten auch gar nicht mehr bewusst wahr. Wir fahren mit dem Auto und merken gar nicht mehr, was wir dabei tun. Es erfordert unser bewusstes Denken nicht mehr. Den Beginn so einer Tätigkeit planen wir zwar noch, indem wir beschließen, etwas zu tun und damit anfangen. Doch sobald das erlernte Bewegungsmunter läuft, schaltet das Gehirn auf Automatik, also auf die Basalganglien um.
Ich mag das Video zu Robbie Williams’ Lied »She’s the One«, das mit der Eiskunstläuferin. Es macht die Funktion der Basalganglien deutlich. Die Bewegungen der Eiskunstläuferin sind so fließend, das würde sie willkürlich nie hinkriegen. Das funktioniert dank der Koordination durch die Basalganglien und es zeigt, dass hartes Training sich nicht nur auf die Muskulatur auswirkt, sondern auch auf das Gehirn.
Ich hatte Hunger bekommen und ging in die Küche. Ich stellte mir einen Kaffee auf, wärmte etwas Milch und schäumte sie mit dem Cappuccino-Schäumer. Ich bestrich zwei Stücke Baguette mit Nutella und trug alles ins Esszimmer, wo meine Zeitschriften lagen. Beim Lesen aß ich Baguette und trank meinen Cappuccino. Bevor ich mit dem Artikel »Luxus, Spaß und Fantasie« in der Vogue durch war, hatte ich beide Stücke Nutella-Baguette aufgegessen und meine Kaffeetasse war leer. Ich hatte mir sogar eine zweite Tasse eingeschenkt und es nicht einmal bemerkt. Cappuccino und Baguette mit Nutella zu einer Zeitschrift, das war bei mir offenbar in den Basalganglien abgespeichert und lief auf Autopilot ab.
Ich betrachtete die Krümel am Tisch und die leere Tasse. Basalganglien haben einen offensichtlichen Nachteil, dachte ich. Sie speichern nicht nur so wichtige oder schöne Tätigkeiten wie Gehen, Radfahren, Klavierspielen oder Eislaufen ab, sondern auch niedere und üble, die wir durch häufiges Wiederholen erlernen. So wie Zeitschriften, Nutella-Baguettes und Kaffee oder Fernsehen, Chips und Bier oder Arbeit, Stress und Schokolade. Das eine hängt automatisch mit dem anderen zusammen.
Was, wann, wo und wie wir essen, haben wir durch häufiges Wiederholen über einen längeren Zeitraum erlernt und wie Gehen, Radfahren oder Klavierspielen über unsere Basalganglien automatisiert. Dann einfach zu sagen: Das ändere ich jetzt, ich halte mich ab sofort an diese oder jene Diät, funktioniert einfach nicht. Es kann nicht funktionieren, denn die Basalganglien haben etwas dagegen. Die Diät-Gurus wissen das entweder nicht oder sie sagen es nicht, um nicht die Illusion ihrer Diäten zu zerstören. Denn in Kenntnis dieser im Gehirn ablaufenden Mechanismen ist jeder, dessen Diät mit dem Satz »Ab heute esse ich nur noch …« beginnt, ein Quacksalber, der uns nur Geld kostet, in die nächste Enttäuschungen laufen lässt, dabei Stress macht und damit unseren Cortisolspiegel hebt.
Wären die Basalganglien so einfach willkürlich auszuhebeln, hätten sie auch gar keinen Sinn. Ihr Vorteil besteht ja gerade darin, dass sie uns das Denken und Entscheiden im Sinne ihrer Programmierung abnehmen. Doch genau darin liegt auch ihr Nachteil. Haben wir sie einmal falsch programmiert, lässt sich das nicht auf Zuruf ändern.
Ich war inzwischen auf mein gemütliches Ohrensofa zurückgekehrt und dachte daran, wie ich mich für meine gescheiterten Diäten zu motivieren versucht hatte. Einmal hatte ich mir einen Bikini der Größe 36 gekauft und dazu ebenfalls viel zu kleine hellblaue Levi’s Superskinny Jeans, die von da an ungetragen meinen Schrank schmückten.
Ich hätte besser schon damals akzeptiert, dass meine Art des Essens, von den Nutella-Baguettes über die Schokolade aus der Notfall-Abteilung bis zum Hotdog am Heimweg, einen Sinn erfüllte. Ich hatte diese Dinge nicht häufig wiederholt und damit in meinen Basalganglien abgespeichert, weil ich dumm war, sondern weil ich mich dadurch kurzfristig besser fühlte. Das war der Grund, weshalb ich mir Cappuccino nachschenkte, ohne es zu merken, und warum mir manchmal erst zu Hause richtig bewusst wurde, dass ich unterwegs schon wieder einen Hotdog gegessen hatte.
In der Lerntheorie, genauer der behavioristischen Lerntheorie, die aus Modellen und Hypothesen besteht, die Lernvorgänge psychologisch beschreiben sollen, gibt es den Begriff der »operanten Konditionierung«. Er bezeichnet den natürlichen Vorgang einer Reaktion auf bestimmte Reize. Verhalten, das unmittelbar angenehme Folgen für uns hat, zeigen wir demnach öfter, was in der Lerntheorie »Verhaltensverstärkung« heißt. Ich fühle mich entspannt durch Süßigkeiten und den Hotdog und werde beides daher wieder essen. So lange, bis dieses Verhalten in meinen Basalganglien gespeichert ist. Ich übe es also unabsichtlich ein.
Inzwischen dröhnte mir der Schädel. Ich musste raus aus der Wohnung, ein bisschen bummeln und nachdenken. Ich hatte zwar keine große Lust, mich aus meinem Couch-Potato-Outfit zu schälen und stadttauglich zu machen, aber ich überwand mich, nahm den Parka und die Tasche und ging zur U-Bahn.
Ich war lange nicht mehr durch die Innenstadt spaziert. Früher waren Gregor und ich dort oft frühstücken gewesen, nach meinen Nachtdiensten, aber auch am Wochenende mit den Kindern. Ich liebte die Schaufenster der großen Designer- und Schmuckgeschäfte. Es macht mich glücklich, die glamouröse Mode zu betrachten. Genau das brauchte ich heute.
Ich bewunderte die Tücher bei Hermès, die Ohrringe bei Cartier, und schlenderte dann vorbei an Gucci und Dolce und Gabbana zum Michaelertor. Dort verkaufte die Spanische Hofreitschule Eintrittskarten für die Vorführungen der Lipizzaner. Auf einem Monitor lief ein Video von den Vorführungen und vom Training dieser wunderschönen weißen Pferde.
Ich blieb neben einer französischen Touristengruppe stehen und sah mir das Video an. Es war bewundernswert, wie trainiert diese Tiere waren, wie kontrolliert, wie exakt, wie synchron ihre Bewegungen abliefen und wie perfekt sie die Sprünge machten. Ich sah runter auf meine Oberschenkel und dachte, dass mir ein bisschen von der Disziplin der Lipizzaner ganz gut täte.
Die Lipizzaner hatten den Vorteil, dass sie mit einer Karotte zu locken waren, was bei mir eher mit einem Nutella-Baguette oder einem Schoko-Croissant, einem Wiener Schnitzel, einer Vier-Käse-Pizza oder einem fetten Schweinebraten ging. Vorlieben, auf die ich mich durch einen weiteren einfachen bio- und neurochemischen Zusammenhang operant konditioniert hatte: Süßes und fettes Essen führen zur Ausschüttung des Glückshormons Dopamin im Körper. Dopamin senkt den Cortisolspiegel und wir fühlen uns leicht betäubt und glücklich. Das hatte bei mir die Verhaltensverstärkung ausgelöst und das Verhalten schließlich als fixes Programm in meinen Basalganglien abgespeichert.
Ich hatte mich diesem Programm viel zu lange überlassen, wodurch meine Ernährung viel zu lange ein ungezähmter, von Impulsen gelenkter Mustang gewesen war, der wild durch die Gegend sprang und keine Regeln kannte. Ich musste ihn wieder einfangen. Ein Lipizzaner würde nie daraus werden, aber jedes Wildpferd lässt sich soweit zähmen, dass es zumindest an der Leine geht.
Ich ging durch die Hofburg und an den großen Museen vorbei nach Hause und dachte darüber nach, was es aus neurofunktioneller Sicht eigentlich bedeutete, den wilden Mustang zu zähmen. Die Antwort lag auf der Hand. Es bedeutete, meine eigenen für das rationale Handeln zuständigen Hirnareale zu benutzen und mit ihrer Hilfe meine Basalganglien neu zu programmieren. Ich hatte sie in Bezug auf meine Ernährung schon seit Längerem heruntergefahren, sie liefen sozusagen im Stand-by-Modus.
Während ich darüber nachdachte, wie ich die Entscheidungen über meine Ernährung wieder stärker über diese Hirnareale treffen konnte, sah ich ein neues Papiergeschäft auf der anderen Straßenseite. Eines, das handgeschöpftes Geschenkpapier mit gepressten Rosenblättern führte, elegante Füllfedern und Terminkalender mit Ledereinbänden in hübschen Farben. Ich betrat den Laden, in dem mir alles Mögliche gefallen hätte, doch bei all meinen Grübeleien über die für das rationale Handeln zuständigen Hirnareale zog es mich in die Abteilung mit den Terminkalendern und Notizbüchern.
Sie wieder besser ins Spiel zu bringen hieß, meine Vernunft zu aktivieren, übergeordnete Zusammenhänge und Prinzipien zu verstehen, Entscheidungen zu treffen, Selbstkontrolle zu üben, die Auswirkungen meines Handelns zu erfassen, relevante Informationen zu filtern, mein Denken und meine Motive zu reflektieren, meinen Verstand und mein Wissen zu benützen, globale moralische Überlegungen anzustellen … Hilfe! Ich fühlte mich überfordert, aber in einem Punkt war ich mir sicher: Ein hübscher Kalender würde mir auf jeden Fall dabei helfen.
Die Hirnforschung hat längst belegt, dass es wichtig ist, Ziele schriftlich festzuhalten. Wenn wir etwas sorgfältig mit dem Stift auf ein Blatt Papier schreiben, halten wir es eher ein, als wenn wir es uns einfach so merken oder rasch in einen elektronischen Kalender tippen.
Mein Blick fiel auf einen Terminkalender, der aus einem Umschlag aus dickem, weichem Leder und einzelnen Kalenderseiten bestand. Den Umschlag gab es in verschiedenen Farben und am Ende des Jahres würde ich den Umschlag behalten und neue Seiten kaufen können. »Das Leder fühlt sich umso besser an, je älter es wird«, sagte der Verkäufer, der mein Interesse bemerkt hatte, »es bekommt Patina.« Ich kaufte den Kalender in blutrot.
Ich plante einen Neustart und ein simples Notizbuch hätte dafür vielleicht auch gereicht, aber ich stand nun einmal auf solche Terminkalender. Ich war eine der Letzten unter den Ärzten in unserer Abteilung, die sich beim Erstellen der Dienstpläne die Nachtdienste in einen Kalender mit Seiten aus Papier eintrug. Mein Bruder schenkte mir jedes Jahr Werbekalender, die ich mit bedruckten Papieren oder Stoffen tapezierte und die fast wie Tagebücher für mich waren. Meistens schleppte ich auch ein Federpenal mit Buntstiften mit mir herum.
Ich hätte auch meinen normalen Terminkalender für meinen Neustart in Sachen Ernährung verwenden können, aber darauf hatte ich keine Lust. Ich hatte das Gefühl, dass es eine große Sache war, die ich da anging. Schließlich wollte ich nicht wieder nur so eine neue Vierzehn-Tages-Diät entwickeln. Ich wollte vielmehr mit geeigneten, für mich maßgeschneiderten Maßnahmen wieder die Kontrolle über meine Ernährung übernehmen, und zwar langfristig. Ich war dabei, mich unabhängig von den falschen Illusionen zu machen, die Ernährungsgurus schufen, und damit mein Leben gründlich zu verbessern. Und da hatte ich keine Lust, die dafür nötigen schriftlichen Vermerke zwischen Kinderarzt-, Schularbeitsund Nachtdiensttermine zu schreiben, knapp über oder unter die Seminartermine meines Mannes.
Zu Hause machte ich mir einen großen Cappuccino und setzte mich mit meinem neuen Kalender an den Küchentisch. Es war auch dieses Mal ein Cappuccino der Größe für ein Milchkalb, mit ein bisschen Kaffee und besonders viel Milch. Aber das war mir jetzt egal. Ich wollte nichts überstürzen. Ich wollte zuerst einen guten Plan haben, ehe ich meine Ernährungsgewohnheiten änderte. Bloß keine neuen Frustrationserlebnisse erzeugen nach dem Muster: ein Schokokeks? Durchgefallen! Nicht wieder dieses Gefühl entwickeln, versagt zu haben.
Dabei ist dieses »Versagen« gemäß der Bauart unseres Gehirns in Wirklichkeit sogar etwas Gutes. Denn die Programmierung unserer Basalganglien erfolgt nach dem einfachen und auf seine Art zutiefst menschlichen Prinzip »Versuch und Fehler«. Wir probieren etwas, machen einen Fehler, probieren es wieder, machen wieder einen Fehler und so weiter, bis wir es können. So funktioniert das Leben.
Ich schlürfte meinen Cappuccino und dachte daran, wie meine Tochter vergangenes Jahr für die Weihnachtsaufhrung der Musikschule geübt hatte. Es hatte mich schon immer fasziniert, die Kinder beim Einüben eines neuen Musikstücks zu beobachten. Meine Tochter übte damals Bachs »Präludium und Fuge Nr. 1 in C-Dur«.
Ich erlebte mit, wie sie sich langsam von einer Note zur nächsten vorarbeitete und wie sie dabei immer wieder ins Notenheft schaute. Immer wieder machte sie die gleichen Fehler, immer wieder folgten Unterbrechung und Neustart. Ein paar Töne, dann wieder der gleiche Fehler, Neustart. Irgendwann konnte sie die Stelle und spielte weiter bis zur nächsten Hürde. Wieder ein Fehler und Neustart. Schließlich spielte sie das Lied am Publikumsabend in der Musikschule vor. Ich erinnere mich noch an jedes Detail. Es war Mitte Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, ein nebeliger, nicht allzu kühler Abend. Sie spielte das Lied mit einer Emotion vor, die ich nicht in Worte fassen kann. Das war kein monotones Vorspielen eines Musikstücks mehr. Ich war so gerührt von der Schönheit dieses Stücks, dass ich mit den Tränen kämpfte. Da war keine willkürliche Bewegung mehr in ihren Händen, so wie sie jetzt über die Tasten flogen. Diese Bewegungen liefen automatisch ab. Die für rationales Handeln zuständigen Areale ihres Gehirns waren jetzt auch nur Zuhörer und überließen alles ganz den Basalganglien.
Auf genau die gleiche Art wollte ich meine neue Ernährungsweise einüben. Kein Mensch wundert sich darüber, dass ein kleines Kind nicht von selbst ein Stück spielen kann. Es probiert eben, macht einen Fehler und probiert es noch einmal. Das ist normal. Es fängt immer wieder von vorne an, probiert weiter. Es gibt nicht sofort auf, bloß weil es ein paar Fehler gemacht hat. Es überlegt sich auch nicht, das Instrument zu wechseln. Genau das tun aber wir bei unseren Diäten. Wir machen Fehler, sind frustriert, ziehen uns mit einer Tafel Schokolade zurück, geben auf und suchen uns kurze Zeit später eine neue Diät.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.