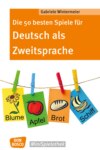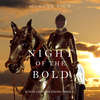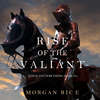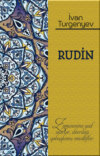Kitabı oku: «Aufzeichnungen eines Jägers», sayfa 22
Tschertopchanow und Nedopjuskin
An einem heißen Sommertag kehrte ich einmal in einem einfachen Bauernwagen von der Jagd heim; Jermolai duselte neben mir sitzend und nickte fortwährend mit dem Kopf. Die schlafenden Hunde wurden unter unseren Füßen wie Leichen herumgerüttelt. Der Kutscher verscheuchte fortwährend mit seiner Peitsche die Bremsen von den Pferden. Der weiße Staub folgte als leichte Wolke dem Wagen. Wir kamen in ein Gebüsch. Der Weg wurde holpriger, die Räder fingen an, die Äste zu streifen. Jermolai fuhr auf und sah sich um . . . »Eh!« sagte er, »hier muß es ja Birkhühner geben. Wollen wir absteigen.« Wir hielten und traten ins Gebüsch. Mein Hund stieß auf eine Birkhuhnbrut. Ich schoß und wollte schon das Gewehr von neuem laden, als plötzlich hinter mir ein lautes Krachen ertönte und sich mir, die Büsche mit den Händen auseinanderschiebend, ein Reiter näherte. »Erlauben Sie die Frage«, begann er in hochmütigem Ton, »mit welchem Recht Sie hier jagen, verehrter Herr?« Der Unbekannte sprach ungewöhnlich rasch, abgerissen und durch die Nase. Ich sah ihm ins Gesicht: Mein Lebtag hatte ich nie etwas Ähnliches gesehen. Liebe Leser, stellen Sie sich einen kleinen blonden Menschen vor mit einem roten Stutznäschen und ungewöhnlich langem rotem Schnurrbart. Eine spitze, persische Mütze, mit himbeerfarbenem Tuch besetzt, bedeckte ihm die Stirn bis zu den Augenbrauen. Er trug einen gelben, abgetragenen Tscherkessenrock mit schwarzen plüschenen Patronenhülsen auf der Brust und verschossenen silbernen Tressen an allen Nähten; über die Schulter hing ihm ein Horn, im Gürtel steckte ein Dolch. Der magere Rotfuchs mit gebogener Nase taumelte unter ihm wie betrunken; zwei magere Windhunde mit krummen Beinen sprangen zwischen seinen Hufen. Das Gesicht, der Blick, die Stimme, jede Bewegung und das ganze Wesen des Unbekannten atmeten eine wahnwitzige Kühnheit und einen maßlosen, unerhörten Hochmut; seine blaßblauen, gläsernen Augen schweiften umher und schielten wie bei einem Betrunkenen; er warf den Kopf in den Nacken, blähte die Backen, schnaubte und zuckte mit dem ganzen Körper gleichsam im Überfluß seiner Würde – genau wie ein Truthahn. Er wiederholte seine Frage.
»Ich wußte nicht, daß das Schießen hier verboten ist«, antwortete ich.
»Verehrter Herr«, fuhr er fort, »Sie sind hier auf meinem Grund und Boden.«
»Wenn Sie wollen, entferne ich mich.«
»Gestatten Sie die Frage«, entgegnete er, »habe ich die Ehre, mit einem Edelmann zu sprechen?«
Ich nannte meinen Namen.
»In diesem Falle wollen Sie nur weiterjagen. Ich bin selbst Edelmann und freue mich, einem Edelmann dienen zu können . . . Ich heiße übrigens Pantelej Tschertopchanow.«
Er beugte sich vor, stieß einen Schrei aus und schlug sein Pferd auf den Hals; das Pferd schüttelte den Kopf, bäumte sich, schwenkte auf die Seite ab und trat einem der Hunde auf die Pfote. Der Hund begann durchdringend zu winseln. Tschertopchanow brauste und zischte auf, schlug das Pferd auf den Kopf, zwischen die Ohren, sprang schneller als der Blitz vom Sattel, untersuchte die Pfote des Hundes, spuckte auf die Wunde, stieß den Hund mit dem Fuß in die Seite, damit er nicht mehr winsele, ergriff das Pferd an der Mähne und setzte den Fuß in den Steigbügel. Das Pferd warf den Kopf empor, hob den Schweif und stürzte sich seitwärts in die Büsche; er folgte ihm auf einem Fuß hüpfend. Schließlich sprang er doch in den Sattel, schwang wie rasend die Reitpeitsche, stieß ins Horn und sprengte davon. Ich hatte mich von meinem Erstaunen über das unerwartete Erscheinen Tschertopchanows noch nicht erholt, als plötzlich aus dem Gebüsch fast geräuschlos ein dicker Mann von etwa vierzig Jahren auf einem schwarzen Pferdchen erschien. Er hielt an, zog eine grünlederne Mütze vom Kopf und fragte mich mit einer feinen, weichen Stimme, ob ich nicht einen Reiter auf einem Rotfuchs begegnet sei. Ich antwortete, den hätte ich wohl gesehen.
»Nach welcher Seite beliebte es dem Herrn zu reiten?« fuhr er in demselben Ton fort, ohne die Mütze aufzusetzen.
»Dorthin.«
»Ich danke Ihnen ergebenst.«
Er schnalzte mit den Lippen, schlug das Pferdchen mit den Beinen in die Flanken und trabte langsam in die von mir angegebene Richtung. Ich blickte ihm nach, bis seine gehörnte Mütze hinter den Zweigen verschwand. Dieser neue Unbekannte glich seinem Vorgänger in keiner Beziehung. Sein aufgedunsenes und kugelrundes Gesicht drückte Schüchternheit, Gutmütigkeit und sanfte Demut aus; die ebenfalls gedunsene und runde, von blauen Adern durchzogene Nase verriet einen Wollüstling. Auf seinem Kopf war vorn kein einziges Härchen übriggeblieben, hinten hingen aber noch einige dünne blonde Strähnen; die wie mit einem scharfen Schilfblatt geschlitzten Äuglein zwinkerten freundlich; süß lächelten seine roten und saftigen Lippen. Er trug einen Überrock mit einem Stehkragen und Messingknöpfen, ziemlich abgetragen, aber reinlich; seine tuchene Hose war in die Höhe gerutscht; über dem gelben Besatz der Stiefel waren seine vollen Waden zu sehen.
»Wer ist das?« fragte ich Jermolai.
»Der da? Tichon Iwanytsch Nedopjuskin. Er wohnt bei Tschertopchanow.«
»Ist er arm?«
»Gar nicht reich, aber auch Tschertopchanow hat keinen roten Heller.«
»Warum wohnt er dann bei ihm?«
»Ja, sie sind Freunde. Der eine macht ohne den andern keinen Schritt . . . Wie es im Sprichwort heißt: Wohin das Pferd mit seinem Huf, dorthin auch der Krebs mit seiner Schere . . .«
Wir kamen aus dem Gebüsch heraus; plötzlich schlugen neben uns zwei Jagdhunde an, und ein großer, dicker Hase schoß über den schon ziemlich hohen Hafer dahin, und hinter den Hunden sauste auch Tschertopchanow einher. Er schrie nicht, er hetzte nicht, er rief den Hunden nichts zu; er keuchte und rang um Atem; aus seinem offenen Mund kamen zuweilen abgerissene, sinnlose Laute; er sprengte mit aufgerissenen Augen daher und schlug das unglückliche Pferd grausam mit der Reitpeitsche. Die Windhunde kamen heran . . . der Hase duckte sich, wandte sich scharf um und rannte an Jermolai vorbei in die Büsche . . . Die Windhunde liefen weiter. »Gib acht, gib acht«, stammelte mühevoll wie ein Stotterer der vor Aufregung ersterbende Jäger, »Liebster, gib acht!« Jermolai schoß . . . der verwundete Hase purzelte wie ein Kreisel über das glatte, trockene Gras, sprang empor und schrie jämmerlich unter den Zähnen des herbeigeeilten Hundes. Die anderen Hunde kamen sofort herbei.
Tschertopchanow flog wie ein Raubvogel vom Sattel, zog seinen Dolch, lief breitbeinig zu den Hunden, entriß ihnen unter wütenden Flüchen den zerfetzten Hasen und stieß ihm mit verzerrtem Gesicht den Dolch bis ans Heft in den Hals . . . stieß ihn hinein und fing zu jodeln an. Am Waldsaum erschien Tichon Iwanytsch. »Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho!« schrie Tschertopchanow zum zweitenmal . . . »Ho-ho-ho-ho!« wiederholte ruhig sein Freund.
»Eigentlich sollte man im Sommer nicht jagen«, bemerkte ich zu Tschertopchanow, auf den zerstampften Hafer zeigend.
»Es ist mein Feld«, antwortete Tschertopchanow, kaum atmend.
Er weidete den Hasen aus, band ihn an den Sattel und verteilte die Pfoten unter die Hunde.
»Ich schulde dir eine Ladung«, sagte er nach der Jägerregel zu Jermolai. »Ihnen aber, mein Herr«, fügte er mit der gleichen abgerissenen, scharfen Stimme hinzu, »danke ich.«
Er stieg in den Sattel.
»Gestatten Sie die Frage . . . ich vergaß . . . Ihren Namen und Familiennamen.«
Ich nannte noch einmal meinen Namen.
»Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sollten Sie Gelegenheit haben, so kehren bitte bei mir ein . . . Wo ist aber dieser Fomka, Tichon Iwanytsch?« fuhr er erregt fort. »Wir haben ohne ihn den Hasen erlegt.«
»Sein Pferd ist unter ihm gestürzt«, antwortete Tichon Iwanytsch mit einem Lächeln.
»Wie, gestürzt? Orbassan gestürzt? Pfu, pfüt . . .! Wo ist er?«
»Dort, hinter dem Wald.«
Tschertopchanow gab seinem Pferd mit der Reitpeitsche eins auf die Schnauze und sprengte wie der Wind davon. Tichon Iwanytsch verbeugte sich vor mir zweimal – für sich und für seinen Freund – und trabte ihm ins Gebüsch nach.
Diese beiden Herren hatten meine Neugierde stark erregt. Was mochte wohl die beiden so verschiedenen Naturen mit Banden unzertrennlicher Freundschaft aneinanderfesseln? Ich zog Erkundigungen ein und erfuhr folgendes:
Pantelej Jeremejitsch Tschertopchanow galt in der ganzen Umgegend als ein gefährlicher, verrückter und hochmütiger Mensch und als Raufbold der schlimmsten Sorte. Er hatte ganz kurze Zeit in der Armee gedient und ›Unannehmlichkeiten halber‹ seinen Abschied mit dem Rang bekommen, der Anlaß zu dem Ausspruch gibt, das Huhn sei kein Vogel.Russisches Sprichwort: Das Huhn ist kein Vogel, der Fähnrich kein Offizier. (Anm. d. Ü.) Er stammte aus einer alten, einst reichen Familie; seine Vorfahren hatten prächtig, nach Steppenart gelebt, das heißt, sie nahmen Geladene und Ungeladene bei sich auf, fütterten sie zum Zerspringen, verabfolgten den fremden Kutschern je eine Tschetwert Hafer für jede Troika, hielten sich Musikanten, Säuger, Possenreißer und Hunde, bewirteten das Volk an Feiertagen mit Branntwein und Bier, reisten im Winter mit eigenen Pferden in schwerfälligen Kutschen nach Moskau, saßen aber oft auch monatelang ohne einen Groschen Geld und lebten von Hausgeflügel, Der Vater Pantelej Jeremejitschs hatte das Gut schon in einem arg ruinierten Zustand geerbt; auch er genoß seinerseits sein Leben und hinterließ seinem einzigen Erben Pantelej das verpfändete Dörfchen Bessonowo mit fünfunddreißig männlichen und sechsundsiebzig weiblichen leibeigenen Seelen und vierzehn und ein Achtel Desjatinen schlechten Landes in der Wildnis Kolobrodowo, über deren Besitz sich jedoch in den Papieren des Verstorbenen keinerlei Urkunden vorfanden. Der Verstorbene hatte sich, man muß es zugeben, auf eine höchst seltsame Weise ruiniert, ›die wirtschaftliche Berechnung‹ hatte ihn zugrunde gerichtet. Nach seiner Ansicht ziemte es einem Edelmann nicht, von Kaufleuten, Bürgern und ähnlichen ›Räubern‹, wie er sie nannte, abzuhängen; darum führte er bei sich allerlei Werkstätten und Handwerke ein. ›So ist es anständiger und auch vorteilhafter‹, pflegte er zu sagen, ›das ist die wirtschaftliche Berechnung!‹ An diesem verderblichen Gedanken hielt er bis an sein Ende fest; er richtete ihn auch zugrunde. Dafür war ihm das Leben eine Freude. Keine einzige Laune versagte er sich. Unter anderen Einfallen kam er einmal auf die Idee, sich nach eigenen Berechnungen eine so große Familienkutsche zu bauen, daß sie trotz der vereinten Bemühungen der zusammengetriebenen Bauernpferde des ganzen Dorfes und deren Besitzer gleich beim ersten Abhang stürzte und zerfiel. Jeremej Lukitsch (Pantelejs Vater hieß Jeremej Lukitsch) ließ auf jenem Abhang einen Gedenkstein errichten, machte sich aber darüber weiter keine Gedanken. Es fiel ihm auch ein, eine Kirche zu bauen, natürlich ohne Hilfe eines Architekten. Er verbrannte einen ganzen Wald zum Ziegelbrennen, legte ein mächtiges Fundament, das für eine Gouvernementskathedrale paßte, führte die Mauern auf und begann die Kuppel zu wölben; die Kuppel stürzte ein. Er baute sie von neuem, sie stürzte wieder ein; er baute sie zum drittenmal, die Kuppel fiel zum drittenmal auseinander. Da wurde Jeremej Lukitsch nachdenklich: Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu, es ist wohl verfluchte Hexerei im Spiel . . . und er gab plötzlich den Befehl, alle alten Weiber im Dorf durchzupeitschen. Man peitschte die alten Weiber durch, konnte aber die Kuppel doch nicht aufführen. Er begann, die Bauernhäuser nach einem neuen Plan umzubauen, alles aus wirtschaftlicher Berechnung: Er stellte je drei Höfe zu einem Dreieck zusammen und errichtete in der Mitte eine Stange mit einem angemalten Starenhäuschen und einer Flagge. Jeden Tag erfand er etwas Neues, bald kochte er aus Pestwurzblättern Suppen, bald schnitt er den Pferden die Schweife ab, um daraus Mützen für seine Leibeigenen zu machen, bald wollte er statt Flachs Brennesseln anbauen, bald Schweine mit Pilzen füttern . . . Einmal las er in den Moskauer Nachrichten einen Artikel des Charkower Gutsbesitzers Chrjak-Chrupjorskij über den Nutzen der Sittlichkeit im Bauernleben und befahl gleich am nächsten Tag allen Bauern, den Artikel des Charkower Gutsbesitzers auswendig zu lernen. Die Bauern lernten den Artikel auswendig; der Herr fragte sie, ob sie verstünden, was da geschrieben wäre. Der Verwalter antwortete, wie sollten sie das nicht verstehen? Um die gleiche Zeit ordnete er an, alle seine Untertanen der Ordnung und der wirtschaftlichen Berechnung wegen zu numerieren und jedem die Nummer an den Kragen zu nähen. Bei der Begegnung mit dem Herrn pflegte jeder Bauer schon aus der Ferne zu rufen: »Die Nummer so und so kommt!« Worauf der Herr freundlich antwortete: »Geh mit Gott!«
Aber trotz der Ordnung und der wirtschaftlichen Berechnung geriet Jeremej Lukitsch allmählich in eine äußerst schwierige Lage, er begann seine Dörfer erst zu verpfänden und dann auch zu verkaufen; den letzten Urahnensitz, das Dorf mit der unvollendeten Kirche, verkaufte schon der Staat, zum Glück nicht mehr bei Lebzeiten Jeremej Lukitschs – er hätte diesen Schlag nicht überstanden –, sondern zwei Wochen nach seinem Ableben. So war es ihm beschieden, in seinem eigenen Haus, in seinem Bett, umgeben von seinen Leuten und unter Aufsicht seines Arztes zu sterben; dem armen Pantelej blieb aber nur das kleine Gut Bessonowo.
Pantelej erfuhr von der Krankheit des Vaters beim Militär, mitten in der schon erwähnten ›Unannehmlichkeit‹. Er war eben ins neunzehnte Lebensjahr getreten. Von Kind an hatte er das Elternhaus nicht verlassen und war unter der Leitung seiner Mutter Wassilissa Wassiljewna, einer herzensguten, aber vollkommen stumpfsinnigen Frau, als verzogenes Muttersöhnchen aufgewachsen. Sie allein hatte sich mit seiner Erziehung beschäftigt; Jeremej Lukitsch war ganz von seinen wirtschaftlichen Sorgen in Anspruch genommen und hatte keine Zeit dafür. Allerdings bestrafte er einmal seinen Sohn eigenhändig dafür, weil er den Buchstaben ›rzy‹ wie ›arzy‹ aussprach, aber an jenem Tag hatte Jeremej Lukitsch einen tiefen, heimlichen Kummer; sein bester Hund war an einen Baum angerannt und den Verletzungen erlegen. Die Bemühungen Wassilissa Wassiljewnas um die Erziehung Pantelejs beschränkten sich übrigens auf eine schmerzvolle Anstrengung: Im Schweiße ihres Angesichts hatte sie für ihn einen verabschiedeten Soldaten aus dem Elsaß, einen gewissen Bierkopf, als Hofmeister engagiert, vor dem sie bis zu ihrem Tode wie ein Espenblatt zitterte: Nun, dachte sie sich, wenn er mir kündigt, bin ich verloren! Was soll ich dann anfangen? Wo soll ich einen andern Lehrer finden? Diesen schon habe ich mit vieler Mühe der Nachbarin weggeschnappt! – Bierkopf machte sich als kluger Mann seine Sonderstellung sofort zunutze: Er trank in einem fort und schlief vom Morgen bis zum Abend. Nach Beendigung der ›wissenschaftlichen Ausbildung‹ trat Pantelej in den Dienst. Wassilissa Wassiljewna war nicht mehr am Leben. Sie war ein halbes Jahr vor diesem wichtigen Ereignis vor Schreck gestorben; sie sah im Traum einen weißen Menschen auf einem Bären reiten. Jeremej Lukitsch folgte bald seiner besseren Hälfte nach.
Pantelej eilte bei der ersten Kunde von der Krankheit des Vaters Hals über Kopf zu ihm. Wie groß war aber das Erstaunen des ehrerbietigen Sohnes, als er sich plötzlich aus einem reichen Erben in einen Bettler verwandelt sah! Nur wenige Menschen sind imstande, eine so plötzliche Wendung zu ertragen. Pantelej wurde hart und wild. Aus einem ehrlichen und guten, wenn auch unberechenbaren und hitzigen Menschen verwandelte er sich in einen hochmütigen Raufbold, gab jeden Verkehr mit seinen Nachbarn auf – vor den Reichen schämte er sich, die Armen verschmähte er – und behandelte alle, selbst die vorgesetzten Behörden, mit unerhörter Frechheit: Ich bin eben ein Edelmann! Einmal hätte er den Kreispolizisten beinahe niedergeschossen, weil der mit der Mütze auf dem Kopf zu ihm ins Zimmer getreten war. Die Behörden sahen ihm ihrerseits natürlich auch nichts nach und gaben es ihm bei jeder Gelegenheit zu fühlen; aber sie hatten vor ihm doch einige Angst, denn er war ein schrecklicher Hitzkopf und forderte einen gleich nach dem zweiten Wort zu einem Zweikampf auf Messer. Bei der geringsten Widerrede begannen Tschertopchanows Augen unruhig umherzuschweifen und seine Stimme versagte . . . »Ah, wa-wa-wa-wa«, stammelte er, »und wenn es mich auch den Kopf kostet!« Dann war er imstande, die Wände hinaufzuklettern! Aber abgesehen davon war er ein makelloser Mensch und in keine anrüchige Sache verwickelt. Selbstverständlich besuchte ihn niemand . . . Dabei war er gutmütig und in seiner Weise auch hochherzig: Er konnte keine Ungerechtigkeit oder Unterdrückung selbst gegen Fremde ertragen. Für seine Bauern trat er mit Leib und Seele ein. »Wie?« pflegte er zu sagen, indem er sich wütend auf den Kopf schlug. »Meine Leute anrühren? Ich will nicht Tschertopchanow heißen, wenn . . .«
Tichon Iwanytsch Nedopjuskin konnte nicht auf seine Herkunft so stolz sein wie Pantelej Jeremejitsch. Sein Vater stammte von den Einhöfern ab und erlangte erst nach vierzigjährigen Diensten den Adel. Herr Nedopjuskin-Vater gehörte zu den Menschen, die das Unglück mit seiner Erbitterung verfolgt, die wie persönlicher Haß aussieht. Ganze sechzig Jahre lang, von der Geburt bis zum Tode, kämpfte der arme Mensch mit allen möglichen Nöten, Krankheiten und Schicksalsschlägen, die den kleinen Leuten eigentümlich sind; er plagte sich furchtbar ab, aß sich nicht satt, gönnte sich keinen Schlaf, bückte sich vor jedermann, verzagte und quälte sich, zitterte um jede Kopeke, wurde wirklich ›unschuldig‹ aus dem Dienst gejagt und starb schließlich auf einem Dachboden oder in einem Keller, ohne für sich und seine Kinder ein Stück Brot erarbeitet zu haben – das Schicksal hatte ihn wie einen Hasen auf der Treibjagd totgehetzt. Er war ein guter und ehrlicher Mensch, nahm aber doch Bestechungsgelder an – von zehn Kopeken bis zu zwei Silberrubel einschließlich. Nedopjuskin hatte eine magere und schwindsüchtige Frau gehabt und auch Kinder; zum Glück waren diese alle jung gestorben mit Ausnahme Tichons und einer Tochter Mitrodora, mit dem Zunamen ›Kaufmannsparade‹, die nach vielen traurigen und komischen Abenteuern einen verabschiedeten Gerichtsschreiber heiratete. Herr Nedopjuskin-Vater hatte noch bei Lebzeiten seinen Sohn Tichon als einen nichtetatmäßigen Schreiber in einer Kanzlei untergebracht, aber Tichon nahm gleich nach dem Ableben des Vaters seinen Abschied. Die ewige Unruhe, der qualvolle Kampf gegen Kälte und Hunger, das Jammern der Mutter, die Anstrengungen und die Verzweiflung des Vaters, die rohen Verfolgungen seitens des Hauswirtes und des Krämers, dieser ganze tägliche, ununterbrochene Kummer erzeugte in Tichon eine unbeschreibliche Schüchternheit; bei dem bloßen Anblick eines Vorgesetzten zitterte und erstarb er wie ein gefangenes Vögelchen. Er gab den Dienst auf. Die gleichgültige, vielleicht auch spöttische Natur gibt den Menschen verschiedene Fähigkeiten und Neigungen ein, ohne sich nach ihrer Stellung in der Gesellschaft und nach ihren Verhältnissen zu richten; mit der ihr eigenen Sorge und Liebe formte sie aus Tichon, dem Sohn eines armen Beamten, ein empfindsames, faules, sanftes, empfindliches Geschöpf, das ausschließlich für den Genuß geboren schien und mit einem außerordentlich feinen Geruchsinn und Geschmack begabt war . . . sie formte ihn, vollendete ihn aufs sorgfältigste und stellte es ihrer Schöpfung anheim, mit Sauerkraut und faulen Fischen heranzuwachsen. Diese Schöpfung wuchs heran und begann, was man so nennt, zu ›leben‹. Nun ging der Spaß los. Das Schicksal, das den Nedopjuskin-Vater ununterbrochen gepeinigt hatte, machte sich auch an den Sohn, es hatte wohl Geschmack daran gefunden. Aber gegen Tichon ging es anders vor: Es peinigte ihn nicht, sondern spielte mit ihm. Es brachte ihn kein einziges Mal zur Verzweiflung, zwang ihn nicht, die beschämenden Qualen des Hungers zu kosten, aber es trieb ihn durch ganz Rußland, aus Welikij-Ustjug nach Zarewo-Kokschaisk, aus der einen erniedrigenden und lächerlichen Stellung in die andere; bald beförderte es ihn zum ›Majordomus‹ bei einer zänkischen und gallsüchtigen Wohltäterin, bald machte es ihn zum Kostgänger bei einem reichen, geizigen Kaufmann, bald ernannte es ihn zum Vorstand der Hauskanzlei eines glotzäugigen, nach englischer Art zugestutzten Gutsbesitzers, bald erhob es ihn zu einem halben Haushofmeister und halben Spaßmacher bei einem Liebhaber der Hetzjagd . . . Mit einem Wort, das Schicksal ließ den armen Tichon den ganzen bitteren und giftigen Trank einer untergeordneten Existenz Tropfen auf Tropfen trinken. In seinem Leben hatte er genug den schweren Launen, der verschlafenen und boshaften Langweile der müßigen Gutsbesitzer gedient . . . Wie oft hatte er in seinem Zimmer, nachdem er einem Rudel von Gästen als Spielball gedient und von ihnen ›mit Gott‹ entlassen war, vor Scham verbrennend, mit kalten Tränen der Verzweiflung in den Augen, geschworen, sich gleich am nächsten Morgen heimlich aus dem Staub zu machen, sein Glück in der Stadt zu versuchen und wenigstens eine Schreiberstelle zu finden oder aber auf der Straße Hungers zu sterben. Aber erstens gab ihm Gott keine Kraft, zweitens war er zu schüchtern und drittens: Wie findet man eine Stelle, wen bittet man darum? »Man wird mir keine geben«, flüsterte zuweilen der Unglückliche, sich in seinem Bett von der einen Seite auf die andere wälzend: »Man wird mir keine geben!« Und am andern Tag trug er wieder sein Joch. Seine Stellung war um so qualvoller, als selbst die fürsorgliche Natur sich nicht die Mühe gegeben hatte, ihn auch nur mit einem winzigen Anteil jener Fähigkeiten und Anlagen zu begaben, ohne die das Amt eines Spaßmachers fast unmöglich ist. Er verstand z. B. nicht, bis zum Umfallen in einem mit dem Futter nach außen umgewendeten Bärenpelz zu tanzen oder in unmittelbarer Nähe geschwungener Hundepeitschen Witze und Komplimente zu machen; wenn man ihn nackt einem Frost von zwanzig Grad aussetzte, erkältete er sich zuweilen; sein Magen verdaute weder mit Tinte und sonstigem Zeug vermischten Wein noch gehackte Fliegenschwämme und Täublinge mit Essig. Gott allein weiß, was aus Tichon geworden wäre, wenn der letzte seiner Wohltäter, ein reich gewordener Branntweinpächter, in einer lustigen Stunde nicht den Einfall gehabt hätte, in seinem Testament folgenden Zusatz zu machen: ›Dem Sjosja (alias Tichon) Nedopjuskin vermache ich aber zum ewigen und erblichen Besitz das von mir wohlerworbene Dorf Besselendejewka mit allen Appertinenzien.‹ Einige Tage später wurde der Wohltäter beim Verzehren einer Sterlettsuppe vom Schlag gerührt. Es entstand ein Lärm, das Gericht trat ein und versiegelte, wie es sich gehört, die Hinterlassenschaft. Die Verwandten kamen zusammen, öffneten das Testament, lasen es und schickten nach Nedopjuskin. Nedopjuskin erschien. Der größte Teil der Versammelten wußte, welches Amt Tichon Iwanytsch bei seinem Wohltäter bekleidet hatte; man empfing ihn mit lauten Ausrufen und spöttischen Glückwünschen: »Der Gutsbesitzer, da ist er, der neue Gutsbesitzer!« schrien die übrigen Erben. – »Da kann man wirklich sagen«, fiel ein bekannter Spaßvogel und Witzbold ein, »da kann man wirklich sagen . . . das ist wirklich . . . was man so nennt . . . ein Erbe!« Und alle platzten vor Lachen. Nedopjuskin wollte an sein Glück lange nicht glauben. Man zeigte ihm das Testament, er errötete, kniff die Augen zusammen, fuchtelte abwehrend mit den Händen und begann zu schluchzen. Das Lachen der Versammlung wurde zu einem lauten, eintönigen Gebrüll. Das Dorf Besselendejewka zählte nur zweiundzwanzig leibeigene Seelen; niemand neidete es ihm, warum sollte man also nicht seinen Spaß haben? Nur ein Erbe aus Petersburg, ein würdiger Herr mit griechischer Nase und höchst vornehmem Gesichtsausdruck, Rostislaw Adamytsch Stoppel, konnte sich nicht beherrschen: Er rückte seitwärts zu Nedopjuskin heran und sah ihn hochmütig über die Schulter hinweg an. »Soviel ich sehen kann, mein Herr«, sagte er verächtlich und wegwerfend, »haben Sie beim verehrten Fjodor Fjodorowitsch das Amt eines Spaßmachers, sozusagen eines Dieners bekleidet?« Der Herr aus Petersburg bediente sich einer unerträglich deutlichen, scharfen und genauen Sprache. Der fassungslose und aufgeregte Nedopjuskin verstand die Worte des ihm unbekannten Herrn nicht, aber alle andern verstummten sofort; der Witzling lächelte herablassend. Herr Stoppel rieb sich beide Hände und wiederholte seine Frage. Nedopjuskin hob erstaunt die Augen und riß den Mund auf. Rostislaw Adamytsch blinzelte verächtlich mit den Augen.
»Ich gratuliere Ihnen, mein Herr, ich gratuliere«, fuhr er fort. »Freilich darf man wohl sagen, daß nicht jedermann geneigt wäre, sich sein Brot auf diese Weise zu verdienen; aber de gustibus non est disputandum, das heißt, ein jeder nach seinem Geschmack . . . Nicht wahr?«
In der hinteren Reihe winselte jemand ganz unanständig vor Erstaunen und Entzücken.
»Sagen Sie«, fiel Herr Stoppel ein, »welchem Talent insbesondere haben Sie Ihr Glück zu verdanken? Nein, schämen Sie sich nicht, sagen Sie es; wir sind ja hier alle unter uns, sozusagen en famille! Nicht wahr, meine Herren, wir sind doch en famille?«
Der Erbe, an den sich Herr Stoppel zufällig mit seiner Frage gewandt hatte, verstand leider kein Französisch und beschränkte sich daher auf ein leichtes, beifälliges Räuspern. Ein anderer Erbe, ein junger Mann mit gelblichen Flecken auf der Stirn, bestätigte dagegen hastig: »Wui, wui, selbstverständlich.«
»Sie könnten vielleicht«, begann Herr Stoppel von neuem, »auf den Händen, die Füße sozusagen nach oben gerichtet, gehen?«
Nedopjuskin blickte trübsinnig um sich – alle Gesichter lächelten gehässig, alle Augen glänzten vor Vergnügen.
»Oder verstanden Sie vielleicht wie ein Hahn zu krähen?«
Schallendes Gelächter erhob sich ringsum und verstummte sofort, von der Erwartung des Kommenden erstickt.
»Oder konnten Sie vielleicht mit der Nase . . .«
»Hören Sie auf!« unterbrach plötzlich den Rostislaw Adamytsch eine laute und scharfe Stimme. »Wie schämen Sie sich nicht, den armen Menschen zu quälen!«
Alle sahen sich um. In der Tür stand Tschertopchanow. Als Neffe vierten Ranges des seligen Branntweinpächters hatte auch er eine Einladung zum Familienkongreß bekommen. Während der Verlesung des Testaments hatte er sich – wie immer – hochmütig abseits von den andern gehalten.
»Hören Sie auf!« wiederholte er und warf den Kopf stolz in den Nacken.
Herr Stoppel wandte sich rasch um. Als er einen ärmlich gekleideten, unansehnlichen Menschen sah, fragte er halblaut seinen Nachbar (denn Vorsicht kann nie schaden): »Wer ist das?«
»Tschertopchanow, kein großes Tier«, antwortete ihm jener ins Ohr.
Rostislaw Adamytsch setzte eine hochmütige Miene auf.
»Was haben Sie zu kommandieren?« sagte er durch die Nase, mit den Augen blinzelnd. »Was sind Sie für ein Tier, wenn ich fragen darf?«
Tschertopchanow flammte auf wie Pulver von einem Funken. Die Wut benahm ihm den Atem.
»Ds-ds-ds-ds«, zischte er, wie wenn man ihn würgte, und donnerte plötzlich: »Wer ich bin? Wer ich bin? Ich bin der Edelmann Pantelej Tschertopchanow, mein Ururgroßvater hat dem Zaren gedient, und wer bist du?«
Rostislaw Adamytsch erbleichte und trat einen Schritt zurück. Eine solche Abfuhr hatte er nicht erwartet.
»Ich ein Tier! Ich ein Tier . . . Oh, oh, oh!«
Tschertopchanow ging auf ihn los; Stoppel sprang in großer Erregung zurück, die Gäste stürzten dem aufgebrachten Gutsbesitzer entgegen.
»Wir schießen uns, wir schießen uns, gleich hier auf der Stelle, über ein Schnupftuch!« schrie der rasende Pantelej. »Oder bitte mich um Verzeihung und auch ihn . . .«
»Bitten Sie doch um Verzeihung«, stammelten die aufgeregten Erben rings um Stoppel. »Er ist ja verrückt und kann einen erdolchen!«
»Verzeihen Sie, verzeihen« Sie, ich habe nicht gewußt«, lallte Stoppel, »ich habe nicht gewußt . . .«
»Bitte auch ihn um Verzeihung!« brüllte der unerbittliche Pantelej.
»Entschuldigen auch Sie«, fügte Rostislaw Adamytsch hinzu, sich an Nedopjuskin wendend, welcher selbst wie im Fieber zitterte.
Tschertopchanow beruhigte sich, ging auf Tichon Iwanytsch zu, nahm ihn bei der Hand, blickte frei um sich und verließ, als er keinem Blick begegnete, inmitten tiefsten Schweigens zugleich mit dem neuen Besitzer des wohlerworbenen Dorfes Besselendejewka das Zimmer.
Von diesem Tag an trennten sie sich nicht mehr. (Das Dorf Besselendejewka lag nur acht Werst von Bessonowo entfernt.) Die grenzenlose Dankbarkeit Nedopjuskins ging bald in eine andachtsvolle Unterwürfigkeit über. Der schwache, sanfte, in Geldsachen nicht ganz saubere Tichon beugte sich in den Staub vor dem furchtlosen und uneigennützigen Pantelej. Eine Kleinigkeit! dachte er manchmal bei sich. Er spricht mit dem Gouverneur und blickt ihm dabei gerade in die Augen . . . bei Gott, gerade in die Augen . . .!
Er bewunderte ihn ganz sinnlos, bis zur Erschöpfung aller Seelenkräfte, und hielt ihn für einen ungewöhnlichen, klugen und gelehrten Menschen. Man muß wohl sagen: Wie schlecht auch Tschertopchanows Erziehung war, im Vergleich mit der Erziehung Tichons konnte sie immer noch eine glänzende genannt werden. Tschertopchanow las allerdings nur wenig Russisch und verstand schlecht Französisch – so schlecht, daß er einmal auf die Frage eines Schweizer Hofmeisters »Vous parlez français, monsieur?« antwortete: »Sche verstehe nicht«, und nach einiger Überlegung hinzusetzte: »pas«; aber er wußte immer noch, daß es auf der Welt einmal einen Voltaire, einen höchst beißenden Schriftsteller, gegeben und daß Friedrich der Große, König von Preußen, sich auf militärischem Gebiet ausgezeichnet habe. Von russischen Schriftstellern achtete er Derschawin und liebte Marlinskij; seinen besten Hund nannte er nach einem der Helden Marlinskijs Amalat Beck . . .
Einige Tage nach meiner ersten Begegnung mit den beiden Freunden begab ich mich nach Bessonowo zu Pantelej Jeremejitsch. In der Ferne war sein kleines Häuschen sichtbar; es ragte auf einer kahlen Stelle, eine halbe Werst vom Dorf entfernt, ganz einsam wie ein Habicht auf einem Acker. Das ganze Gut Tschertopchanows bestand aus vier altersschwachen, aus Balken gezimmerten Gebäuden verschiedener Größe, und zwar aus dem Wohnhaus, einem Pferdestall, einem Schuppen und einem Dampfbad. Jeder Bau stand für sich; von einem Zaun oder Tor war nichts zu sehen. Mein Kutscher hielt ratlos vor einem halbverfaulten und verschütteten Brunnen. Neben dem Schuppen zerrten einige magere und struppige junge Windhunde an einem Pferdekadaver herum – wahrscheinlich war es Orbassan; einer von ihnen hob seine blutige Schnauze, bellte in großer Eile und fing wieder an, an den entblößten Rippen zu nagen. Neben dem Pferd stand ein Bursche von etwa siebzehn Jahren, mit gedunsenem gelbem Gesicht, barfuß und als Lakai gekleidet; er sah wichtig auf die seiner Aufsicht anvertrauten Hunde und schlug die allergierigsten ab und zu mit der Hetzpeitsche.