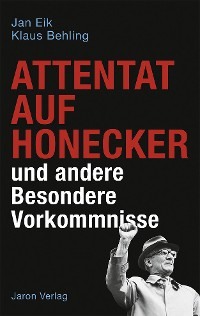Kitabı oku: «Attentat auf Honecker und andere Besondere Vorkommnisse», sayfa 4
Das Funkhaus brennt
Die Geschichte einer erfundenen Sabotage
Die Geschichte des Rundfunks der DDR begann in der West-Berliner Masurenallee. Am Morgen des 2. Mai 1945 besetzte eine sowjetische Einheit die Rundfunkzentrale des untergegangenen Großdeutschen Reiches. Das Gebäude, 1929 – 31 von Hans Poelzig erbaut, war bei den zahllosen Luftangriffen verschont geblieben und diente fortan als Funkhaus für Berlin und die sowjetische Besatzungszone (SBZ). 1951 bestätigte das Moabiter Schwurgericht in West-Berlin, dass „der Gebäudekomplex des Berliner Rundfunks … nach den Abmachungen der vier Besatzungsmächte von 1945 eine unter sowjetischer Besatzungshoheit stehende Enklave innerhalb des britischen Sektors von Berlin darstellt und insoweit nicht zu den Westsektoren zu rechnen ist“.
Das war für alle Beteiligten eine brisante Situation. Die SED-Führung ahnte, dass die Lage ihres Funkhauses in West-Berlin dauerhaft keinen ungestörten Betrieb zulassen würde, das in einem früheren Bootshaus eingerichtete Funkhaus Grünau bot keine Alternative.
Am frühen Morgen des 3. Juni 1952 kam es zum Eklat. Britische Militär- und West-Berliner Polizei sperrten den Gebäudekomplex mit Stacheldraht und doppelter Postenkette ab. Dem vorausgegangen war Ende Mai 1952 die Einführung eines von Moskau befohlenen strengeren Grenzregimes zwischen dem DDR-Umland und West-Berlin. Nur die Passage zwischen den Sektoren der unter der Kontrolle der vier alliierten Siegermächte stehenden Stadt blieb ungehindert möglich.
Im Funkhaus in der Masurenallee fuhr in jener Nacht die übliche technische und redaktionelle Besatzung die Programme des Berliner Rundfunks und des Deutschlandsenders. Chef vom Dienst war der vom Kölner NWDR zugewanderte Kommentator Karl-Eduard von Schnitzler. Zwischen 1949 und 1951 hatte die Kaderabteilung des Zentralkomitees (ZK) der SED in Ost-Berlin rund 1100 West-Berliner Rundfunkmitarbeiter entlassen und junge Ost-Berliner eingestellt, von denen die wenigsten SED-Mitglieder waren.
Überraschend war der Zwischenfall nicht. Seit April 1951 arbeitete deshalb eine Gruppe von Architekten und Ingenieuren unter strengster Geheimhaltung am Bau eines eigenen Funkhauses im Osten. Dazu hatte man eine demontierte Furnierfabrik in Oberschöneweide auserkoren. Auf die vier Geschosse des vorhandenen Backsteinbaus (Block A) wurde ein fünftes gesetzt und der Baukörper um einen achtstöckigen Turm ergänzt. Außerdem war auf dem weitläufigen Gelände an der Spree ein moderner Produktionskomplex für Musik- und Hörspielaufnahmen vorgesehen (Block B).
Nun ging es erst einmal darum, die von einer sowjetischen Wachmannschaft unterstützte „Front“ in West-Berlin zu halten. Alle Leitungsverbindungen zu den DDR-Sendern blieben intakt. Acht Tage arbeitete die eingeschlossene Besatzung weiter. Dann wurde sie durch eine zweite Gruppe ersetzt. Erst am 22. August verließen die letzten Techniker das derweil weitgehend demontierte Haus, in dem nun nur die sowjetische Wachmannschaft zurückblieb.
Gut eine Woche zuvor, am 14. August 1952, war laut Beschluss des Ministerrats der DDR das zentrale Staatliche Rundfunkkomitee (StRuKo) mit drei Berliner Programmen gebildet worden. Deutschlandsender und Mitteldeutscher Rundfunk stellten ihre Sendungen ein.
Das neue Funkhaus Nalepastraße ging am 14. September 1952 in Betrieb. Gleichzeitig begannen die Bauarbeiten für die Musik- und Hörspielstudios. Solch ein Großprojekt war ein immenses Problem für die schwache DDR-Wirtschaft. Es wurde jedoch mit einem erstaunlichen Ergebnis bewältigt: In dem Neubau, der sich mit seinen sandsteingefassten Klinkerfronten architektonisch dem Gesamtkomplex anpasste, entstanden in acht im Fundament voneinander getrennten Häusern zwei große und zwei kleinere Musiksäle mit Regie- und Abhörräumen, dazu zwei Hörspielkomplexe mit optisch und akustisch aufwendig ausgestatteten Studios. Die Kosten blieben im Rahmen der geplanten 34 Millionen Mark. Als Fertigstellungstermin für die Säle I und II war der 1. Juli 1955 vorgesehen, die endgültige Übergabe aller technischen Einrichtungen sollte zum 31. März 1956 erfolgen.
Architekt Franz Ehrlich (1907 – 1984) hatte sich mit der damals von der SED verpönten Bauhaus-Tradition durchgesetzt. Der von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald eingekerkerte und später ins „Strafbataillon 999“ gesteckte Kommunist schuf ein Ensemble, das in seiner äußeren wie in seiner inneren Form „funktionelle Zweckmäßigkeit mit einer soliden Qualität der Gestaltung“ verband, wie es in einer Laudatio zu seinem 75. Geburtstag hieß. Dass der Bau einmal fast den Flammen zum Opfer gefallen wäre, war inzwischen längst vergessen.
Feueralarm
Am Donnerstag, dem 17. Februar 1955, meldete die Deutsche Presse-Agentur: „Ein Großbrand, der am Mittwochabend im Block B des ‚Staatlichen Rundfunkkomitees‘ in Berlin-Oberschöneweide entstanden war, konnte durch sieben Löschzüge der Ostberliner Feuerwehr erst in den Morgenstunden des Donnerstag eingedämmt werden … Die Rundfunksendungen seien nicht gestört worden. Der betroffene Block B des Komplexes ‚Staatliches Rundfunkkomitee‘ ist ein modern eingerichtetes Gebäude mit zwei Sendesälen und Räumen für den technischen Hörspielstab. Der Bau sollte in den nächsten Tagen in Dienst gestellt werden. Wie ein Augenzeuge dem Untersuchungsausschuß freiheitlicher Juristen mitteilte, ist Totalschaden wahrscheinlich. Volkspolizisten hätten den ganzen Bereich des Staatlichen Rundfunkkomitees abgesperrt.“
Die Ost-Berliner, soweit sie vom Großeinsatz der Feuerwehr nichts bemerkt hatten, erfuhren erst zwei Tage später durch eine Lokalnotiz in der Tagespresse, dass es beim Rundfunk gebrannt hatte. In einer nachfolgenden Meldung des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes (ADN) hieß es: „Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beträgt ca. 2 Millionen DM. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, daß es sich bei der Brandursache mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Brandlegung handelt, die den kurz vor seiner Inbetriebnahme stehenden Neubau mit seinen wertvollen Einrichtungen zerstören sollte.“
Das klang erst einmal nach der damals üblichen Agentenhysterie. Es war die Zeit des Kalten Kriegs, und im geteilten Berlin waren Menschenraub von West nach Ost ebenso wie Flucht von Ost nach West, Sabotage, Schmuggel und dunkle Geschäfte aller Art keine Seltenheit. Und prompt veröffentlichte der Ministerrat der DDR zwei Monate nach dem Brand im Funkhaus eine Erklärung, in der die Verhaftung von „521 Agenten amerikanischer und englischer Geheimdienststellen, der Spionageorganisation Gehlen und verschiedener Westberliner Hilfsorgane – wie der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), des sogenannten ‚Untersuchungsausschusses Freiheitlicher Juristen‘, des RIAS, der Ostbüros Westberliner Parteien und anderer“ gemeldet wurde. Zum Feuer in der Nalepastraße hieß es: „Die Organe der Staatssicherheit haben den amerikanischen Agenten Bade, Arno verhaftet. Der Bauingenieur Bade, Arno, der nach Beendigung seines Studiums an der Westberliner Technischen Hochschule vom amerikanischen Geheimdienst in die Bauindustrie der DDR geschickt worden war, verübte am 16. Februar d. J. eine Brandstiftung in einem neuen Gebäude des Staatlichen Rundfunkkomitees. Mit Hilfe von Brandsätzen des amerikanischen Geheimdienstes, die er in das Kanalsystem der Klimaanlage einbaute, steckte er die neuerbauten Sendesäle in Brand. Bei Löscharbeiten erlitten vierzehn Personen schwere Verletzungen.“
Diese Erklärung des Ministerrats blieb vierzig Jahre lang die einzige offizielle Quelle über das Ereignis. Der angekündigte Schauprozess gegen den angeblich überführten und geständigen Agenten fand niemals statt. Hin und wieder war in den DDR-Medien auch später noch von der Brandstiftung „durch den Agenten des amerikanischen Geheimdienstes B.“ die Rede. Beweise wurden aber niemals vorgelegt. Obwohl das Landgericht Berlin den Richterspruch gegen Arno Bade bereits 1991 kassierte, behauptete Erich Mielkes Stellvertreter Gerhard Neiber noch 2002 in dem zweibändigen Rechtfertigungsversuch „Die Sicherheit“: „Der Bauingenieur Arno Bade steckte am 16. Februar 1955 die neuen Sendesäle des DDR-Rundfunks in Berlin-Oberschöneweide in Brand.“
Doch was geschah wirklich an jenem Tag?
Die Brandnacht
Am 16. Februar 1955, einem Mittwoch, herrscht im Funkhaus nach 18.00 Uhr normaler abendlicher Betrieb. Im ersten Stock laufen die Bänder für das Erste und Zweite Berliner Programm und den wiedererweckten Deutschlandsender, im fünften Stock zieht sich eine Versammlung hin, in der Kantine sitzen Journalisten beim Bier und warten darauf, zur Sporthalle in der Stalinallee zu fahren. Die öffentliche Veranstaltung „Da lacht der Bär“ ist die populärste Rundfunksendung in der DDR.
Was sich dann ereignet, ist später den Berichten von Zeitzeugen und der Dokumentation „Großbrand Staatliches Rundfunkkomitee Berlin – Oberschöneweide 16. 2. 55“ zu entnehmen, die seit der deutschen Einheit zum Archiv der Polizeihistorischen Sammlung Berlin gehört. In einem Zimmer am Übergang zur Baustelle Block B erlischt plötzlich das Licht. Aus der Flügeltür am Ende des Ganges quillt eine Qualmwolke. „Feuer!“, schreit jemand.
Die erste Meldung über das Ereignis stammt vom Heizungskontrolleur Franz Tilkowski. Der hat bei seinem Rundgang vor den Klimaanlagen den Geruch brennenden Holzes wahrgenommen und durch die offene Eisentür zur Druckkammer der Klimaanlage II einen Feuerschein bemerkt. Er rennt durch die nahe Bautür zum Block A, um die Betriebsfeuerwehr zu alarmieren. Deren Schichtführer weiß, dass seine drei Männer – der Älteste ist 71 Jahre alt – einem größeren Brand hilflos gegenüberstehen würden. Außerdem kennt niemand den Grundriss des verwinkelten Neubaus. Um überhaupt etwas zu tun, schickt er seine Leute mit Handfeuerlöschern zum Brandort. Ihnen quellen Rauchschwaden entgegen. Aus der Tür der Klimakammer schlagen helle Flammen. Jeder Angriff mit den Handfeuerlöschern ist nutzlos. Um 19.01 Uhr meldet der Schichtführer dem Kommando Feuerwehr Köpenick telefonisch das Feuer.
Auch die Redakteure der Nachrichtenabteilung haben derweil den Brand im Block B bemerkt. Sie öffnen mit Gewalt die verschlossenen Flügeltüren zum Übergang. Dicker Qualm nimmt ihnen den Atem.
Inzwischen haben sich die Journalisten aus der Kantine und die Versammlungsteilnehmer in den Hof gerettet. Es ist kalt, minus vier Grad, ein böiger Wind weht Eisnadeln über das verschneite Gelände. Hinter den Glasscheiben des Neubaus lodert Feuer. „Werft die Fenster ein, damit der Qualm abzieht!“, ruft jemand. Die Aufforderung begünstigt später die Legende, der Brandstifter hätte sich mitten unter den Angestellten befunden. Als das Glas splittert, facht die einströmende Luft den Brand an.
Gegen 19.15 Uhr trifft der erste Löschzug der Feuerwehr ein. In den nächsten Stunden kommen sechs weitere Züge aus ganz Ost-Berlin hinzu. Ein mühsamer Kampf beginnt: Die Hydranten sind vereist, überall liegt Baumaterial unter dem Schnee, und niemand weiß, wie man überhaupt in das Gebäude gelangen kann. Trotzdem erreichen einige Feuerwehrmänner den Gang vor der Klimakammer. Es gelingt, die Zwischendecke aus verputztem Schilf neben der Druckkammer, in der die Schallschutzverkleidung in hellen Flammen steht, zu durchstoßen. Darüber brennen Kanthölzer lichterloh. Die Feuerwehrleute, die in dem unbeleuchteten Bau auf eine vage Grundrissskizze angewiesen sind, wissen nicht, wie weit sich das Kanalsystem der Klimaanlagen durch das Gebäude zieht und wie weit das Feuer bereits vorgedrungen ist. Erst gegen 22.00 Uhr werden die Bauzeichnungen gesichert.
Um 19.30 Uhr trifft der Kriminal-Dauerdienst der Volkspolizei-Inspektion (VPI) Köpenick ein, die Brandkommission im Polizeipräsidium wird verständigt, hochrangige VP-Offiziere rücken an. Das Feuer hat inzwischen auf den Saal II übergegriffen. Die rund 4000 Kubikmeter umbauter Raum sind fast vollständig mit Holz ausgekleidet, das nicht feuerhemmend imprägniert ist.
Die Feuerwehrleute versuchen die Flammen einzudämmen, scheitern jedoch an der Rauchentwicklung und der gewaltigen Hitze. Glut und hölzerne Deckenteile fallen herab. Gegen 21.00 Uhr stellt man die Brandbekämpfung im Saal ein und konzentriert sich auf das Feuer in den Zwischendecken und im Kanalsystem der Klimaanlage. Längst ist der Block B großräumig abgeriegelt. Niemand außer den Sicherheitskräften und der Feuerwehr darf das Gelände betreten oder verlassen.
VP-Oberkommissar W. schreibt eine Strafanzeige und eröffnet das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt gemäß Paragraf 306 und 308 StGB (Schwere Brandstiftung und Brandstiftung).
Gegen 20.45 Uhr werden die ersten Zeugen vernommen. Zunächst führt die Brandkommission der Kripo die Untersuchungen, die Staatssicherheit ist jedoch von Anfang an einbezogen.
Die Rundfunkmitarbeiter dürfen nach eingehenden Leibesvisitationen nach Mitternacht das Gelände verlassen. Der Brand wütet weiter. Gegen 1.30 Uhr wird festgestellt, dass die Zwischendecke mit dem Hauptlüftungskanal unter dem Großen Saal brennt. Der Saal I, mit 23 mal 40 Metern Grundfläche und einer Höhe von 14 Metern, ist mit einem Rüsterholzpaneel und Schallschluckflächen unter Holzgittern ausgekleidet. Flammen züngeln an der mit 200 Kubikmetern Holz eingerüsteten Orgelwand. Das Feuer hat sich durch die zersprungenen Regiefenster vom Saal II einen Weg gesucht. Ungehindert frisst es sich an den Wänden entlang.
Auf dem Dach öffnen die Löschmannschaften unter erheblichen Schwierigkeiten die Rauchklappen über den Sälen. Später gelingt es, die Hängedecke des Großen Saals zu kühlen und Holzteile abzulöschen. Insgesamt werden vier B-Rohre und zwölf C-Rohre eingesetzt. Von den 217 Feuerwehrleuten erleiden 9 leichte und 2 schwere Rauchvergiftungen.
Gegen 6.30 Uhr erkämpfen die Löschtrupps die Zugänge zu den beiden Sälen. Bald flackern nur noch einzelne Brandnester, und das volle Ausmaß der Schäden wird sichtbar.
Ein vager Verdacht
Am Donnerstagmorgen liegt das verschneite Spreeufer friedlich in der Morgendämmerung. In der Nacht ist das Sturmtief Zoe mit Windstärke acht über die Stadt gefegt. Am Steg in Baumschulenweg tuckert die Motorfähre im Leerlauf. Fröstelnd drängen die Fahrgäste ins Innere. Jemand erzählt einen Witz, den Heinz Quermann gestern Abend im „lachenden Bär“ zum Besten gegeben hat.
„Guck mal da!“, sagt plötzlich einer. „Der Qualm über dem Funkhaus.“
„Das brennt schon seit gestern Abend“, meint der Fährmann. „Muss’n mächtiges Feuer sein.“
Der schlanke junge Mann mit Aktentasche, der als einer der Letzten an Bord gekommen ist, schaut nach links, wo über den roten Klinkerbauten eine Rauchwolke wabert. Das ist nicht der gewohnte Ruß aus dem nahen Kraftwerk Klingenberg. Die Leute um ihn herum geraten in Aufregung. Dass es dort brennt, ist ihnen nicht gleichgültig. Sie alle arbeiten in dem neuen Funkhaus.
Auch der junge Mann mit der Aktentasche ist betroffen. Für den Konstrukteur Arno Bade ist es der erste große Bau, an dem er mitarbeitet. Sofort denkt er daran, dass nach solch einem Brand die Suche nach Schuldigen beginnen würde. Arno Bade kennt die vielen Fallen in der geteilten Stadt. Am Abend zuvor war er mit seiner Freundin in Neukölln im Kino. In West-Berlin also. Er fingert die Kinokarten aus seiner Tasche und wirft sie ins Wasser. Als die Fähre anlegt, hastet er mit den anderen in Richtung Funkhaus. Vielleicht kann er ja irgendwo behilflich sein.
Obwohl noch jung, hat Arno Bade schon einiges erlebt. Als 16-Jähriger musste er als Flakhelfer dienen, dann folgten die amerikanische Gefangenschaft und die bitteren Nachkriegsjahre. Dennoch machte er seinen Weg, hatte an der Gauß-Schule studiert und im Konstruktionsbüro von Franz Ehrlich Arbeit gefunden, kaum eine Viertelstunde entfernt von Mutters Wohnung in Baumschulenweg, wo er noch immer lebt. Im August würde er 27 Jahre alt. Alles lief gut.
Vor dem Pförtnerhäuschen hat sich eine Schlange gebildet. Das Kommando führt ein Mann in der blauen Uniform der Betriebskampfgruppe mit roter Armbinde – ein „bewährter Kader“: Ernst Buschmann (1914 – 1996), Kommunist, „Commandante Ernesto“ des Etkar-André-Bataillons in Spanien, Oberstleutnant im französischen Maquis und von den Amerikanern als Fallschirmagent ausgebildet. Inzwischen ist er Chefredakteur beim Deutschlandsender. Später wird Buschmann eine führende Rolle in der westdeutschen Friedensbewegung einnehmen und die Jahre in der DDR nicht mehr erwähnen. Jetzt jedoch hat er das Gefühl, den Klassenfeind persönlich entlarven zu müssen.
„Alle Bauarbeiter und alle Mitarbeiter des Hauses versammeln sich bitte im Block A zu einer Besprechung“, sagt er, als Bade an der Reihe ist.
Der weist seinen Dienstausweis vor. „Ich bin von der Aufbauleitung“, fügt er erklärend hinzu. Er arbeitet erst seit vierzehn Tagen auf dem Gelände.
Ernst Buschmann stutzt. „Können wir mal in Ihre Tasche schauen?“
„Ja, selbstverständlich.“
Beruhigt denkt Arno Bade an die gerade noch rechtzeitig verschwundenen Kinokarten. Doch der Kontrolleur begnügt sich nicht mit einem flüchtigen Blick. Er durchstöbert die vorderen Fächer seiner Tasche und findet einen Zettel mit einem Gedicht. Das macht ihn misstrauisch. In seiner späteren schriftlichen Meldung bezeichnet Buschmann die Reime als im „nazistisch-amerikanischen Soldatenjargon“ verfasst. Der Klassenkämpfer hat Blut geleckt. Aus dem Dokumentenfach der Tasche zieht er eine zusammengefaltete Zeitung hervor. Bade erschrickt: Der West-Berliner „Telegraf“! Er hatte das im Osten so verhasste Blatt einfach vergessen. „Berija hingerichtet“, steht da balkendick. „Malenkow beseitigte den Rivalen“. Die Zeitung war gut ein Jahr alt.
Buschmann knallt das Blatt auf den Tisch. „Ach, so einer sind Sie!“, sagt er schneidend.
Arno Bade ist nicht auf den Mund gefallen. „Was denken Sie denn von mir! Das ist ein reiner Zufall, dass ich die Zeitung bei mir habe. Sie könnten mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie die verschwinden lassen.“
„Das kann ich mir vorstellen!“ Der eifrige Kontrolleur steckt Bades Ausweis ein.
Der junge Mann ist blass geworden. „Machen Sie doch wegen der Geschichte nicht so ein Aufsehen“, sagt er. „Können Sie die Sache nicht unter den Tisch fallen lassen? Sie machen mir ja alles kaputt. Ich habe hier gerade erst angefangen …“
Doch Ernst Buschmann spürt Oberwasser. „Ach so! Jetzt wollen Sie mich wohl auch noch bestechen!“ Der „alte Kämpfer“ fühlt sich in seinem Element.
Das erste Verhör
Zur gleichen Zeit ist Wolfgang Kleinert, stellvertretender Vorsitzender des Staatlichen Rundfunkkomitees und später Intendant des Senders Radio DDR, mit dem Diktat eines streng vertraulichen Berichts an Walter Ulbricht beschäftigt. Kleinert steht unter Druck, schließlich muss er das „Besondere Vorkommnis“ erklären. „Meines Erachtens liegt Sabotage vor, da gegen 19.30 Uhr der Chef vom Dienst des Funkhauses einen fingierten Anruf angeblich aus der Sporthalle in der Stalinallee erhielt, mit der Aufforderung, sofort 30 – 40 Genossen aus dem Funkhaus zur Sporthalle zu senden zur Sicherung einer öffentlichen Veranstaltung, die am 16.2. abends von uns dort durchgeführt wurde. Der Chef vom Dienst, der sofort zur Sporthalle zurückrief … erfuhr, daß alles normal verlaufe und keine Kräfte zur Sicherung der Veranstaltung nötig seien.“ Dies war also nichts weiter als eine Vermutung.
Derweil wird Bade in Kleinerts Büro geführt und dort einem Mann übergeben, der sich ihm nicht vorstellt. Stumm durchwühlt er die Aktentasche noch einmal und stößt auf Bades Notizbuch. Der denkt sofort an die siebenstelligen Telefonnummern in der Kladde, und prompt fragt der schweigsame Mann: „Was ist das für eine Nummer?“
„Von einem Freund …“, antwortet Bade vage.
„Wo arbeitet der? In West-Berlin?“
„Bei den Amerikanern …“ Der junge Konstrukteur spürt die Gefahr, aber unwahre Angaben könnten ihn jetzt nur noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Er druckst herum.
„Und diese Nummer hier? Was macht der?“
„Er studiert an der Hochschule für Politische Wissenschaften. Mehr weiß ich nicht.“
Sein Gegenüber rafft alle Sachen zusammen und verlässt mit der Tasche den Raum.
Bade wird im Sitzungsraum A 505 festgesetzt. Als Bewachung bleibt ein betagter Betriebsschutzposten zurück. Stunden vergehen. Der junge Mann sitzt wie auf glühenden Kohlen. Außerdem muss er auf die Toilette. Der Posten geht an der Tür auf und ab, die Hand an der Pistolentasche.
Der Arrestant nimmt all seinen Mut zusammen. „Wenn Sie mich nicht zur Toilette lassen, rufe ich Ihren Vorgesetzten an!“
Das Telefon steht auf dem Tisch. Er nimmt den Hörer ab. Der Posten reagiert nicht. Nun wählt Arno Bade die Nummer einer Ost-Berliner Bekannten. „Du, hör mal, Ingrid“, sagt er. „Geh doch mal schnell zu meiner Mutter rüber. Schöne Grüße. Ich werde heute Abend mit Sicherheit nicht nach Hause kommen. Die haben mich hier festgesetzt.“ Er blickt zu dem Mann an der Tür. Der tut, als bemerke er nichts. „Meine Mutter soll doch mal den Schreibtisch durchgucken und ein bisschen sortieren …“ Siedend heiß ist ihm, als er an die politischen Broschüren und das antikommunistische Satireblatt „Tarantel“ aus West-Berlin denkt. Weshalb hat er das bloß alles aufgehoben? Hoffentlich würde Mutter richtig reagieren!
Gegen Mittag taucht eine Gruppe junger, durchtrainierter Männer auf, die genau so aussehen, wie es ihr Beruf verlangt: zwei im Ledermantel, der eine mit Schlapphut. „Mit wem haben Sie telefoniert?“
„Ich habe meine Mutter angerufen.“
„Mensch!“, schreit der Chef der Gruppe. „Wie konnten Sie denn so was machen? Sie belasten sich doch nur damit!“ Er macht auf dem Absatz kehrt, die Truppe hinter ihm her.
Bade weiß: Jetzt fahren sie nach Baumschulenweg und stellen die Wohnung auf den Kopf.
Ermittlungen der Polizei
Im Block B sind inzwischen die Aufräumungsarbeiten in vollem Gange. Kriminaltechniker sichern Brandschuttproben aus dem restlos ausgebrannten Kleinen Saal und aus der Druckkammer der Klimaanlage II. Ohne Zweifel ist der Brand in dem schmalen, etwa zehn Meter langen Raum entstanden. An der Wand sind in zwei Metern Höhe Spuren der größten Hitze zu erkennen. Hier brannte es am längsten. Die Schallschutzverkleidung ist gänzlich zerstört, das Feuer hat die Oberfläche der Ziegel angegriffen. Die Verkleidung aus mit Nesselstoff abgedeckter Glaswolle und mit perforierter Presspappe benagelten Holzrahmen brannte wie Zunder. Monteure waren unmittelbar vor dem Brand in der Klimaanlage I mit dem Auskleiden der Kanäle mit Blechplatten beschäftigt. In der Anlage II fehlte die Verkleidung noch.
Knapp zwei Meter entfernt von der Eisentür, durch die der Heizungskontrolleur das Feuer als Erster bemerkt hat, findet sich im Brandschutt der Sockel einer Glühlampe in einer Fassung, von der drei Aluminiumadern zu einem Steckerbrett führen. Geschmolzene Glaswollreste beweisen, dass die Hitze hier am größten war. Das Feuer hat sich durch die starke Sogwirkung in den Hauptlüftungskanal zum Kleinen Saal ausgebreitet – am Boden und links von der Tür sind Reste der Verkleidung und der Bodenleisten erhalten. Eine zwei Meter neben dem Brandherd an der Wand lehnende Leiter ist nur an der oberen rechten Seite etwas verbrannt.
Im Funkhaus konzentrieren sich die Vernehmungen der Kripo nun auf die Bauarbeiter, die am 16. Februar in der Druckkammer tätig waren: zwei Betonierer, die Teile des Fußbodens gossen, ein Rohrisolierer, ein Maurer, der Reparaturarbeiten ausführte.
Am besagten Tag kontrollierte der Oberpolier die Arbeiter um 16.25 Uhr und sah Licht in der Druckkammer. Den Raum mit dem frischen Betonfußboden betrat er nicht. Ein Installateur der Firma Sanar Halle, der zwischen 15.30 und 16.15 Uhr zwei Meter entfernt von der halb geöffneten Eisentür zum Druckraum II geschweißt hatte, arbeitete bis gegen 18.00 Uhr – die Monteure hörten seine Hammerschläge. Dann verließ er die Baustelle und fuhr nach Hause.
Diese Schweißarbeiten, vorschriftswidrig ohne Information der Betriebsfeuerwehr und ohne Brandschutzposten ausgeführt, werfen ein bezeichnendes Licht auf die Sicherheitsmängel auf der Baustelle. Die Baubeleuchtung bestand wegen des Mangels an Kupferleitungen nur aus Provisorien. Bereits am 15. Oktober 1953, also anderthalb Jahre zuvor, hatte der Brandschutzverantwortliche besonders gravierende Mängel aufgelistet. Im Verlauf der Untersuchungen stellt sich heraus, dass sich bis zum Herbst 1954 im Block B fünf – stets rechtzeitig bemerkte – Schwelbrände ereigneten. Am 18. November 1954 hatten die verantwortlichen Bauleiter Metz und Kühne sogar ein Schreiben an den volkseigenen Betrieb (VEB) Anlagenbau gerichtet: „Bei einer Baubegehung wurde festgestellt, daß Glühbirnen der Baubeleuchtung unbeaufsichtigt auf Holzteilen liegen. Dadurch besteht die Gefahr eines Brandes. Bis Sonnabend, dem 20. 11. 1954 sind sämtliche Glühbirnen der Baubeleuchtung, die keinen Schirm haben, zu entfernen oder mit einem Schirm zu versehen.“
Trotzdem änderte sich nichts an der Schlamperei. Wenige Tage vor dem Brand beauftragte Kühne deshalb den Elektromonteur der Klimaanlage Otto H., Taubenotto genannt, täglich nach Arbeitsschluss alle Stromverbraucher auf der Baustelle auszuschalten und ihm den Vollzug zu melden. Auch am 16. Februar unterbrach Taubenotto gegen 16.50 Uhr die Stromversorgung in der Klimaanlage, schaltete sie jedoch wieder ein, weil die Termine drückten und die Monteure an diesem Tag noch die Blechverkleidung in der Klimaanlage fertigstellen wollten. Deshalb arbeiteten sie bis 18.05 Uhr, holten sich dann etwas zu essen und entdeckten wenig später das Feuer.
Die Befragungen der Bauarbeiter bringen ans Licht, welche Zustände auf dem Bau herrschten. Am letzten Zahltag, dem 10. Februar, waren sechs Kollegen entlassen worden, die nach reichlichem Alkoholgenuss „Reden gegen unsere Ordnung“ geführt hatten. Nachdem die Betroffenen Besserung gelobt hatten, wurden die Kündigungen am 11. Februar zurückgenommen.
Im Funkhaus jagt am 17. Februar 1955 ein Gerücht das nächste. Auf eilends einberufenen Versammlungen hat jeder seine Empörung über den sogenannten Sabotageakt zu äußern. Niemand wagt, diese Vermutung zu bezweifeln.
Bei einer ersten Beratung, an der Architekt Ehrlich und Bauleiter Kühne teilnehmen, werden folgende Schäden errechnet:
| 10 Prozent vom Rohbau | 300 000 Mark |
| Neuausbau Säle, Regien, Nebenräume | 1 350 000 Mark |
| Klima-Kanäle | 200 000 Mark |
| Klima-Anlage geschätzt | 150 000 Mark |
| Technik (restlos vernichtet) | 400 000 Mark |
Die der Versicherung gemeldete Schadenssumme von 2,7 Millionen Mark wurde später bezahlt. Unklar bleibt, was mit den Spendengeldern der Mitarbeiter geschah, die zum Teil bis Dezember 1955 ein Prozent ihres Monatseinkommens „freiwillig“ opferten. Künstler verpflichteten sich sogar zur Abgabe von zehn Prozent ihrer Honorare. Im Rundfunkarchiv befindet sich bis heute ein uneingelöster Scheck der Brecht-Witwe Helene Weigel vom 28. März 1955 über 94,60 Mark.
Im U-Boot in Hohenschönhausen
Arno Bade wird am Abend von der Staatssicherheit abtransportiert. Die Hände auf dem Rücken gefesselt, hockt er zwischen zwei Bewachern im Fond eines EMW. Man setzt ihm eine Motorradbrille mit schwarzen Gläsern auf, damit er nicht erkennt, wohin man ihn bringt.
Im berüchtigten „U-Boot“, den Keller-Zellen im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, muss er sich nackt ausziehen und bekommt eine schäbige Zuchthauskluft. Dann folgt die erste Nachtvernehmung. Uniformierte Offiziere fragen ihn immer wieder nach Familie, Freunden, nach seinem Studium, der Arbeit, den Ereignissen des 16. Februar. Irgendwann zwischen 5.00 und 6.00 Uhr morgens führt man ihn in eine Zelle, die nur durch einen abgedeckten Lichtschacht mit der Außenwelt verbunden ist.
Kaum hat Bade sich auf der Pritsche ausgestreckt, wird er zur nächsten Vernehmung geholt. Nun ziehen drei „Spezialisten“ alle Register und belegen ihn mit gemeinsten Beschimpfungen. So geht es in den nächsten Tagen und Nächten weiter, immer wieder drohen sie dem jungen Mann mit der Todesstrafe.
Erschüttert erinnert sich der Delinquent noch vierzig Jahre später an jedes Wort: „Sie werden die Sache schon rekonstruieren. Ich hätte keine andere Chance mehr … Ich wüsste doch als politisch aufgeklärter Mensch, was wir mit unseren Gegnern machen. Die werden zerbrochen! Die werden fertiggemacht!“
Bade weiß damals, dass die Todesstrafe keine leere Drohung ist. Ein Bekannter, der Reichsbahndisponent Ewald Misera, hat sich im November 1954 in einem Schauprozess vor laufenden DEFA-Kameras sichtbar angeschlagen der Spionage für schuldig bekannt und ist zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Bade hat die Wochenschau gesehen. Die Namen des gefürchteten Generalstaatsanwalts Ernst Melsheimer und der berüchtigten Justizministerin Hilde Benjamin und deren drakonische Strafen sind ihm so gut bekannt wie jedem anderem in der DDR. Damals sagt man ihm: „Sie werden Gelegenheit haben, mit Melsheimer zu sprechen! Aber erst, wenn Sie ein umfangreiches Geständnis abgelegt haben.“
Obwohl nach den ersten Ermittlungen keinerlei konkrete Anhaltspunkte für eine Brandstiftung sprechen, bleibt Bade in Haft. Im Bericht der Hauptabteilung Kriminalpolizei vom 18. Februar 1955 heißt es:
Folgende Hinweise liegen in vorsätzlicher Richtung vor: 1.) Am 16. 2. 1955 folgende Anruf an den Chef vom Dienst … 2.) Am 17. 2. 1955 07.45 Uhr stellte bei der angeordneten Personen- und Taschenkontrolle ein Mitglied der Kampfgruppe bei dem Bauleiter Bade – tätig innerhalb des Brandobjektes gewesen – eine Hetzzeitung innerhalb der Aktentasche „Telegraf“ vom 24. 12. 1954 mit den Schlagzeilen „Berija hingerichtet – Malenko beseitigt den Piraten“ fest. Die nach der Festnahme durchgeführte Wohnungsdurchsuchung ergab Flugblätter, ein Schlagring und bereits im Ofen verbrannte Hetzblätter. Die Genossen SFS [des Staatssekretariats für Staatssicherheit, J. E.] haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Ferner steht einwandfrei fest, daß B. in den Nachmittagsstunden, etwa zwei Stunden vor Feststellung der ersten Flammenbildung sich in unmittelbarer Nähe der Brandentstehungsstelle befand. 3.) In der westberliner Hetzpresse wurde bereits am 17. Febr. 55, also wenige Stunden nach dem Brandausbruch eine Meldung über den Brand im Staatlichen Rundfunkkomitee mit verschiedenen Einzelheiten gebracht, die nur von einer gut eingeweihten Person in dieser kurzen Zeitspanne der Westpresse übermittelt worden sein muß.