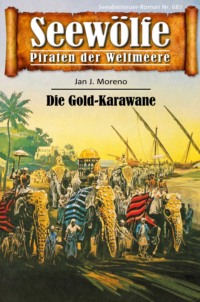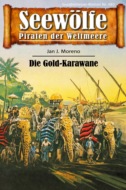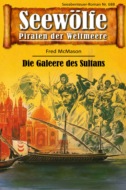Kitabı oku: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 687»
Impressum
© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-96688-101-2
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Jan J. Moreno
Die Gold-Karawane
Vor Madras werden die Arwenacks in einen Hinterhalt gelockt
Als hätte die Abendsonne sie ausgespuckt, bahnten sie sich ihren Weg durch das dicht verfilzte Elefantengras. Die Schatten wurden länger, und über dem hügeligen Land lag ein eigenartig roter Schein. Das Wasser des nahen Flusses wirkte wie ein Strom von Blut.
Noch konnte der auffrischende Ostwind, der den Geruch des Meeres mit sich führte, die Hitze und den Staub des Tages nicht vertreiben.
Büffel suhlten sich im Schlamm einer weitläufigen Bucht. Ihr Hirte erstarrte, als er die Fremden sah, die bärtig und zerlumpt waren, aber bewaffnet wie das Heer eines Sultans. Eine junge Frau führte sie an.
„Phoolan Devi …“, ächzte der Hirte, warf sich herum und floh.
Er hatte einen Augenblick zu lange gezögert. Ein Pfeil traf ihn zwischen die Schulterblätter und tötete ihn, ehe er im Fluß versank …
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Die Hauptpersonen des Romans:
Phoolan Devi – sie ist eine Dacoit, nämlich eine Räuberin, und wo sie mit ihren Spießgesellen auftaucht, gibt es Mord und Totschlag.
Dilip Rangini – ist zwar der Vertraute eines Sultans, aber das hält ihn nicht davon ab, Verrat zu begehen.
Drawida Shastri – gibt sich als Sultan von Golkonda aus und verschwindet mit einer Goldkarawane.
Philip Hasard Killigrew – gerät mit seinen Arwenacks in eine Falle, als er eine angebliche Maharani befreien will.
1.
Samatrai war ein unbedeutender Ort zwischen Madras und Tirukkalikundram, leichter von See her als über Land zu erreichen. Drei Dutzend Hütten drängten sich auf engem Raum aneinander, umgeben von Dattelpalmen und an den Flußufern liegenden Feldern, auf denen Linsen und Senf angebaut wurden. Die übrige Fläche, erst vor kurzem gerodet und nun von hartem Gras bewachsen, gehörte den Schafen und Büffeln.
Nur zwei unbefestigte, zur Regenzeit unpassierbare Pfade verbanden Samatrai mit den größeren Orten. Kein Ochsenkarren hätte es je bis Madras geschafft.
Dennoch waren die Bewohner über vieles informiert, was entlang der Koromandelküste geschah. Sie kannten die schrecklichen Geschichten von Phoolan Devi und ihren Dacoits, die nur während der letzten Monate mehr Menschen getötet hatten, als ein einzelner an Fingern und Zehen abzählen konnte.
Phoolan, deren Name soviel bedeutete wie „Göttin der Blumen“, war etwa zwanzig Jahre alt, klein, aber kräftig gebaut, und mit üppigen Rundungen ausgestattet, die ihre auffällig blasse Hautfarbe überspielten.
Niemand in Samatrai ahnte, welche Gefahr drohte. Die Männer dösten oder reparierten Feldwerkzeuge, die Frauen saßen beieinander und palaverten beim Teigkneten oder der Läusejagd auf den Köpfen ihrer Kinder. Irgendwo bellte ein Hund, doch niemand achtete darauf.
Zu dem Zeitpunkt kreisten zehn Dacoits das Dorf ein. Niemand sollte Gelegenheit zur Flucht erhalten.
„Die anderen folgen mir!“ befahl Phoolan. „Durchsucht die Häuser und nehmt euch von mir aus, was ihr wollt, aber laßt die beiden Verräter nicht entrinnen. Erschlagt sie und jeden, der ihnen Unterschlupf gewährt.“
Sie standen vor dem geschnitzten Dorfaltar, der Schiwa, den Gott der Vernichtung darstellte, und berührten nacheinander und um Segen bittend, seinen Dreizack.
In der Rechten einen krummen Gurkhadolch, in der Linken eine von Portugiesen erbeutete Steinschloßpistole, stürmte Phoolan vor ihren Leuten her.
Die Bewohner Samatrais wurden völlig überrascht. Ein älterer Mann versuchte, sie mit einer Sense niederzustrecken – die Dacoit stieß ihm im Laufen den Dolch in die Seite, daß er lautlos zusammenbrach.
Sie schwang sich auf den gemauerten Rand des Dorfbrunnens, sich des Eindrucks bewußt, den sie bei den entsetzten Menschen hinterließ. In Situationen wie dieser, wenn ihr Gesicht fiebrig glühte, genoß sie ihre Macht. Es bedurfte nur eines Wortes von ihr, und Samatrai wurde niedergebrannt und seine Bewohner in den Dschungel getrieben oder verschleppt.
„Hört mich an, ihr lausiges Pack!“ schrie sie mit gellender Stimme. Früher – wie lange lag das schon zurück? – hatte sie leiser geredet, mit der gebotenen Zurückhaltung, doch der Umgang mit den Banditen, die in allen Frauen nur eine willfährige Beute sahen, hatte sie geprägt. „Wenn ihr morgen noch leben wollt, schafft alles Wertvolle herbei. Und bringt mir Kushwant Shankar und Vijay Nain – ich weiß, daß die Verräter in euer Dorf geflohen sind.“
Einer der Männer, wahrscheinlich der Älteste, faßte sich ein Herz. Die Arme in einer hilflosen Geste ausgebreitet, trat er, zwei Schritte vor.
„Wir kennen dich, Phoolan Devi, und wenn die beiden Männer, die du suchst, bei uns wären, würden wir sie unverzüglich ausliefern.“
„Sie sind bei euch! Seit Tagen folgen wir ihren Spuren.“
Der Alte schüttelte das weiße Haupt. „Nein“, sagte er bestimmt, „du irrst …“
Die Frau bewegte kaum die rechte Hand. Alles ging blitzschnell. Der Krummdolch sauste durch die Luft und bohrte sich zwischen die Rippen des Mannes. Niemand anderes als Phoolan hätte die Waffe so handhaben können.
Der Dorfälteste ließ ein ersticktes Ächzen vernehmen, seine Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen.
„Du – suchst am – falschen Ort … Verschone die Menschen …“
Unmittelbar vor dem Brunnen brach er zusammen, versuchte noch einmal kraftlos, sich aufzurichten, und blieb dann reglos liegen. Phoolan hatte nur einen verächtlichen Blick für ihn.
Sie gab ihren Männern einen befehlenden Wink.
„Ich will die Verräter! Sofort!“
Die Dacoit blieb beim Brunnen und beschränkte sich aufs Beobachten, während ihre Kerle die Häuser durchsuchten und plünderten.
Den Frauen wurden die Ohrringe und die silbernen Arm- und Fußreifen abgenommen. Auch ein bißchen Geld fand sich in den absonderlichsten Verstecken. Frauen, deren Männer sich zur Wehr setzten, spürten die Wut der Räuber besonders.
Nach einer Stunde gab es wohl keinen Stein in Samatrai, der nicht umgedreht worden wäre. Mit bebender Stimme fragte Phoolan Devi noch einmal nach den Gesuchten, die bis vor kurzem zu ihrer Bande gehört hatten, aber die Dörfler behaupteten, seit Wochen keine Fremden gesehen zu haben.
Phoolan war höchst unzufrieden, und in ihrem Zorn wurde sie stets unberechenbar.
„Ihr lügt!“ schrie sie mit sich überschlagender Stimme. „Kushwant Shankar und Vijay Nain sind hier! Gebt sie heraus, dann geschieht euch nichts mehr.“
„Wie können wir etwas herausgeben, was wir nie gesehen haben, Herrin?“
Phoolan Devi vollführte eine unmißverständliche Bewegung mit dem noch blutigen Gurkhadolch.
„Nehmt die jungen Burschen mit!“ herrschte sie ihre Dacoits an. „Ich werde dieses Pack lehren, die Wahrheit zu sagen.“
Johlend zerrten die Bandenmitglieder neun junge Männer auf den Dorfplatz. Sie gingen alles andere als sanft mit ihnen um.
„Hab Erbarmen, Herrin! Mein einziger Sohn …“ Jammernd sank ein altes Weib auf die Knie und drückte die Stirn in den Staub. „Wir haben nichts Unrechtes getan.“
Phoolan verzog das Gesicht und spuckte verächtlich aus.
„Ich kann dir nicht helfen, meine Sorgen sind bestimmt größer als die deinen. Hör also auf zu jammern, davon wird nichts besser.“
„Herrin …!“
Die Dacoit und ihre Leute verließen das Dorf und schleppten die jungen Männer mit sich. Niemand wagte, sich ihnen entgegenzustellen.
„Na, los doch!“ schrie Phoolan, als sie das letzte Haus vor sich sah. „Greift an, tötet uns! Ich weiß, wie gern ihr jetzt über uns herfallen würdet. Aber selbst dazu seid ihr zu feige.“ Sie brach in schallendes Gelächter aus, das noch eine Weile zu vernehmen war.
Die beginnende Nacht verschluckte die Räuberbande, die den Pfad zum nahen Fluß nahm. Es dauerte lange, bis einige Dörfler das lähmende Entsetzen überwanden.
„Das Weib ist schlimmer als ein reißender Tiger. Phoolan Devi wird unsere Söhne töten und bald nach neuen Opfern suchen. Sie ist unersättlich.“
„Was können wir tun? Allein sind wir zu schwach. Wollt ihr es mit Dreschflegeln, Sensen und Mistgabeln mit der Bande aufnehmen?“
„Sie ist der Teufel in Menschengestalt. Niemand hat sie je im Kampf besiegt.“
„Dann müssen wir beten, damit uns die Götter beistehen und Phoolan verderben.“
Vom Fluß her peitschte ein Schuß durch die Nacht. Für einige Augenblicke herrschte entsetzte, atemlose Stille. Jeder fürchtete, gleich weitere Schüsse zu hören.
„Wollt ihr das?“ keuchte die alte Frau, die sich vor der Dacoit erniedrigt und in den Staub geworfen hatte. „Wenn wir Ohren und Augen verschließen und uns verkriechen, statt uns zur Wehr zu setzen, haben wir es allerdings nicht besser verdient. Was soll aus Samatrai werden ohne unsere Söhne?“
Sie hatte Mühe, ihr Zittern zu verbergen, als sie nach einer dreizackigen hölzernen Forke griff, die an einer Hauswand lehnte.
„Den Mist kann ich damit aufspießen – warum nicht auch dieses verfluchte Mordweib?“
Sie hatte nichts zu verlieren außer ihrem Leben. Die anderen schon, sie versuchten sogar, die Alte zurückzuhalten.
„Du wirst uns alle ans Messer liefern, Ramkali. Du bist verrückt. Geh nicht weiter!“
„Ich weiß, was ich tue – im Gegensatz zu euch.“ Mit der Mistgabel stieß die Frau nach zwei Männern, die ihr den Weg vertraten. Sie entwickelte plötzlich Kräfte, die ihr niemand zugetraut hätte. „Dein Sohn ist auch dabei, Shri Ram Singh, und deiner, Gurh Datta. Wollt ihr euch später vorwerfen, sie in den Tod geschickt zu haben?“
Ein zweiter Schuß fiel. Zumindest Singh wußte, daß die alte Ramkali recht hatte und es wenig nutzte, den Kopf in den Sand zu stecken. Nur wenn sie entschlossen zusammenhielten, hatten sie eine Chance.
Er besaß ein altes schartiges Krummschwert, das die Dacoits verächtlich zurückgelassen hatten. Eine solche Waffe war immerhin besser als gar keine, und als er sie holte und Ramkali folgte, hatte er das Gefühl, daß sich das Schwert wie etwas Lebendiges in seine Hand schmiegte.
Mehr Männer und Frauen folgten ihnen. Keiner redete, ihre Gesichter wirkten verschlossen und unnahbar, aber sie waren bereit, den Kampf aufzunehmen.
Phoolan Devi hatte inzwischen die neun jungen Männer an der Uferböschung aufstellen lassen. Sie hatte die Pistole auf einen von ihnen gerichtet und abgedrückt, im letzten Moment aber den Lauf gesenkt, so daß die Kugel lediglich vor seinen Füßen ins Erdreich gefahren war.
„Wo verstecken sich die beiden Schufte?“ fragte sie. „Heraus mit der Sprache!“
„Wir wissen es nicht.“
In aufwallendem Zorn schlug Phoolan dem nächsten die Faust ins Gesicht.
„Was haben Shankar und Nain euch versprochen, damit ihr sie nicht verratet?“
„Wir kennen beide nicht. Seit Monaten waren keine Fremden in Samatrai.“
Die Dacoit riß den Dolch aus der silbernen Scheide, die blitzende Klinge ritzte eine blutende Wunde quer über den nackten Oberkörper des jungen Mannes.
„Ich kann auch anders“, schnaubte sie wütend. „Also reizt mich nicht. Wo verbergen sich die Verräter? – Du“, sie setzte dem Jüngling den Dolch an die Kehle, „ich warte nicht länger.“
„Keiner von uns weiß es.“
Phoolan Devis Rechte zuckte vor. Sie tötete den Mann in Gedankenschnelle, daß er nicht mal Zeit zu einer abwehrenden Bewegung fand. „Dreht euch um, verdammt!“ keifte sie und traktierte den Toten mit Fußtritten, bis er die sanfte Böschung hinunter ins Wasser rollte.
Was folgte, war ein Massaker an Wehrlosen. Phoolan hatte es nicht gewollt, aber die sturen Bauern hatten es herausgefordert. So war es meistens. Die Dacoit fragte sich hin und wieder, ob die Menschen das Leben verachteten, weil sie es häufig so achtlos wegwarfen.
„Wir bleiben in der Nähe des Dorfes“, sagte sie. „Vielleicht finden wir die Spuren wieder, denen wir gefolgt sind.“
Kusum Bikram, einer der umsichtigsten Männer, deutete nach Westen, wo das Dorf hinter einem Hügel lag. Im fahlen Schein des Mondes und vor dem Sternenhintergrund waren Leute zu erkennen, die dem Pfad zum Fluß folgten.
„Ob das Pack endlich Einsicht zeigt?“ fragte Phoolan. „Es wäre an der Zeit, daß sie uns Shankar und Nain ausliefern.“
Sie irrte.
Während sie ihre Pistole nachlud, erkannte sie an der Spitze des Trupps das alte Weib. Einige Männer begannen über die Mistgabel und die anderen Waffen der Dörfler zu spotten. Sogar Dasyu Gujjar, der Unterführer, konnte sich eine entsprechende Bemerkung nicht verkneifen. Er hatte inzwischen ebenfalls seine Steinschloßpistole nachgeladen. Außer Phoolan und ihm besaß kein anderer eine Feuerwaffe.
Mittlerweile war der letzte Rest des Tageslichts geschwunden. Da die Leichen der Ermordeten am Fuß der knapp mannshohen Uferböschung im Brackwasser lagen, konnten die Näherkommenden nicht erkennen, was geschehen war. Gleichwohl hegten sie die schlimmsten Befürchtungen.
Die Dacoit raunte ihren Männern zu, daß sie sich zurückhalten sollten. Sie war hinter den Verrätern her, und, bei allen Göttern, sie würde ihrer habhaft werden.
Die weißhaarige Alte führte die Dörfler an. Unmittelbar hinter ihr folgten zwei kräftige Männer. Ihre Gesichter wirkten verschlossen – Phoolan deutete das als Furcht und war zufrieden. Die Alte selbst stellte keine Gefahr dar, und die Männer und Frauen hatten sich ihr wohl nur angeschlossen, damit sie im Dorf nicht jedes Ansehen verloren.
Phoolan Devi kannte die Probleme, die sich aus solch kleinen Gemeinschaften ergaben, aus eigener Anschauung. Sie war in einem Kaff mit wenig mehr als vierhundert Einwohnern aufgewachsen – als zweite Tochter einer Familie mit sieben Kindern, und erst das jüngste war ein Junge. Shivnarain, ihr Bruder, zählte inzwischen elf Sommer. Gern hätte Phoolan wenigstens ihn wiedergesehen, doch das war seit Jahren unmöglich, die Umstände waren dagegen.
Mit einer unwilligen Kopfbewegung schüttelte sie alle Erinnerungen ab. Die Geister der Vergangenheit, die sie in unregelmäßigen Abständen zu quälen begannen, ließen sich nicht leicht vertreiben.
„Gib unsere jungen Männer heraus!“ forderte die Alte.
Phoolan Devi lachte hell. „Willst du mir drohen? Siehst du nicht, wie sehr ich vor dir zittere?“
Die Mistgabel zuckte hoch. Mit aller Kraft, deren sie fähig war, stieß Ramkali zu, doch die Dacoit reagierte schneller. Sie wirbelte zur Seite, umklammerte den hölzernen Stiel unmittelbar hinter den Zinken und zerrte die Waffe herum, so daß die Angreiferin mitgerissen wurde und den Halt verlor. Ramkali stürzte vor Phoolans Füße, ein schmerzhafter Tritt traf sie an der Schulter und ließ sie bleich zusammensinken.
Die Decoit zerbrach die Mistgabel über dem Knie und warf die Bruchstücke den Männern entgegen, die noch zögerten, anzugreifen. Im nächsten Moment hielt sie ihre Pistole in Händen und zielte auf den mit dem rostigen Schwert.
„Ihr seid hier, um eure Söhne zu holen“, sagte sie scharf. „Sie liegen unten am Fluß. Meinetwegen nehmt sie mit, aber geht mir schnell aus den Augen. Und noch etwas: Ich verlange, daß mir bis Sonnenaufgang die Gesuchten übergeben werden. Wenn nicht, werdet ihr eure Verstocktheit bereuen.“
Wehklagen erklang vom Fuß der Böschung und zeugte vom Schmerz und der Hilflosigkeit der Dorfbewohner. In ihrer Verzweiflung waren sie kaum zu überbieten.
„Das war eine erste Warnung!“ rief Phoolan Devi. „Ich habe noch immer erhalten, was ich haben wollte.“
Die Nacht gehörte den Verstorbenen.
Samatrai hallte wider von den Totengesängen, und erst als der Morgen dämmerte, zog Ruhe ein.
Die Decoits hatten zu dem Zeitpunkt längst Stellung bezogen. Der erste, der das Dorf verlassen wollte, war der Ziegenhirte mit seiner Herde. Dasyu Gujjar wies den Mann schroff zurück.
„Aber die Tiere brauchen Futter.“
„Dann schlachtet sie eben. Das spart Arbeit und Mühe.“ Der Unterführer wollte sich schier vor Lachen ausschütten über das dumme Gesicht. Als er dann drei der fettesten Tiere aus der Herde aussonderte, begriff der Mann aber sehr schnell und trieb die anderen ins Dorf zurück.
„Wenn wir wieder Hunger haben, holen wir uns die nächsten!“ rief ihm Phoolan Devi hinterher.
Bis zum Mittag brieten die geschlachteten Ziegen über einem großen Feuer. Der Wind trieb den Bratenduft zwischen die Häuser, wo nur hin und wieder jemand zu sehen war – die Dörfler hatten sich furchtsam verkrochen, nachdem mehrere Versuche, Samatrai zu verlassen, vor den Waffen der Dacoits geendet hatten.
Sinnend blickte Gujjar in die Glut des langsam erlöschenden Feuers. „Warum räuchern wir das Pack nicht aus?“ Er zog einen halb verkohlten Knüppel aus der Asche und schwenkte ihn, bis die Flammen erneut aufloderten.
Da Phoolan nicht reagierte, lief er bis zur nächsten Hütte und warf das brennende Holz aufs Dach. In dem trockenen Palmblattgeflecht fanden die Flammen ausreichend Nahrung, breiteten sich gierig aus und züngelten fauchend in die Höhe. Innerhalb weniger Augenblicke brannte das Dach lichterloh, erste Glutnester sprangen auf Balken und Bretter über.
Schreiend stürzten die Bewohner ins Freie. Da das Feuer die anderen Hütten gefährdete, bildete sich im Nu eine Eimerkette. Aus dem Dorfbrunnen wurde Löschwasser geschöpft und weitergereicht. Die Dacoits spornten Männer, Frauen und Kinder mit höhnischen Rufen an.
Von zusammenbrechenden Stützbalken ausgehend, sprang das Feuer auf die nächste Hütte über. Federvieh stob kreischend ins Freie, einige Tiere wurden aber wie magisch vom Feuer angezogen und verbrannten.
Phoolan Devi übertönte mühelos den entstandenen Lärm, als sie lauthals schrie: „Das ist nur der Anfang! Ihr werdet uns erst los, wenn wir haben, was wir wollen!“
Mit untergeschlagenen Beinen hockte sie im Gras, kaute genußvoll auf einer schon kalt werdenden Keule und verfolgte fasziniert die verzweifelten Versuche der Bauern, ihr Dorf vor dem Feuer zu retten. Dabei schweiften ihre Gedanken immer mehr ab, und schon kurz darauf nahm sie das Geschehen ringsum nur noch unbewußt wahr.
Wie sooft in letzter Zeit sehnte sie sich nach einem Heim und nach etwas mehr Ruhe, als ihr das Räuberdasein zu bieten hatte. Aber das einzige, was sie tatsächlich noch mit früher verband, war die Erinnerung an ihren Bruder Shivnarain.
Mit elf war sie mit Mustaqueem, einem fünfzigjährigen Witwer, verheiratet worden. Doch sie war zu jung gewesen, ihm das geben zu können, wonach er sich sehnte, und war deshalb schon nach wenigen Tagen nach Hause zurückgekehrt.
Ein Jahr später hatten sie die Eltern wieder zu ihrem Mann geschickt. Diesmal hielt sie es nahezu ein halbes Jahr lang aus, fühlte sich dabei aber nicht glücklich, und irgendwann stahl sie sich heimlich davon, fest entschlossen, nie wieder zu Mustaqueem zurückzukehren.
Die Eltern waren über Phoolans Handlungsweise empört, weil ein Mädchen, das einen Mann verließ, große Schande über die Familie brachte. Ihre Mutter forderte sie nahezu täglich auf, in einen Brunnen zu springen oder sich anderswo zu ertränken, denn eine verheiratete Tochter könnte nicht bei ihren Eltern geduldet werden.
Vielleicht hätte sie sich sogar überreden lassen, Mustaqueem um Verzeihung zu bitten, wäre er nicht eines Tages erschienen, um allen geschenkten Silberschmuck zurückzufordern. Er hatte eine andere Frau geheiratet.
Von da an ging Phoolan ihre eigenen Wege. Liebschaften mit dem Sohn des Dorfvorstehers und anderen Burschen, mit denen sie sich in den Zuckerrohrfeldern vergnügte, stempelten sie in aller Öffentlichkeit zur Dirne ab. Die Familie war bloßgestellt und hatte keine andere Wahl, als Phoolan endgültig zu verbannen. Sie wurde nach Tirupati zu ihrer älteren Schwester geschickt, lernte dort aber Babu kennen, einen entfernten Vetter väterlicherseits, der verheiratet und Vater von drei Kindern war.
Sie hütete die Büffel ihrer Schwester und traf sich mit Babu – am Fluß, in den Feldern, am Waldrand. Es war eine schöne Zeit, in der Phoolan Devi Vergangenes vergaß. Sie gab Babu all das, was sie ihrem ersten Mann aus Scheu und Unkenntnis verweigert und von den Burschen in den Zuckerrohrfeldern gelernt hatte, aber nach Monaten des Glücks und der Zufriedenheit sträubte sie sich plötzlich. Babu sollte sie heiraten oder sie nie wieder berühren, mit ihrer Rolle als Geliebte wollte sie sich nicht länger zufriedengeben.
Tatsächlich ging er mit ihr nach Kanchipuram zu einem Schreiber, der für zwanzig Rupien ein Dokument aufsetzte und versicherte, daß sie nun Mann und Frau seien. Eine Woche lang lebten sie in Kanchipuram, dann beschloß Babu, wieder zu seiner Frau und den Kindern zurückzukehren. Für Phoolan brach eine Welt zusammen. Sie schwor, ihren Vetter umzubringen, doch seitdem hatte sie ihn nie wiedergesehen.
Gerade siebzehn Jahre alt, war sie doch schon von allen verstoßen. Ihre Eltern verabscheuten sie, ihr erster Mann hatte eine andere zur Frau genommen, und die zweite Ehe war von Anfang an ungültig und nur auf Lug und Trug aufgebaut gewesen.
In der Situation, verzweifelt und zu allem entschlossen, traf sie Dasyu Gujjar, Mitglied einer Bande von Räubern und Mördern. Er war kräftig, groß und sah gut aus. Seine Zuneigung zu Phoolan hatte er von Anfang an nicht verhehlt. Sie ging mit ihm.
Dasyus Stimme schreckte sie aus ihren Gedanken auf.
„Die Bauern wissen nichts“, sagte er, „sonst würden sie uns die Verräter ausliefern. Shankar und Nain jagen ihnen bestimmt nicht mehr Furcht ein als wir.“
Das Feuer war gelöscht, aber gerade deshalb schüttelte Phoolan Devi energisch den Kopf.
„Wir bleiben, solange ich das für nötig halte!“ entgegnete sie. „Wer anderer Meinung ist, soll es mir sagen.“
Eigenartigerweise mauserte sich die alte Ramkali zur Wortführerin der kleinen Dorfgemeinschaft. Auf die Weise gelang es ihr, den schmachvollen Tod ihres Sohnes wenigstens vorerst zu verdrängen.
Sie wußte, daß sie von den Dacoits keine Gnade zu erwarten hatten, und keiner der Männer und Frauen von Samatrai war im Umgang mit Waffen und im Kämpfen geübt.
„Wir müssen Hilfe herbeiholen“, sagte sie, nachdem das Feuer zwar gelöscht worden, der Wasserspiegel im Brunnen aber um gut zwei Ellen abgesunken war.
„Wie?“ fragte Gurh Datta. „Glaubst du wirklich, die Bande läßt einen von uns ungeschoren passieren, nachdem schon die Viehhirten zurückgewiesen wurden?“
„Das glaube ich nicht“, sagte Ramkali. „Aber ich weiß, daß wir alle sterben werden, wenn wir es nicht versuchen. Ist euch das lieber?“
Shri Ram Singh hatte demonstrativ sein rostiges Schwert in den Boden gerammt und stützte sich auf dem Heft ab.
„Können wir überhaupt auf Hilfe zählen?“ wollte er wissen. „Die nächste Stadt ist Madras …“
„… die einer von uns bis morgen mittag erreichen kann.“
„Es ist ein Weg von zwölf Stunden.“
Die Alte sagte: „Ich würde selbst gehen, aber ich bin den Strapazen des langen Marsches nicht mehr gewachsen.“
„Sobald die Dacoits feststellen, daß wir keine Fremden verbergen, werden sie abziehen.“
„… falls sie nicht zuvor Samatrai einäschern. Ich stimme Ramkali zu: Keiner von uns ist seines Lebens sicher.“
„Wer geht?“
„Shri Ram Singh“, sagte die Alte. „Er besitzt als einziger ein Schwert und kann leidlich damit umgehen. Daß er es schafft, das Dorf zu verlassen, dafür müssen wir anderen sorgen und die Bande ablenken.“
Sie redeten noch lange über das Für und Wider verschiedener Pläne. Während der Zeit holten sich die Dacoits zwei weitere Ziegen, die sie schlachteten und aufbrachen.
Genau das brachte Ramkali auf eine Idee, die später verwirklicht wurde, als der Mond hinter dichten, regenschweren Wolkenbänken verschwand und die Sicht gerade zwei Dutzend Schritte weit reichte. Daß es sogar leicht zu regnen begann, konnte nur von Vorteil sein.
Shri Ram Singh hatte schwarze Kleidung angelegt und sich Gesicht und Hände mit dunkler Erde und Ruß eingeschmiert. Wahrscheinlich warteten die Dacoits darauf, daß ein Fluchtversuch im Osten oder Süden erfolgte – daß es jemand nach Norden versuchen könnte, erschien ihnen unwahrscheinlich.
Irgendwann gegen Mitternacht entstand Unruhe in der Ziegenherde. Vielleicht witterten sie ein Raubtier in der Nähe des Dorfes. Jedenfalls ging alles sehr schnell, die Ziegen rannten gegen das Gatter an, das dem jähen Anprall nicht gewachsen war und auseinanderbrach. Drei Büffel, ebenfalls in Panik versetzt, trampelten hinter den Ziegen her.
Phoolan Devi und ihre Bande wurden zunächst überrascht, zumal die Tiere auf ihr Lager zustürmten. Im nächsten Moment hatten sie alle Hände voll zu tun. Phoolans Befehl, Büffel und Ziegen einzufangen, erwies sich als schwer durchführbar, noch dazu versuchten die aufgeschreckten Dörfler, ihre Herde zurückzuholen.
Einige der Wachtposten, die Phoolan rund um Samatrai aufgestellt hatte, beteiligten sich an der Jagd und drängten zugleich die Bauern zurück, die aus Furcht um den Verlust eines Großteils ihrer Lebensgrundlage massiver gegen die Dacoits vorgingen. Was ihnen der Fluß und die Felder bescherten, reichte kaum für eine karge Versorgung.
Der Zwischenfall blieb dennoch auf einen kurzen Schlagabtausch beschränkt und endete damit, daß sich die Dörfler zurückzogen. Einige von ihnen waren leicht verwundet, doch das hatten sie in Kauf nehmen müssen. Schlimmer wog da schon, daß die Räuber einen Büffel erschossen hatten und bis auf drei Ziegen alle Tiere verschwunden waren.
„Wenn Shri Ram Singh es schafft, in Madras Hilfe zu holen, waren die Opfer nicht umsonst“, sagte Ramkali zuversichtlich.
Längst hatte die Nacht den Mann mit dem rostigen Schwert verschluckt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.