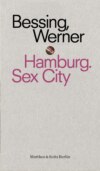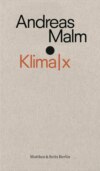Kitabı oku: «Hamburg. Sex City»
Joachim Bessing
Hamburg.
Sex City
Mit 26 Fotografien
von Christian Werner
punctum 018

Für Klaus
Denn einst bin ich schon ein Knabe gewesen
Und ein Mädchen, ein Busch
Und ein Vogel
Und ein aus dem Meer springender
Wandernder Fisch.
nach Empedokles
INHALT
Weiße Neger
Der Große Burstah
The Cure
Beinahe meine ganze Jugend hindurch dachte ich, Hamburg liegt am Meer. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, es scheint total verblödet, aber in dieser Ära, wo es nicht leicht möglich war, etwas aufzurufen, man sich also ein eigenes Bild machen musste, war Hamburg für mich ganz oben auf der Karte: einsam, einzig auch, und somit umtost von den Wellen des oder eines Ozeans.
Ich hatte die Zeitschrift Tempo im Abonnement, die kam aus Hamburg nach Heimerdingen. Das nahm natürlich ein Ende mit jener Nummer, auf der die splitternackte Brigitte Nielsen abgebildet war, vorne drauf, und die Schlagzeile hieß »Im Silicon Valley«.
Für diesen feinen Humor aus Hamburg – Nielsen hatte sich damals ihre Brüste aufpolstern lassen mit Implantaten aus Silikon (was übrigens nicht dasselbe meint wie das englische Silicon, aber dazu komme ich später noch) – hieß mich meine Mutter, dieses Abonnement umgehend zu kündigen, denn angeblich hatten die Nachbarn schon zu reden begonnen über mich, also ihren Sohn, der ja anscheinend ein Schwerenöter war – zumindest auf der schiefen Bahn befindlich. Ja, ja: der Briefträger. So war das damals. So ging das zu.
Noch bis zu der Fahrt nach Hamburg, die wenige Monate später tatsächlich stattfand, stellte ich mir das Straßenbild dort mit Matrosen durchmischt vor. Die Stadt eher als Randgebiet eines gewaltigen Hafens, in dem es permanent und brunftig tutete. Schiffstaufen! Ich reiste mit einem Freund im Zug. Es war meine erste Reise in den Norden der BRD.
Arnobius hatte ich im Vorjahr auf einer vom ERD, dem Evangelischen Reisedienst, veranstalteten Fahrt zu den Ägadischen Inseln kennengelernt. Es sollten die ersten Ferien ohne meine Eltern sein, und gleich nach der tagelangen Busfahrt bis nach Palermo wäre mein Ausflug auch beinahe kanarienvogelhaft beendet worden, weil ich auf der Überfahrt beim Skateboarden derart heftig gegen die Reling des Oberdecks geschleudert worden war, dass ich für zwei Augenblicke, oder bloß einen, mehrere Stockwerke tief hinunter auf das von den Schiffsschrauben schaumig aufgewühlte Wasser der weindunklen See starrte, bevor mich vier Hände am T-Shirt packten und zurück ins Leben rissen – das heißt an Deck der Nachtfähre von Palermo nach Favignana – so hieß unsere Ferieninsel nämlich und eigentlich.
Ein ziemlich öder Ort übrigens. Mittlerweile betreibt der italienische Staat dort ein Hochsicherheitsgefängnis für Terroristen. Aufgrund ähnlicher Überlegungen hatte sich zu meiner Zeit der Evangelische Reisedienst für die Insel als Ferienort für alleinreisende Teenager entschieden: Es gab dort nichts, außer rötlichem Sand und einer ehemaligen Konservenfischfabrik. Umso intensiver beschäftigte man sich mit den Mitreisenden, von denen ich bei Antritt der Reise niemanden gekannt hatte. Durch zwei neue Freunde, die mir auf der Fähre das Leben gerettet hatten, lernte ich noch weitere Stadtkinder kennen und es kam zu einem veritablen Kulturaustausch, der freilich recht einseitig war, denn aus der ländlichen Kultur stammend, hatte ich den Bewohnern der Landeshauptstadt kaum etwas entgegenzubringen. Als einer meiner Lebensretter mir wenige Wochen nach unserer Heimkehr das Angebot machte, ihn auf einer Reise zu seinen in Hamburg lebenden Verwandten zu begleiten, nahm ich natürlich an. Von der Fahrt dorthin, die im Vorläufer des Intercity-Express, dem Intercity, stattfand und von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof etwa zehn Stunden dauern sollte, habe ich nicht allzu viele Details in Erinnerung behalten können, was maßgeblich dem Konsum von Apfelkorn zuzuschreiben ist; ein für mich ungewohntes, weil großstädtisches Ritual, infolgedessen ich den überwiegenden Teil der Fahrtzeit, bald nach dem Überqueren der baden-württembergischen Landesgrenze, in der Toilettenkabine unseres Waggons verbrachte. Noch heute wird mir ganz anders, wenn ich durch Milchglasscheiben einen sich unerbittlich dahinziehenden Streifen Grün mit reichlich Grauem darüber betrachten soll. Ein hervorragendes Beispiel für die gelungene Monumentalisierung dieser Ödnis norddeutscher Landschaften ist »Rhein II« von Andreas Gursky.
Als ich meinen Weg zurück in das Abteil zu meinem Kameraden gefunden hatte, war draußen –– wie lange schon? seit Stunden sicherlich – ein Flachland ausgebreitet worden. Feucht und apathisch, wie tot. So hatte ich mir Norddeutschland immer vorgestellt, und so sah es auch in Wirklichkeit aus. Eine ideale Kulisse für mein Gefühlsleben. Es war 1987, ich setzte die Kopfhörer auf und hörte Kiss Me Kiss Me Kiss Me.
In Hamburg bezogen wir ein Mehrbettzimmer auf dem Stintfang, so nannte sich die Jugendherberge mit Blick auf den Hafen. Direkt dort unten, das Gebäude war auf einer Anhöhe errichtet worden, waren die Landungsbrücken von St. Pauli zu sehen. Das sagt sich leicht, es geht einem leicht von der Zunge, wie es heißt, dabei weiß doch kaum jemand, was eine Landungsbrücke ist. Wozu sie da ist, gemacht wurde. Wie sich bald schon, in meinem persönlichen Fall im Verlauf von neun ereignisreichen Jahren, nicht den ereignisreichsten in meinem Leben, aber da es die ersten waren, hat es gereicht, herausstellen sollte, war Hamburg, die Stadt, die nicht am Meer lag, sondern an einem Zubringer des Meeres namens Elbe, voll von diesen Dingen, die einem leicht und gern von der Zunge gingen, bei denen aber niemand so genau wusste, was damit gemeint war. Grob gesagt ist Hamburg für das schwäbische Ohr aus lauter kuriosen Namen gemacht. Am Stintfang wurden vielleicht früher einmal Fische gefangen. Aber wer war der Große Burstah?
Von all diesen Feinheiten einer maritimen Lebensweise war ich im Strohgäu zwar nicht auf die denkbar fernste Weise aufgewachsen, denn immerhin gab es auf dem Heimerdinger Friedhof das Grab eines Matrosen, von dem zumindest ein an die Innenseite der Friedhofsmauer gelehnter Grabstein übrig geblieben war, auf dem unter einer leuchtend grünen Schicht von Moos, die genauso gut auch von Algen hätte sein können, das Relief eines Ankers mit dem Ankerseil, das ihn umspielte wie eine Äskulapnatter, eingearbeitet war. Mehr dergleichen gab es aber nicht. Es wurde auch von uns daheim kaum Fisch verzehrt, eigentlich bloß mittwochs und dann Makrelen aus Konserven. Meine Neugierde auf hanseatische Spezialitäten war zwar nicht enorm, aber spürbar da.
Aber anders, als ich es aus meinen Ferien in der Bretagne kannte, hatten die Landungsbrücken von St. Pauli überhaupt kein kulinarisches Flair, es gab keinerlei Hinweise auf eine lebendige Kultur des Fischfangs für den Lebensunterhalt der Stadtbevölkerung. Die angebotenen Hafenrundfahrten erschienen überteuert angesichts dieses Industriehafens an den Ufern eines sich bis zum trüben Horizont dahinwälzenden Elbstroms, der nun mal eher lang als breit geschwollen schien – naturgemäß, wie Thomas Bernhard geschrieben hätte. So anheimelnd wie die von ihm vertretene Weltsicht erschien mir Hamburg vom Hügel des Stintfang aus und auch noch von weiter unten, von den Landungsbrücken her besehen. Wie genau dann die Idee zustande gekommen war, sich im Freihafen umzuschauen, konnte ich schon Stunden später nicht mehr nachvollziehen – weil das Wort frei darin vorkam?
Dort drüben gab es noch weniger zu sehen. Aber immerhin hatte man vom anderen Ufer der Elbe eine schöne Aussicht auf die Stadt. »Kommen sie rein, können sie rausgucken«, hätte mein Vater gesagt. In einem toten Winkel des Hafens, dort, wo einst die Elbphilharmonie errichtet werden würde, lag ein großes Schiff vor Anker. Es sah exakt so aus, wie ich mir die Schiffe im Hafen von Hamburg vorgestellt hatte. Ein veritabler Pott. Er war total verrostet. Sein Name stand auf einem der wenigen Reste ursprünglicher Schiffsfarbe, die noch nicht vom Rost aufgefressen waren: Cap San Diego.
Ich kontemplierte den Farbton der Kirchturmdächer, das warme Braun der Klinkerbauten und die Farbe des Himmels. Sie ähnelte der Farbe des Rheins bei Gursky. Allerdings ohne dessen Ahnung einer Silbrigkeit. Ein unendliches, von seinen Proportionen her zu weit oder breit auf mich wirkendes Grau. Kaum strukturiert. Geradezu stumpf. Der Raum über der Himmelsdecke schien sehr viel tiefer als der von dort aus bis zu uns herunterreichende Luftraum. Als ob dort über dem Grau der eigentliche Raum sich befände; der, um den es eigentlich geht. Mir schien, dass alles, was eine Farbe besessen hatte, dort an der Hamburger Decke aufgelöst wurde in ein unendliches Grau. Und von daher das Leuchten. Ein spezielles Licht, wie kurz vor einem schweren Gewitter, brachte die goldene Uhr an einem Kirchturm zum Leuchten wie eine zarte Einlegearbeit. Die Patina auf den Dächern – spitzförmige, auch gewölbte dazwischen – gloste grünlich. Ungut war der Effekt des Hamburger Himmels auf das Fassadenweiß: Es wirkte vergraut. Auch insgesamt betrachtet, von der anderen Seite des Elbufers aus, wirkte diese Stadt auf mich abweisend, dadurch auch herrschaftlich, wenn auch ganz anders als von mir erwartet. Leicht kaputt, auch angegammelt, trotzdem seriös.
Mein Freund indes fand die hiesige Seite pittoresk. Seit einiger Zeit besaß er einen eindrucksvollen Fotoapparat, eine Kamera, wie er sagte, mit der er keine Bilder machte oder »Fotos«, wie mein Vater, sondern: Aufnahmen. Die waren schon von den Motiven her ein anderer Schnack. Beispielsweise wurden korrodierte Oberflächen abgelichtet, die dann später auf dem Fotopapier wie Landschaften nach dem Säureregen oder nach der Neutronenbombe anmuteten. Vorhin, als wir vom anderen Ufer aus unter dem Fluss durch einen Tunnel auf diese Seite gewandert waren, war es natürlich die gekachelte Wandung der Tunnelröhre gewesen, die er seiner Kamera einverleiben musste. Das trübe Licht aus den Neonröhren hatte den Gilb der Wandfliesen für meinen Geschmack ungut herausgebracht. Aber ihm war der sogenannte Siff gerade recht erschienen. Seine Aufnahmen vergrößerte er schwarzweiß auf teuerstes Barytpapier, das war allgemein bekannt und beileibe nicht der einzige Grund, weshalb man ihn, und er sich, Krösus nannte.
Vor kurzem hatte Krösus mich als Fotomodell entdeckt, das war an einem Abend im Garten hinter dem Jugendhaus von Degerloch gewesen, wo er mir von einem Assistenten handvollweise Mehl ins vorher nassgemachte Gesicht pfeffern ließ. Der Assistent hatte mir zuvor den Mund mit Lippenstift geschminkt wie bei Robert Smith, meinem singenden Abgott. Das Haar, damals noch verblüffend voll und lang gewachsen, stand mir ohnehin in viele Richtungen wie zeigend vom Kopf ab. Die Nahaufnahmen meines Gesichts vor nächtlichem Schwarz waren beeindruckend expressiv herausgekommen. Wie auf dem Cover von Press The Eject And Give Me The Tape.
Hier, in der industriell abgewrackten Einöde des Freihafengeländes, fand sich der Künstler offenbar inspiriert zu einigen Aufnahmen, bei denen ich ihm Modell stehen sollte. Das Zusammensetzen der Kamera mit ihren kostbaren Objektiven und das Einlegen des ekelhaft teuren Filmmaterials, das obendrein noch extrem lichtempfindlich war, hatte sich erledigt während meiner Kontemplation des uferlosen Himmels über der Stadt. Jetzt sollte ich tun, was allen Fotografen, denen ich im weiteren Verlauf meines Lebens noch begegnen sollte, lieb gewesen wäre: Einfach so bleiben, wie ich war.
Beim Posieren fiel uns ein Stapel mit Kartons auf, die mit russischen Schriftzeichen bestempelt waren. Als Kinder der Achtzigerjahre waren wir auf russische Schriftzeichen fixiert. Wie oft waren wir von der Zeitschrift Tempo aus Hamburg oder von der auch für ihr ungewöhnliches Format geschätzten Zeitschrift Der Manipulator mit russischen Schriftzeichen penetriert worden – einfach so und ohne dass wir sie dafür eigens hätten entziffern können müssen, als Code; Kyrillisches als Garnitur einer grafischen Gestaltung, die in der zeitgenössischen Welt der Magazine die Avantgarde vom Mainstream schied. Auch sonst trug man immer irgendwo einen dekorativen Lenin-Button – die Betonung liegt dabei auf dem Irgendwo. Oder einen Anstecker, der ursprünglich an eine Raketenparade in Moskau erinnern sollte – all diejenigen jedenfalls, die lesen konnten, was unter den konstruktivistisch dargestellten Spargelköpfen in Emaille geschrieben stand. Jedenfalls ließen wir, also ich vor allem, Krösus hatte ja schon an der Umhängetasche mit seiner Kameraausrüstung zu tragen, eins dieser kyrillischen Objekte mitgehen auf unserem weiteren Weg der Motivsuche in dieser sandigen Ödnis, In The Flat Field, die uns jetzt freilich noch mehr als zuvor an den von uns verehrten Film Stalker erinnerte, den wir in einer Spätvorstellung des kommunalen Kinos im Planetarium gezeigt bekommen hatten. Im Original mit Untertiteln. Ähnlich mutete bald schon die Szene an, in der sich in einer Staubwolke zwei Gestalten näherten. Sie stoben quer über das freie Gelände auf uns zu. Unverständliches rufend. Nachdem wir, jeder für sich, aber auch schon gemeinsam, einige wenige, aber dafür umso nachdrücklichere Erfahrungen mit Erwachsenen und ihren Drohgebärden gemacht hatten, rannten wir sofort los. Und zwar, die Auswahl war ja nach vorne hin durch das Wasser begrenzt, in die andere Richtung. Von dort nahte bald mit der Überlegenheit einer Maschine ein langsam fahrender Polizeiwagen. Uns Flüchtenden zu Fuß entzog dieser Anblick sämtliche Energie. Wir ergaben uns. Wie aus Filmen bekannt. Der Karton ging dabei zu Boden.
Die zwiespältige Definition des Polizisten als Freund und Helfer bewahrte uns vor dem Furor der Hafenarbeiter, deren Anhörung in einigem Abstand stattfand, während wir schon auf dem Rücksitz des Mercedes Platz nehmen durften. Die Fahrt führte dann zu einem Polizeigebäude auf dem Hafengelände. Wir verbrachten sie schweigend. Das Schuldgefühl braucht ja eine Weile, bis es sich aus seinem Etui befreien und entfalten kann.
In meiner damaligen Weltsicht wurden Polizisten irgendwo in der BRD zentral ausgebildet und dann in ihre Einsatzgebiete entsandt. Vermutlich ging es in meinem weltwissenschaftlichen Apparat damals sogar so zu, als ob Polizisten an diesem Ort industriell hergestellt und von dort aus an ihre Einsatzorte versandt wurden. Dass es sich um Mitmenschen in Uniform handelte, diese Einsicht wurde mir vor allem durch die Uniform selbst verstellt. Trotzdem waren die Beamten der Hansestadt die ersten echten Hamburger, die wir auf unserem Ausflug kennenlernten. Nachdem sie uns eine Stunde lang in Einzelzellen hatten schmoren lassen, wurden wir an getrennten Schreibtischen zum Tatvorwurf verhört. Hier kam dann auch das Regionale heraus. Unsere Herkunft sorgte bei diesen Hamburgern, die vielleicht sogar Eingeborene waren, für einige Heiterkeit. Dass Scherzworte durch den Raum gerufen wurden, so weit kam es zwar nicht, aber dass Krösus mit Nachnamen Hämmerle hieß, das fand man gut. Auch um uns dann, in dieser einseitig gelösten Atmosphäre, darüber aufzuklären, worum es sich bei dem Inhalt des kyrillischen Kartons handelte. Bevor wir in die Zellen gesperrt wurden, erklärte man uns in ernsthaftem Ton, dass es sich eventuell um technische Bauteile handele, von daher möglicherweise der Tatbestand der versuchten Industriespionage im zollfreien Raum vorliege. Über diese Möglichkeit, bestraft zu werden, eventuell vor Ort, im Herkunftsland selbst, in der Sowjetunion, wo Sibirien Standard war, hatte ich während meines Aufenthaltes in der Einzelzelle unter dem Schirm meines vollends entfalteten Schuldgefühls kontempliert.
In dem Karton waren sechzehn Dosen Krabbenfleisch aus Kamtschatka.
Mit dem versuchten Diebstahl, wie die Anschuldigung nun offiziell lautete, hatten wir unser Aufenthaltsrecht auf dem Gebiet des Freihafens verwirkt. Mit dem Polizeiauto wurden wir durch den Elbtunnel zurück auf die andere Seite gebracht. Unser Gepäck stand in der Jugendherberge schon zur Abholung bereit. Während wir in unseren Zellen auf den Pritschen gelegen hatten, war unser Zimmer in der Jugendherberge von Polizisten durchsucht worden. Wohl, um dem anfänglichen Verdacht der versuchten Industriespionage nachzugehen. So liberal sich Hamburg gab: Nun wollte man uns selbst im Stintfang nicht mehr dulden oder wie es im Hamburgischen hieß: leiden mögen. Auch der geplante Besuch bei den Verwandten im Elbvorort musste ausfallen – das einstweilige Urteil des Polizeikommandanten lautete: Stadtverweis. Die Polizisten fuhren uns nach der Gepäckaufnahme zum Hauptbahnhof und warteten auf dem Bahnsteig bis zur Abfahrt unseres Zuges. Die Fahrt heim in den Süden geriet freilich ganz anders als unsere Hinfahrt kurz zuvor. Wir waren ja um Jahre gealtert. Im Vergleich zu mir hatte Krösus aber einen Vorteil: Er brachte Aufnahmen mit. Noch wussten wir nicht, was darauf zu sehen war.
Wochen später, ich kontemplierte gerade etwas gänzlich anderer Natur, wurde ich von meinem Vater bei meinem Vornamen gerufen: Ein Brief der Staatsanwaltschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Postleitzahl 2000, war eingetroffen. Darin wurde das peinliche Erlebnis, über das ich meine Kummer gewohnten Eltern liebend gerne in Unkenntnis gelassen hätte, von offizieller Seite kundgetan. Die Anklage wurde fallengelassen. Eine Eintragung in mein polizeiliches Führungszeugnis fand nicht statt. Und trotzdem.
Schimpf und Schande!
Demonstrativ kündigte ich mein Abonnement der Zeitschrift aus Hamburg. Deren Werbespruch war »Anything Goes« gewesen. Gemeint war damit die sogenannte Postmoderne in den Achtzigerjahren, offenbar vor allem als ein architektonischer Stil, an den in Deutschland heute prominent die Staatsgalerie Stuttgart von James Sterling erinnert, die Bundeskunsthalle von Gustav Peichl in Bonn, der Messeturm von Helmut Jahn in Frankfurt am Main und disturbingly late to the party: das abstruse Kanzleramt zu Berlin. In Hamburg selbst hingegen, wo mit Tempo das Zentralorgan einer nicht allein die Architektur, sondern alles durchdringenden postmodernen Bewegung für den deutschsprachigen Raum publiziert wurde, gab und gibt es überhaupt kein einziges Bauwerk im postmodernen Stil. Was daran liegen könnte, dass dem Hamburgischen an sich das Spielerische und Verspielte doch eher fernliegt. Dem Österreicher hingegen, speziell dem aus Wien, kann es gar nicht spielerisch und dabei auch noch verspielt genug zugehen auf seiner Welt. Dass der erste Chefredakteur des Zentralorgans der bundesdeutschen Postmoderne, der ein Wiener war, sich ausgerechnet das sachliche Hamburg als Sitz für seine Redaktion aussuchte, kann mit seiner Suche nach dem größtmöglichen Reibungspotenzial für seinen Hitzkopf erklärt werden. Hier, umgeben von den Gärten in ewigem British Racing Green und ihren muschelhellen »Patriziervillen« am Ufer des Alstersees, mit der schönen Modeschöpferin Jil Sander als Nachbarin und einem unnachahmlich feuchten Klima, das schon seit Jahrhunderten auf wunderbare Weise mit den samtigen Rasenflächen und den blickdichten Schleppen der Trauerweiden harmoniert, konnte er sich ein barock verspieltes Hamburg aus den Fingern saugen, wie es wienerischer gar nicht vorstellbar war. Für die übrigen Journalisten der Medienstadt Hamburg, die sich gedanklich allenfalls vom Fleet an die Fleet Street bewegten, aber dabei – Kaufmannsehrenwort – ständig an die Kasse der Verleger dachten, schien er durch seine aufreizende Serie von Vertrauensbrüchen bis zur Unberührbarkeit kontaminiert. Was in Hamburg aber auch nicht weiter tragisch war, denn hinter dem Tor zur Welt gab es inlands gleich mehrere Welten, die im Kosmos der Hansestadt mehr gleichgültig denn harmonisch aneinander gewöhnt waren. Was Jäcki am Gänsemarkt noch so Irrsinniges widerfahren war, hatte immer auch zeitgleich stattgefunden mit dem behaglichen Verspeisen eines warmen Franzbrötchens vor dem morgendlichen Ausritt im Jenischpark und dem Umfallen eines Sacks Kakaobohnen in der Speicherstadt. Bloß dass halt am Gänsemarkt mittlerweile eine Werbeagentur residierte. Dass dort Franzbrötchen aus der gegenüberliegenden Stadtbäckerei schnabuliert wurden, darf nicht gänzlich in Abrede gestellt werden. Aber die Penner und die Nachtschwärmer, die Künstler und so weiter, es gab sie noch immer. Man war halt vom Gänsemarkt aus neunundachtzig bis einhundertundzwei Schritte über den Stephansplatz und auf dem Gorch-Fock-Wall an der Musikhalle und am Justizgebäude vorbei bis durchs Millerntor weitergezogen, von wo aus sich bis zum westwärts gelegenen Nobistor zu beiden Seiten der alten Reeperbahn das Hafenviertel St. Pauli ausgebreitet fand wie eh und je zu Starclub-Zeiten. Seit Neustem aber, eigentlich seit Erfindung der Pornofilme auf Videokassette, aber besonders derbe – wie es dort hieß – seitdem das Virus umging, die Schwulenpest, die Freierseuche, Needle Sharing, Aids, befand sich die Infrastruktur einmal mehr mitten in einem ultraregionalen Strukturwandel. In die leerstehenden Pornokinos und Animierbars und Nachtclubs für erotisches Cabaret, in denen anhaltende Flaute geherrscht hatte, zogen nun, wie Einsiedlerkrebse in Muscheln, Bars und Nightsclubs ein – von der Strategie her waren das meistens Pop-ups – die, wie es auf St. Pauli seit Urvätern Sitte war, erst kurz vor Mitternacht ihr Publikum fanden – dafür blieben die Mädels und Jungs auch gerne bis in die sogenannten Puppen und zechten by the pail. An den Tresen und in den Plüschecken saßen jetzt nicht mehr bloß traurige Männer und warteten auf Liebe an sich, es mischten sich Alstervilla und Hafenstraße mit Altbau-WG im Hochparterre. Wer in der Gesellschaft der Hansestadt gegen den Kaufmannskodex verstieß, wurde zwar vom Rasen gebeten, fand aber mildtätige Aufnahme im den Zuhälterkodex befolgenden verschworenen Gestrüpp des Nachtlebens. Gleichwie taxiert befand sich also alles wohl in benachbarten Sphären, unter einem weiten Himmel über der Stadt. So konnte es dann schließlich auch dazu kommen, dass ich, ein heuriges Häsle, dort dem Großen Burstah in die Fänge geriet.
Wie hat sich diese Begegnung abgespielt – so wie bei Moriarty und Holmes?
Nein, natürlich nicht.
6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit: Als ich wieder nach Hamburg kam, war das keine Rückkehr für mich, es war auch kein zweites Mal. Die Achtzigerjahre waren vorbei. Eine ganze Kindheit war vorbei. Wie versunken. Aber noch nicht ganz, ein Zipfel schaute noch aus der See, die längst wieder glatt wie ein Spiegel hinter mir lag.
Als ich, ein junger Mann, ein Nobody, in dieser Silvesternacht am Anfang der Neunzigerjahre nach Hamburg kam, wusste ich natürlich erstens nicht, dass ich einst neun Jahre hier gelebt haben würde. Und zweitens konnte mir damals, während vor den zugefrorenen Scheiben die ersten Goldregen durch die Dunkelheit pfiffen, bloß ganz zart erst schwanen, dass ich hier in Hamburg auch die Liebe erleben dürfte. Die Liebe, l’ amour, das einzig Wahre. Der Schatz des Herzens in seiner postmodernen Form, aus Tragödie und Farce zusammengewürfelt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.