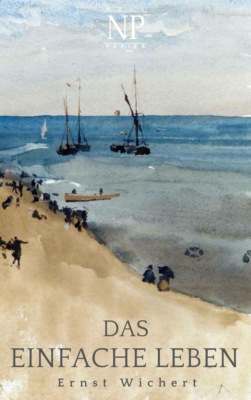Sayfa sayısı 1161 sayfa
0+

Kitap hakkında
"Dichtung und Wahrheit" ist eine Autobiographie von Johann Wolfgang von Goethe, die die Zeit der Kindheit und Jugend des Dichters bis kurz vor seiner Abreise nach Weimar als junger Erwachsener im Jahre 1775 beschreibt.Das Buch ist in vier Teile gegliedert, von denen die ersten drei zwischen 1811 und 1814 geschrieben und veröffentlicht wurden, während der vierte Teil hauptsächlich in den Jahren 1830 und 1831 geschrieben und 1833 veröffentlicht wurde. Das Werk umfasst die ersten 26 Lebensjahre des Autors. Goethe war der Meinung, dass «die wichtigste Periode eines Individuums die seiner Entwicklung ist».Erste Entwürfe zu «Dichtung und Wahrheit» diktierte Goethe, nachdem er seine Farbenlehre beendet hatte, im Sommer 1810 in Karlsbad. An der Autobiographie arbeitete er zunächst parallel zu seiner Arbeit an «Wilhelm Meisters Lehrjahre»; ab Januar 1811 wurde das Verfassen der Autobiographie zu seiner Haupttätigkeit.Goethe schrieb «Dichtung und Wahrheit» aus den Blickwinkeln des Wissenschaftlers, des Historikers und des Künstlers. Als Wissenschaftler wollte er sein Leben als sich stufenweise entwickelnd darstellen, «nach jenen Gesetzen zu bilden, wovon uns die Metamorphose der Pflanzen belehrt.» Als Historiker schilderte er die allgemeinen Verhältnisse der Zeit. Als Künstler fühlte er sich nicht an Fakten um ihrer selbst willen gebunden, sondern wählte diejenigen aus, die von Bedeutung waren, und formte sie so, dass sie Teil eines Kunstwerks werden konnten.Das Wort «Dichtung» ist bewusst doppeldeutig gewählt und weist darauf hin, dass der Autor systematisch jene Ereignisse ausgewählt hat, deren Erwähnung er für wünschenswert hielt.Null Papier Verlag