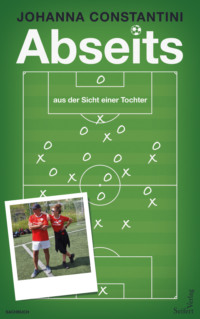Kitabı oku: «Abseits»

unveränderte eBook-Ausgabe
© 2020 Seifert Verlag
1. Auflage (Hardcover): 2020
ISBN: 978-3-904123-48-8
ISBN Print: 978-3-904123-35-8
Trotz aufwendiger Recherche war es uns nicht möglich, bei Drucklegung des Buches jeden einzelnen Urheber der abgedruckten Fotos ausfindig zu machen.
Der Verlag bittet um Verständnis dafür und wird gegebenenfalls Urheberrechtsansprüche in angemessener Form nachträglich abgelten.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Korrekturen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Schreiben Sie uns einfach unter office@seifertverlag.at
Seifert Verlag GmbH
Ungargasse 45/13
1030 Wien
Inhalt
Vorwort von Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner
Einleitung
1. Auf bald, Schmetterling
2. Löwenmutter-Manier
3. Stir it up
4. Hashtag Didi Constantini
5. Kraft und Philosophie
6. Abseits
7. (K)ein Demenzratgeber
8. Rot oder Schwarz?
9. Der Sheriff von Nottingham
10. Weil auch Buben weinen dürfen
11. Auf den Spuren von Pippi Langstrumpf
12. Gesellschaftliche Kür oder menschliche Pflicht?
13. Demenzfreundlich ist
14. Mehr als Nullen und Einsen
15. Familiensachen
16. Schmetterlingsgedanken
Danke
Quellen
Anlaufstellen
Bildteil
Anmerkungen
für alle, die verstehen möchten
Wenn nichts anderes gilt, als den Moment zu leben. Weil jener Moment im nächsten Moment bereits in Vergessenheit geraten könnte.
Johanna Constantini, 2020
Vorwort von Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner

„Abseits“ – ein paradigmatischer Titel – und nicht nur für Fußballfans ein Reizwort. Über keine Entscheidung beim Fußballspiel wird so heftig diskutiert und debattiert. Je nach Standpunkt.
Das Buch „Abseits“ von Johanna Constantini, Tochter des ehemaligen Fußballnationaltrainers und Fußballprofis Didi Constantini, ist nie belehrend, besserwisserisch oder gar reißerisch. Die Tochter beschreibt mit großer Empathie persönliche Begegnungen und Erlebnisse in der Familie, zwischen Vater und Tochter und mit der Öffentlichkeit. Die Autorin lässt die Leser dadurch an einer persönlichen Lebensgeschichte intensiv teilhaben.
Manchmal ist es wie ein langsamer Sturm. Die Wucht der Erkrankung umfasst den Patienten, die Familie, das gesamte dementielle Umfeld. Es gibt inzwischen gute epidemiologische Daten über dementielle Erkrankungen. Wir wissen vieles über die Häufigkeit, über die Ursachen und vorbeugende Maßnahmen. Die Anzahl der Menschen mit Demenz wird weiter steigen, dabei ist das Alter der größte Risikofaktor.
Die allgemeinen statistischen Daten sollen nicht den Blick auf den einzelnen Patienten verdecken. Didi Constantini, ein Betroffener, der in der Öffentlichkeit steht, kann die Dimension einer Demenzerkrankung für viele erkennbarer machen. In diesem Buch wird deutlich, dass ein an Demenz erkrankter Mensch trotz der Erkrankung ein Mensch mit charakteristischen Eigenschaften bleibt. Niemals sollten wir Menschen auf die Erkrankung reduzieren – auch nicht Menschen mit Demenz.
Ein Leben besteht aus vielen Erinnerungen, aus Episoden, die wir intensiv erlebt haben. Besonders Fußballfans werden sich detailreich an Didi Constantini erinnern, werden die fußballerischen Freuden im Gedächtnis wieder erleben. Genau so versuchen auch Menschen mit Demenz sich an Episoden der Vergangenheit zu erinnern. Nur, insbesondere bei der Alzheimerkrankheit, können sie die vergangenen Episoden nicht mehr oder nur bruchstückhaft im Gedächtnis finden.
Erlebnisse können nicht mehr gespeichert werden, alte Erinnerungen gehen langsam verloren.
Es ist, wie es ist. Die Erkrankung ist belastend, besonders durch Verhaltensauffälligkeiten, die im Rahmen einer Demenzerkrankung auftreten können. Es gibt aber auch die schönen Momente, in denen persönliche Begegnung möglich ist – vielleicht nur für kurze Augenblicke. Solche Momente sind in diesem Buch viele beschrieben.
Josef Marksteiner
Innsbruck, im Juni 2020
Einleitung

„Du musst immer wissen, wer der Schiedsrichter ist“, war eine der Fußballweisheiten, die meine Oma zum Besten gab. Sie musste es ja wissen, schließlich war sie Zeit ihres Lebens von vielen fußballbegeisterten Männern umgeben gewesen. Einer davon ihr zweitältester Sohn. Mein Papa. Didi Constantini. Einstiger Profifußballer, Trainer so ziemlich jeder österreichischen Bundesliga- und nicht zuletzt der Österreichischen Nationalmannschaft. Liebender Papa, toller und fürsorglicher Familienmensch. Geisterfahrer und Betroffener. Betroffener einer Demenzerkrankung, wie so viele andere. Einer Erkrankung, die die meisten Menschen ins Abseits zu stellen droht. In eine Position, über die auch am Rasen immer die Schiedsrichter entscheiden. Was das Spielfeld des Lebens betrifft, so sind wir alle jene Schiedsrichter. Denn nicht nur wir als Angehörige, sondern auch wir als Gesellschaft bestimmen letzten Endes darüber, ob demenzkranke Menschen im Abseits stehen müssen oder nicht. Wir als Angehörige und wir als Gesellschaft legen fest, wann Betroffene vom Platz gar verwiesen werden sollen. Um nicht mehr teilnehmen zu dürfen. Am Spiel und am Leben.
Mehrere Motive haben mich zu diesem Buch bewogen. Einerseits dienen meine Zeilen der persönlichen Aufarbeitung familiärer Geschehnisse, wie sie sich zuletzt in meinem Leben zugetragen haben. Dabei spreche ich vor allem von jenem Unfall, den Papa im Juni 2019 als Geisterfahrer verursacht hatte. Und in dessen Folge ihm die Diagnose einer Demenz, im Speziellen die einer Alzheimer-Erkrankung attestiert worden war.
Auch zur Klärung offener Fragen zu jenen Geschehnissen, die das öffentliche Interesse über alle Maßen beschäftigt haben, sollen die folgenden Seiten beitragen. Und nicht zuletzt sollen sie über Demenzerkrankungen aufklären: Ich möchte bewusst Einblicke in Papas Leben wie auch in unsere Familiengeschichte und unseren ganz persönlichen Umgang mit dem Schicksalsschlag gewähren. Einem Schicksalsschlag, wie er viele Menschen ereilt. Menschen, mit denen ich nicht zuletzt in meiner Rolle als Psychologin in Kontakt trete, mit denen ich persönliche Herausforderungen aufarbeite. Schließlich gibt es in beinahe jeder Familie einen oder gar mehrere Fälle psychischer Erkrankungen. Vor allem dementielle Erkrankungen nehmen stetig zu.
Während sich mein Buch sowohl an Betroffene als auch an Angehörige und die Gesellschaft richtet, möchte ich mit meinen Zeilen keinen wissenschaftlichen Ratgeber liefern. Eher als professionelle Expertentipps will ich meine bzw. unsere persönlichen Sichtweisen und Strategien im Umgang mit der Erkrankung preisgeben. An die Öffentlichkeit zu gehen war uns als Familie auch deshalb wichtig, um Vorbild sein zu können.
Dass eine Demenzerkrankung viele Herausforderungen für Betroffene und auch für Angehörige mit sich bringt, ist und bleibt unbestritten. Dass diese Erkrankung aber auch neue Möglichkeiten und Chancen für zahlreiche gemeinsame Momente birgt, möchte ich nicht zuletzt am Beispiel unserer Familie zeigen.
Letztlich ist dieses Buch also der Versuch, persönliche und berufliche Denkanstöße zu vereinen, um demenzkranke Menschen ihre Positionen selbst wählen zu lassen. Sie vor allem nicht ins Abseits zu stellen, ihnen vielmehr so gut wie nur möglich ein Dasein auf dem Spielfeld des Lebens zu erhalten.
Dafür schreibe ich. Als Psychologin. Und als Tochter.
|
1
Auf bald, Schmetterling

Der Wald riecht noch frisch. Ein wenig nach Frühling. Obwohl die Sonne für diese frühen Stunden bereits recht hoch steht. So wie Anfang Juni eben üblich. Die warme Jahreszeit hielt bisher noch zögerlich Einzug, sodass der Waldboden in diesem Jahr später als normal sein frisches, sattes Grün zeigt. Doch was ist schon normal? Diese Frage wird mich in meinem Buch, von dem ich heute noch nicht genau weiß, wo es mich hinführen wird, wohl noch einige Male beschäftigen. Der weiche Waldboden trägt mich Meter für Meter durch das vom späten Frühlings- und frühen Sommerlicht durchflutete Dickicht der Tannenbäume. Meter für Meter lasse ich hinter mir, begleitet von meinem vierbeinigen Partner.
Wir laufen, und meine Gedanken schweifen ab. So wie sie es immer tun, wenn ich dieser – einer meiner liebsten sportlichen –
Betätigungen nachgehe. Beim Laufen konnte ich schon immer wunderbar abschalten. Eine Gabe, die mir dieser Tage sehr zugute kommen soll. Ich blicke durch das Geäst, mir fallen die vielen Eichhörnchen auf, die hurtig die Baumstämme hinaufklettern, ihre Augen, und damit auch ihre wachsame Aufmerksamkeit immer wieder auf meinen Vierbeiner und mich gerichtet. Auf unsere kleine Laufgemeinschaft sozusagen.
Trotz ihrer akrobatischen Kunststücke schaffen es die quirligen Baumfüchse jedoch nicht lange, mich in ihren Bann zu ziehen. Im Nachhinein bin ich verwundert, weshalb es einem der unscheinbarsten Waldbewohner gelang, meinen Blick auf sich zu ziehen: Es ist ausgerechnet eine kleine Raupe, die fortan meine ungeteilte Aufmerksamkeit genießt. Obwohl sie nicht mehr tut, als an einem scheinbar seidenen Faden vor mir zu hängen und sich fortwährend nach oben und nach unten zu schlängeln. In einem fahlen Gelb, fast schon Beige erscheint sie in diesem frühen Sonnenlicht eines Dienstags im Juni des Jahres 2019. „Gut, dass sie im Wald leben kann“, denke ich in diesem Moment …

„Ich muss die Raupe rausbringen!“, sagte ich zu meiner Mama, die neben mir saß, und blickte auf den Zipfel meiner Laufhose. Fast alle anderen Sitze in dem Warteraum der Innsbrucker Universitätsklinik waren zu diesem Zeitpunkt leer. Auch der Platz des Portiers war nicht besetzt. Es war kurz vor fünf Uhr Nachmittag an eben jenem Dienstag. Uns gegenüber hatte eine Familie Platz genommen, Mutter, Vater und ein junger Mann, offenbar der Sohn. Der Bruder des jungen Mannes, der wohl auch in den Autounfall von heute Nachmittag verwickelt worden war. In den Unfall, der auch uns schnurstracks in die Notaufnahme geführt hatte. Direkt nach meinem Waldlauf, auf dem mich mein Hund, viele, viele Eichhörnchen und der wohl hartnäckigsten Mitreisende, eine kleine, hellgelbe Raupe, begleitet hatten. Auf dem ich mir erhofft hatte, ein wenig abschalten zu können. Von den letzten Wochen, die sich für mich beruflich wie eine Achterbahnfahrt angefühlt hatten. Ständig hatten sich neue, durchaus spannende und abwechslungsreiche Projekte in meiner psychologischen Arbeit ergeben. Meine Selbstständigkeit hatte zunehmend Fahrt aufgenommen, und ich genoss die vielen neuen Aufgabengebiete. Der Waldlauf und die frische Luft sollten mir guttun.
Und plötzlich – „Notfall“! Eine Whatsapp-Nachricht meiner Mama hatte meine Illusion eines energiespendenden Tagesausklangs jäh beendet. Kaum gelesen, noch mitten im Wald, rief ich meine Mama zurück. „Es ist wohl nicht viel passiert. Es war ein Autounfall. Mehr weiß ich noch nicht. Papa ist auf dem Weg in die Klinik.“
Meine Schritte wurden schneller. In welche Richtung sollte ich nun bloß weiterlaufen? Wieder retour und nach Hause, zu meinem Auto? Geradewegs weiter, immer der Nase nach in Richtung Stadt?
Ich versuchte, meinen Freund zu erreichen, in der Hoffnung, dass er mich abholen würde. Danach ging alles – wie immer, wenn derartige, obwohl meist etwas kleinere Notfälle unsere Familie betreffen – ganz schnell. Ich erinnere mich nur, wie ich in das Auto meines Freundes eingestiegen bin, der es, schneller als vorerst gedacht, durch den Feierabend-Verkehr aus der Stadt bis zum Waldeingang geschafft hatte, um mich dort aufzulesen.
„Ich habe auch was von einem Geisterfahrer-Unfall gehört“, sagte meine Mama, als ich sie auf der Fahrt ins Krankenhaus nochmals nach ihrem genauen Standort fragte. Notaufnahme.
Einen Zusammenhang mit dem Geisterfahrerunfall, der sich laut Verkehrsmeldungen an jenem Nachmittag auf der Brennerautobahn zugetragen hatte, kam uns keine Sekunde in den Sinn, sodass die oberste Devise für uns erst einmal lautete, die Klinik schnellstmöglich zu erreichen. Zumindest das gelang uns in Rekordzeit.
Ich stieg aus und warf mit einem lauten Knall die Autotüre hinter mir zu, dann öffnete sich die Schiebetüre zur Aufnahme akuter Notfälle langsam – in diesem Moment viel zu langsam – vor mir.
Mama? Zahlreiche Menschen, die vor den verschlossenen Behandlungsräumen auf ihre Angehörigen warten mussten, doch keine Spur von einer blonden Frau mit kurzen Haaren, meist bunt und etwas verrückt, jedoch sehr modisch und immer schick gekleidet. Keine Spur von einer der stärksten Frauen, die ich in meinem bisherigen Leben kennengelernt hatte. Keine Spur von einer meiner besten Freundinnen. Keine Spur von meiner geliebten Mama. Die einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, mich ebenfalls zu einer – wie ich von mir behaupten würde – starken Frau zu machen. Schließlich war sie es, die dafür gesorgt hatte, dass wir ein Leben leben durften, wie es sich andere wohl nur träumen konnten. Dabei war unsere Kindheit weder von übermäßigem Luxus noch von hochkarätig besetzten Events geprägt, wie man es sich vielleicht für die Familie eines bekannten Fußballtrainers vorstellen würde. Viel lieber blieben wir unter uns. Zeit, die wir tanzend in unserem Garten, an Gletscherseen oder beim Würstelbraten vor dem Lagerfeuer verbrachten, in der Mama uns in den Stall zu unseren Reitstunden begleitete, in der wir Bäche aufstauten, um Frösche zu fangen, und Kräuter-Bündel banden oder Zwetschgen pflückten, um sie in der Nachbarschaft verkaufen zu können. Ausgerüstet mit einem alten Leiterwagen und voller Zuversicht, ein paar Schillinge unseres eigenen Geldes verdienen zu können. Dass dieses privilegierte Leben keine Selbstverständlichkeit ist, war unseren Eltern immer wichtig zu vermitteln. Vor allem meinem Papa, der gemeinsam mit drei Brüdern aufgewachsen war und sich zwischenzeitlich das einzige Badezimmer der Zwei-Zimmer-Wohnung nicht nur mit Eltern und Brüdern, sondern auch mit einem ständig wechselnden Untermieter teilen musste. Und obwohl auch seinen Eltern Bescheidenheit nicht nur ein großes Anliegen, sondern auch eine Notwendigkeit gewesen ist, so wusste vor allem mein Opa Walter seinen Söhnen trotz geringer finanzieller Möglichkeiten das ein oder andere Abenteuer zu bieten. Opa war zunächst selbstständiger Frächter gewesen, um sich nach einer diabetesbedingten Netzhautablösung und der daraus folgenden einseitigen Erblindung als Platzwart seinen und seiner Familie Lebensunterhalt zu verdienen. Viel weiß ich nicht von ihm – er ist leider noch vor meiner Geburt verstorben –, doch erzählt Papa bis heute gerne von den damals illegalen Brennerfahrten, die ihm, seinem Bruder Germar und seinem Papa nur durch dessen LKW-Fahrer-Freund ermöglicht wurden. Dieser holte die drei wagemutigen Constantinis meist spätnachts aus der Innsbrucker Gumppstraße ab, um sie am frühen Morgen jenseits der Grenze in Italien ein paar Stunden Süden genießen zu lassen. Diese Stunden verbrachte mein Papa mit Opa Walter und seinem Bruder mit tollen Spaziergängen und Wanderungen, bevor die drei meist nach Einbruch der Dunkelheit wieder an einer Straße warten mussten, um – wieder im Laderaum des LKWs – die Rückfahrt nach Innsbruck antreten zu können. „Passt auf, da sind ganz viele Schlangen!“, hatte mein Opa den beiden Buben immer weisgemacht, bevor sie das Feld in Richtung der Hauptstraße überquerten. Worauf Germar und Dietmar, hysterisch hüpfend versuchten, schleunigst wieder Asphalt unter ihren kleinen Füßen zu spüren. Glücklicherweise ohne dabei jemals von den giftigen italienischen Schlangen gebissen worden zu sein.
In diesen Momenten in der Klinik fühlte ich mich so verloren, wie sich Papa auf dem Feld mit den eingebildeten Schlangen verloren gefühlt haben musste.
Nach einer Ewigkeit, in der ich meine Mama einfach nicht entdecken konnte, drehte ich mich um, ließ die Schiebetür sich – ein zweites Mal viel zu langsam – wieder vor mir öffnen und ging nach draußen. Schnell und mit dem für mich typischen Aktionismus zückte ich mein Handy und wollte gerade Mamas Nummer wählen, als mich ein älterer Herr hinter mir mit einem lauten „Hallo, hier lang, bitte!“ unterbrach. Lautlos, mit einem zögerlichen Lächeln folgte ich ihm. Woher wusste der, wo ich hinmusste? Wer ich war? Der Mann führte mich vorbei an all den betrübt wirkenden Menschen, die vor den mit Schiebetüren verschlossenen Behandlungsräumen der Notaufnahme warten mussten. Vorbei an zahlreichen leeren Warteraum-Sitzen und hinein in einen abgetrennten Bereich.
Eine weitere Schiebetüre entfernt sah ich sie endlich: meine geliebte Mama. Sie saß auf einem der Plastikstühle. Sie wirkte geschockt, traurig, aber unheimlich stark zugleich.
„Das ist die andere Familie. Ihr Sohn war einer der Fahrer“, murmelte sie leise und zeigte mit der geöffneten Hand und einem verhaltenen Lächeln in Richtung der drei anderen Wartenden.
„Hallo.“
„Hallo.“
„Wie geht’s ihm?“
„Wir wissen nicht viel, wir sind gleichzeitig gekommen.“
An viel mehr als diesen Dialog kann ich mich nicht erinnern, bevor sich ein letztes Mal die Schiebetüre viel zu langsam öffnete. Durch den Spalt konnte ich Matthias erkennen, der den Raum betrat. Seine Umarmung gab mir jetzt noch mehr Kraft als sein erster tröstender Blick an diesem Nachmittag im Auto.
„Die Raupe, ich muss die Raupe rausbringen“, sagte ich leise, kaum hörbar, und heute weiß ich nicht, ob diese Botschaft an irgendjemanden außer mir – und vielleicht noch an die Raupe – gerichtet war. Inzwischen hatte neben uns und der anderen Familie auch ein Paar mittleren Alters Platz genommen. Ihr Sohn war offenbar ohne Führerschein gefahren und hatte dabei einen Unfall verursacht. Das war zumindest aus einem Gespräch der beiden herauszuhören, ganz genau konnte und wollte ich den Unfallhergang gar nicht erfahren. Lieber ließ ich mich in diesem Moment von der kleinen, friedlichen Raupe ablenken. Meine Gedanken schweiften zurück zu meinem so abrupt beendeten Waldlauf. Zurück zu den Stunden der Unbekümmertheit, wie ich sie lange nicht gekannt hatte. Unbekümmerte Zeiten durfte ich glücklicherweise in meiner Kindheit viele genießen. Aber über die Jahre meines Erwachsenwerdens hatte ich mehr und mehr Verantwortung übernommen. Mich schon sehr früh durch den aufwendigen Reitsport (Pferde, Pferde, Pferde) und die Adoption meines ägyptischen Strandhundes an Pflichten gebunden. Noch dazu bin ich jemand, der immer für sehr viele Dinge einstehen möchte. Manchmal mit zu viel Einsatz. Dabei verliere ich zwar nie meinen Optimismus, vergesse aber oft, auf meine Ressourcen zu achten. Dieser Aktionismus wurde mir wohl bereits in die Wiege gelegt – immerhin entstamme ich einer überaus aktiven Familie –, vor allem durch meinen Vaters, dessen schier unbändiger Ehrgeiz ihm Zeit seines Lebens eine berufliche Topstation nach der nächsten sicherte. Der gern gesehene, strahlende „Sunnyboy“, wie er bis heute vielfach bezeichnet wird, durfte während seiner aktiven Karriere schließlich so ziemlich jede österreichische Fußballmannschaft unter seine Fittiche nehmen. Und nicht nur das. Obwohl er – wie er von sich immer behauptet – „nie der Schnellste“ gewesen ist, spielte Papa auch selbst bei so mancher Mannschaft im In- und Ausland auf hohem Niveau. Zu verdanken hatte er jene Chancen nicht zuletzt seinem Kampfgeist und der Bereitschaft, stets an seine Grenzen zu gehen.
Dabei hatte seine Karriere relativ unspektakulär begonnen. Als einer von vielen kickte er am Innsbrucker Tivoli, wohin er seinen Vater, der damals dort Platzwart war, schon sehr früh auf den Rasen begleiten durfte. Opa Walter, in Bozen geboren und aufgewachsen, war nach Kriegsende von Italien nach Tirol gekommen und hatte dort meine Oma Johanna, geborene Angerer, kennengelernt. Johanna war zum damaligen Zeitpunkt bereits verwitwet, nachdem sie ein knappes Jahrzehnt vergeblich auf die Rückkehr ihres ersten Mannes aus dem Zweiten Weltkrieg gewartet hatte. Opa Walter konnte sie schließlich dank seiner charmanten Art erobern. Fußball, Kartenspielen und „Paschen“ („Würfelpoker“) sowie gesellige Abende mit Freunden bildeten die Leidenschaften der beiden. Die teilten später auch die vier Söhne, denen Johanna, „Hanni“, und Walter, „Goggl“, nach und nach das Leben schenkten: Nach dem Ältesten, Germar, kam mein Vater im Jahr 1955 auf die Welt, gefolgt von Oskar und Elmar.
Kaum konnte Papa laufen, nahm ihn Walter bereits mit auf den Rasen, sodass die beiden viele der insgesamt 25 Platzwart-Jahre meines Opas gemeinsam verbrachten. Opa Walter zählte stets zu Papas größten Fans und förderte Papas Leidenschaft für das runde Leder von Beginn an.
Trotz jener fehlenden Schnelligkeit schaffte Papa es, dank der familiären Unterstützung und seines unbändigen Ehrgeizes, nach einigen erfolgreichen Einsätzen in Tirols Jugend- und Juniorenauswahl 1975 im Alter von 20 Jahren als Vorstopper, Libero und Mittelfeldspieler in den FC Wacker Innsbruck – und damit in die damalige Profiliga.
„Ich möchte kündigen“, eröffnete er zu jener Zeit seinem Chef in der Innsbrucker Druckerei, wo er eine Lehre als Lithograf absolviert hatte. Als dieser fragte „Warum?“, meinte Papa selbstbewusst, er würde lieber Fußballprofi werden.
Um diesen Traum tatsächlich auch verwirklichen zu können, lief er immer und immer wieder die Bergiselschanze hinauf, erzählt Papa. Die Höhenmeter bis ganz nach oben nahm er oft mehrere Male pro Tag in Angriff. Und das nur, um fitter und schneller werden zu können als vermeintlich talentiertere Spielerkollegen. Sein Fleiß sollte sich lohnen. Bald bildete der Fußball tatsächlich seinen absoluten Lebensmittelpunkt.
In den folgenden vier Jahren, von 1975 bis 1979, spielte er bei FC Wacker Innsbruck in der Profiliga. Während dieser Zeit wurde der „Durchschnittskicker“, wie er sich selbst charakterisierte, mit dem FC Wacker zweimal Meister und hatte im legendären UEFA-Europacup-Spiel vom 2. November 1977 sogar den starken Gegner Celtic Glasgow 3:0 besiegt. Trotzdem zog es ihn nach diesen vier Jahren aus seiner Heimatstadt Innsbruck weg, und er wechselte zum Linzer ASK nach Oberösterreich.
Den Wechsel konnte auch sein damaliger Innsbruck-Trainer Branko Elsner, von dem Papa bis heute schwärmt, nicht verhindern. Der hatte ihn übrigens wiederholt rigoros stoppen müssen, war er doch als ehrgeizigster Spieler für Übertrainings und intensive Extra-Einheiten bekannt.
Diese Zusatzeinheiten machten sich allerdings in Linz bezahlt, wo Papa von 1979 bis 1980 einmal mehr – wie es hieß – die „Spitze des damaligen Konditionszuges“ bildete. Auch menschlich war er ein großer Zugewinn für die Mannschaft. „Der Didi ist als Mensch in Ordnung. Ein lustiger, ehrlicher Bursche und ein kameradschaftlicher Gewinn“, meinte sein dortiger Trainer Dolfi Blutsch, der ihn auch schon mal als „zweiten Bruno Pezzey“ handelte. Auch seinen Spitznamen „Didi“ bekam Papa in jener erfolgreichen Saison beim LASK verpasst.
Aus Innsbruck war der junge Dietmar, jetzt „Didi“, Constantini weggegangen, um nicht mehr hautpsächlich „der Sohn vom Platzwart“ zu sein. Papa hatte schon immer am liebsten selbst die Verantwortung für sein Tun übernommen. Bereits damals war es sein Traum, „einmal in Griechenland oder Italien – jedenfalls im Ausland – zu spielen“. Obwohl er 1981 aufgrund seiner Spielertätigkeit bei der damaligen SPG Raika Innsbruck für eine Saison in seine Heimatstadt zurückgekehrt war, sollte sein Traum vom Auslandsaufenthalt kurz darauf in Erfüllung gehen. AO Kavalla hieß der Verein, für den er noch im selben Jahr in Griechenlands erster Liga kicken durfte.
Das geschichtsträchtige Griechenland war auch der Ort, wo sich meine Eltern kennenlernten. Mama als bekennende Fußball-Laiin hatte in Papa keineswegs den Profi erkannt. Es begegneten einander daher im Jahr 1987 nicht so sehr eine zukünftige Spielerfrau und ein Profikicker, sondern eine zufällig auf Mykonos urlaubende Wienerin und ein Tiroler Naturbursche.
Fast wie damals bei meiner Oma Johanna, die sich auch Zeit gelassen hatte, bevor sie eine Beziehung mit dem charmanten Bozner Walter Constantini einging, dauerte es auch bei meinen Eltern eine Weile, bis sich aus diesem ersten Kennenlernen etwas Ernsthaftes entwickeln sollte. Papa war zum Zeitpunkt jenes ersten Zusammentreffens bereits als junger Trainer tätig und verabschiedete sich anschließend kurzerhand für zwei Jahre ins Königreich Saudi-Arabien. Kurzerhand, wie so oft in diesem Geschäft, in dem nicht nur ein Job den nächsten jagt, sondern die beruflichen Stationen eben auch häufig auf verschiedenen Kontinenten lokalisiert sind. Er hatte sich mittlerweile dem Trainerdasein verschrieben, denn eine Achillessehnenverletzung hatte seiner Spielerlaufbahn nach insgesamt 198 Spielen in der österreichischen Bundesliga und sechs erzielten Toren ein Ende gesetzt.
„Es is a so, es is a Sucht. Trainer is a Sucht. I hab ja des nit erfunden, es ist oanfach so kemmen“, fasste Papa seine große Leidenschaft später in Worte.
Meine Mama, die er im Jahr 1991 dann heiratete, ließ ihn diese berufliche Leidenschaft stets voll und ganz ausleben. „Lieber einen glücklichen Mann, der unterwegs ist, als einen unglücklichen, der nur zu Hause sitzt“, meinte sie.
So begleiteten wir – Mama, meine Schwester Leni und ich – als Dreimäderl-Kommando Papa von allem Anfang an auf vielen seiner Reisen, weshalb unsere Wohnorte während unserer Kindheit in
regelmäßigen Abständen wechselten: Wien, Linz, Niederösterreich, Mainz, Mutters, um schließlich – zur Zeit meines Schuleintritts im Jahr 2002 – den Rest der Kindheit in Telfes im Stubaital verbringen zu dürfen. Damals entschieden die Eltern, unseretwegen doch sesshaft zu werden. Und während wir im Stubaital mit seinen eisigen Gletscherseen, bei spannenden Lagerfeuer-Abenden und Froschfang-Aktionen mehr als beschäftigt waren, trainierte Papa noch viele weitere Mannschaften.
Den Aktionismus, den er auch mir weitervererbt hat – und den ich an diesem Frühsommertag 2019 einmal mehr in mir spürte –, forderte er nicht nur von sich, sondern auch von seinen zahlreichen Spielern: „Wenn er nit rennt, kriegt er eh an Spitz in Hintern, und wenn er rennt, bin i wie a Löwenmutter“, sagte er oft. Aber obwohl er die 150 Prozent, die er sich einst auf der Bergiselschanze selbst antrainiert hatte, stets auch von seinem Gegenüber erwartete, verlor er niemals seine Menschlichkeit, die schon Branko Elsner so an ihm geschätzt hatte.
Bis heute nicht. Bis zu diesem heutigen Tag, an dem meine Gedanken herumirrten und die kleine Raupe immer wieder in ihren Mittelpunkt geriet. Mitten in der Klinik, unter den Piepstönen mir unbekannter Gerätschaften, zwischen Ärztekitteln und Türöffnern, dachte ich daran, dass es ein sehr kurzer Moment auf meiner Waldroute gewesen sein musste, in dem sich die kleine Waldbewohnerin an meinen Laufhosenzipfel gehängt haben konnte.
Nachdem ich erst wenige Minuten in dem für Kliniken typisch kühl wirkenden Warteraum verbracht hatte, beschloss ich, noch einmal nach draußen zu gehen. Schließlich würde in der nächsten Minute nicht viel passieren, und die Raupe hatte sich sicherlich nicht diesen Ort als endgültiges Reiseziel gewünscht. Wenn ich schon hier saß, ohne auch nur den geringsten Einfluss auf die Situation nehmen zu können, so wollte ich zumindest dem Schicksal meines blinden Passagiers eine positive Wendung geben.
Ein weiteres Mal also durch die Schiebetüre. Viel zu langsam öffnete sie sich. Behutsam setzte ich meine kleine, hellgelbe Kameradin auf der einzigen grünen Fläche vor dem Klinikgebäude ab. Wohin sie ihr Weg nun wohl führen würde? In diesem kurzen Moment erschien mir die kleine Raupe als normalster Teil meiner Gegenwart. Die nächsten Stunden, Tage und Wochen sollten mich vor eine vollkommen neue Normalität stellen. Wehmütig entließ ich das friedvolle Tier, und noch bevor die langsamste aller langsamen Schiebetüren sich hinter mir schloss, musste ich an ihren zukünftigen Weg denken: „Auf bald, als Schmetterling!“, möglicherweise ...

Germar, Johanna, Dietmar, der kleine Elmar, Walter und Oskar Constantini (von links) Foto: Constantini

Johanna „Hanni“ Constantini kümmerte sich gemeinsam mit ihrem Mann Walter um ihre vier „Burschen“. Foto: Constantini

Opa Walter mit seinen Söhnen Dietmar, Oskar und Germar (von links) Foto: Constantini

Papas Mama Johanna sorgte sich Zeit ihres langen Lebens liebevoll um ihre „Burschen“... Foto: GEPA

... und unterstützte Papa als Fußballkennerin nicht nur, indem sie ihn über die Schiedsrichter informierte. Foto: GEPA

Walter Constantini förderte seinen Sohn Dietmar, wo er nur konnte. Er selbst war Fan der italienischen Mannschaft Juventus Turin. Foto: Constantini

Für seinen Aktionismus war mein Papa Zeit seiner Karriere bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Foto: Norbert Schmeisser

Tivoli 2016: Lange erinnerte eine Erfolgstafel an Papas Zeiten am Innsbrucker Tivoli. Foto: Constantini

Dank seines Ehrgeizes war Papa als Spieler vielen voraus. Foto: Sündhofer

Als junger Spieler erreichte Papa (ganz links im Bild) je zwei Österreichische Jugend- und Juniorenmeistertitel sowie acht Teilnahmen an UEFA-Spielen, sechs Auftritte beim Amateur- und fünf beim Olympiateam. Foto: Constantin

Lehrabschlussbild 1974: Das Zeichnen und Malen hat Papa im späteren Erwachsenenalter wiederentdeckt. Foto: Constantini
 Erstellt mit Vellum
Erstellt mit Vellum