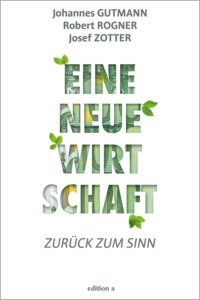Kitabı oku: «Eine neue Wirtschaft», sayfa 2
Die Märchengeschichte über den Kapitalismus
Der größte Trick des Teufels, besagt ein Sprichwort, war es, so zu tun, als gäbe es ihn nicht. Der größte Trick der Monsterwirtschaft ist es, so zu tun, als gäbe es keine Alternativen. Wenn Alternativen entstehen, wehrt sie sich mit allen Mitteln dagegen. Sie kommt mit ihren Verlockungen und verschlingt sie, oder sie treibt ihre Protagonisten in den Ruin.
Im Westen hören wir oft, dass die friedlichen Proteste der osteuropäischen Länder gegen ihre kommunistischen Regierungen in den 1980er-Jahren einzig und allein das Ziel hatten, den westlichen Lebensstil zu kopieren. Das wird gemeinhin als Beleg dafür genommen, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt. Jedes andere Wirtschaftssystem bringt in dieser Sichtweise Armut hervor, wie man sie in den ehemaligen kommunistischen Staaten erlebt hat. Doch so einfach ist es nicht. Die Menschen protestierten nicht bloß gegen ein totalitäres Regime und für den kapitalistischen Westen, sondern auch für eine faire und gerechte Wirtschaft, die solidarisch ist.
Tatsächlich hat die Demokratisierung von Ländern wie Polen oder Ungarn politische Freiheiten für ihre Bürger hervorgebracht, die unter kommunistischer Herrschaft undenkbar waren. Doch auch in diesen Ländern zeigte sich der Kapitalismus bald von seiner hässlichsten Seite. Viele Menschen haben noch heute mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Der Reichtum ist ungleich verteilt. Ungerechtigkeiten haben populistische Parteien an die Macht gespült, die die Demokratie für ein lästiges Übel halten. Politiker wie der ungarische Premierminister Viktor Orbán sprechen von einer »illiberalen Demokratie«, und meinen damit in Wahrheit: Kapitalismus ja, Demokratie lieber nicht.
Die angebliche Alternativlosigkeit zum westlichen Kapitalismus hat in den vergangenen dreißig Jahren jeden Widerstand im Keim erstickt. In den Köpfen der meisten Menschen ist der Kapitalismus mit Frieden und Wohlstand verknüpft. Der Wirtschaft müssen wir alles unterordnen. Solange das Wachstum anhält, wird es uns gut gehen.
Dabei gibt es diese Alternativlosigkeit noch gar nicht lange. In den 1970er- und 1980er-Jahren hatten viele Menschen noch ein Bewusstsein dafür, dass etwas auf dieser Welt falsch läuft. Menschen erkannten, dass unsere Art zu wirtschaften den Planeten ausbeutet und Lebenschancen zerstört. Sie erkannten, dass wir mit unserer Lebensweise zur Vernichtung von Natur und Umwelt beitragen. Diese Denkart lässt sich in einem Satz zusammenfassen:
Der Konsum zerstört den Planeten.
Die Börsenmilliardäre und politischen Amtsträger, die ihren Erfolg dem Wirtschaftssystem verdankten, lachten über die Warnungen der »Öko-Freaks«. Deren Gerede vom Klimawandel, der Vernichtung der Regenwälder, der Vermüllung der Meere und der Vergiftung der Böden klang in ihren Ohren nach einer Schauergeschichte für Kinder. Seither haben die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, die Zerstörung von Lebensraum und die Verschmutzung von Luft und Wasser zugenommen. Die Realität hat die schlimmsten Befürchtungen der »Öko-Freaks« übertroffen.
Einst sollte die Wirtschaft die Menschen auf der ganzen Welt zu einem globalen »Wir« verbinden. Stattdessen ist sie zu einem Monster geworden, das wenige Menschen zu sagenhaftem Reichtum führt, während es den Großteil der Erdbevölkerung mit einem zerstörten Planeten zurücklässt.
Heute kontrollieren rund 2.000 Menschen der Welt mehr Geldvermögen als die ärmsten 4,6 Milliarden. Fast die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt muss jeden Tag mit weniger als anderthalb Euro auskommen. Ein Fünftel von ihnen hat weniger als 75 Cent pro Tag zur Verfügung. Und dennoch bestimmt ein Gesetz die Wirtschaft dieser Welt:
Der Konsum rettet den Planeten.
Wirtschaftsexperten haben dafür eine einfache Erklärung: Ohne Konsum gibt es kein Wachstum, und ohne Wachstum geht die Wirtschaft zu Ende.
Die Finanzwirtschaft hat sich zu einem überfressenen, entkoppelten Monster entwickelt, das ein Eigenleben führt. Nicht mehr die Menschen lenken die Wirtschaft, die Wirtschaft lenkt die Menschen nach ihren eigenen Vorlieben. Ihre Lieblingsdisziplin: Wachstum.
Die Börsenwirtschaft ist zu einem Kasino geworden, in dem die Lust am Zocken keine Grenzen kennt. Die Finanzprodukte heißen Futures, Options, Swaps, ETF’s, CDS, CDO’s. Sie sind das Merkmal einer inneren, tief verwurzelten Habgier, gemischt mit einer ordentlichen Portion Hochmut und einer Prise Hemmungslosigkeit. Wenige Filme haben dieses Phänomen so anschaulich verarbeitet wie Oliver Stones Streifen Wall Street. Darin spielt Charlie Sheen einen jungen Broker an der Wall Street, der an den erfolgreichen und skrupellosen Gordon Gekko (Michael Douglas) gerät. In der berühmtesten Szene des Films fasst Gekko sein Erfolgsrezept in drei Worten zusammen:
Gier ist gut.
Gier hält die Wirtschaft am Laufen. Gier sorgt für das stetige Wachstum. Gier will aus viel Geld noch mehr Geld machen.
Wenn wir das hören, müssen wir uns unweigerlich fragen: Wie konnte es so weit kommen? Wann wurde diese Monsterwirtschaft geboren?
Die Geburt der Monsterwirtschaft
Die Wirtschaft verwandelte sich zu dem Zeitpunkt in ein gefräßiges Monster, als das Geld seinen ursprünglichen Sinn verlor.
Menschen haben schon vor Jahrtausenden damit begonnen, Zahlungsmittel zu verwenden. Das Papiergeld ist eine relativ neue Entwicklung. Davor tauschten die Menschen Muscheln, Getreide, Steine, Salz, Felle, Vieh, Gold oder Silber. Sie zeichneten sich durch ihren hohen Wert aus und waren in beschränkter, aber ausreichender Menge vorhanden.
Die Zahlungsmittel wurden im Alltag auch als Waren, zum Beispiel als Nahrungsmittel oder als Schmuck, eingesetzt. Als Folge der neolithischen Revolution und der beginnenden Arbeitsteilung fingen die Menschen an, Güter zu sammeln und zu speichern.
Dadurch kam es zu einer weiteren wichtigen Änderung: Der einfache Tauschhandel wurde abgelöst von Waren, die an Wert gewinnen konnten, indem man sie ansparte und auf günstige Gelegenheiten wartete. Hatte etwa jemand einen Speicher voller Getreide, während die Felder der anderen Bauern nur eine geringe Ernte abwarfen, stieg der Wert des Getreides automatisch an. Wenn jemand heute mit Aktien oder Immobilien handelt, dann ist das Verfahren viel komplexer, die Grundidee bleibt aber die gleiche.
Die Erfindung des Geldes und die Geschichte vom reichsten Mann aller Zeiten
Bereits in der Antike kamen Menschen auf die Idee, das Warengeld durch Münzen zu ersetzen. Ein Vorteil war ihr stabiler Wert. Ein weiterer, dass sich die Münzen ausschließlich als Zahlungsmittel einsetzen ließen. Eine Münze aus Kupfer oder Silber konnte man schließlich nicht essen oder als Schmuck tragen. Die Idee des Geldes war damit geboren.
Was im Laufe der Jahrhunderte passierte, ist eigentlich unglaublich. Zu Beginn handelten Menschen mit Waren, die nützlich waren. Getreide und Salz konnte man als Nahrung verwenden, Muscheln zu Schmuck verarbeiten, Felle für Kleidung oder Möbel verwenden. Aber was konnte man mit Münzen machen? Genau genommen gar nichts. Genau deswegen eigneten sie sich perfekt als Zahlungsmittel. Ihre einzige Funktion war, Dinge zu erwerben. Sie verfaulten nicht und machten den Wert von Waren vergleichbar.
Vor der Erfindung des Geldes machte es keinen Sinn, einen Preis festzusetzen. Nehmen wir an, jemand will eine Kuh verkaufen. Der erste Käufer bietet ihm drei Säcke Getreide. Der zweite fünf Hühner. Der dritte eine wunderschöne Muschel. Wie entscheidet er sich? Vermutlich danach, was er zum betreffenden Zeitpunkt am dringendsten braucht. Doch mit den Münzen änderte sich die Situation. Plötzlich ließ sich ein Preis festsetzen, der sich daran orientierte, wie dringend der Bedarf eines Produktes war. Es gab eine gemeinsame Verhandlungsbasis, und das war eine Revolution.
Doch wer bestimmte, wie viel eine Münze wert war? Ein Standard war nötig. Im Mittelalter war das der Silberstandard. Der Wert einer Münze ergab sich durch ihren Silbergehalt. Je mehr Silber in der Münze verarbeitet war und je schwerer sie wog, desto wertvoller war sie. Der spätere Goldstandard aus England setzte sich weltweit durch.
Doch es geriet schnell in Vergessenheit, dass dieser Wert künstlich ist. Menschen haben sich darauf geeinigt, zuerst Silber und dann Gold als Standard einzusetzen und den Wert ihrer Münzen und ihrer Scheine davon abhängig zu machen. Wie sich die Standards entwickelten, entzog sich allerdings der Kontrolle. Wenn zum Beispiel sehr viel Silber oder Gold auf dem Markt war, dann verloren die Münzen oder die vom Goldstandard abhängigen Scheine automatisch ihren Wert.
Die Geschichte des Königs Mansa Musa, der im 14. Jahrhundert über das heutige afrikanische Mali herrschte, illustriert das. In Mali gab es große Goldvorkommen, über die er als König allein verfügen konnte. Musa verwaltete einen geradezu sagenhaften Reichtum. Die britische Tageszeitung The Independent berechnete, dass sein Vermögen heute 400 Milliarden US-Dollar betragen würde. Damit wäre er heute einer der reichsten Menschen aller Zeiten.
Als Muslim begab sich Mansa Musa auf den Hadsch, die heilige Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien. Mansa Musa bildete für die beschwerliche Reise eine Karawane von 60.000 Menschen, darunter unzählige Sklaven, und achtzig Kamelen. Jedes dieser Kamele trug 140 Kilogramm Gold auf dem Rücken. Weil eine Pilgerfahrt auch mit Wohltätigkeit verbunden war, verschenkte Mansa Musa unterwegs den Großteil des Goldes.
Musa war offenbar kein großer Ökonom, sonst hätte er die Auswirkungen seiner Großherzigkeit auf die damalige Weltwirtschaft vorausgesehen. Der Wert von Gold brach wegen des Überangebots ein. Schließlich hatte nun jeder genug davon. In Ägypten verteilte Mensa Musa sogar so viel Gold, dass die ägyptische Währung Dinar über Jahre hinweg völlig wertlos wurde. Seine Barmherzigkeit hatte auch für Mansa Musa Folgen. Nach seiner Rückkehr nach Mali war der weltweite Goldstandard so tief gesunken, dass sein Königreich bald darauf zerfiel.
Wie das Geld seinen inneren Wert verlor und ein König dafür mit dem Leben bezahlte
Trotz der Eskapade von Mansa Musa blieb Gold für die meisten Länder der Welt der Währungsstandard. Dann kam der Erste Weltkrieg und Politiker erklärten sich dazu bereit, Unmengen an Geld auszugeben, etwa für die Rüstungsindustrie. An Wirtschaftlichkeit dachte in dieser Zeit niemand, ganzen Staaten drohte ob der Geldflut der Bankrott. Um sie zu verhindern, gaben die Staaten den Goldstandard auf und erfanden das sogenannte Fiatgeld.
Fiat ist lateinisch und bedeutet »es geschehe«. Im volkswirtschaftlichen Sinne bedeutet es, dass der Geldwert politischem Willen unterliegt. Zentralbanken können den Wert des Geldes einfach beeinflussen. Fluten sie den Markt mit Geld, verliert die Währung an Wert. Schalten sie die Druckerpressen ab, tritt der umgekehrte Effekt ein und der Wert des Geldes steigt. Mit dem Fiatgeld wurde jedes Land für seine eigene Geldproduktion und den Wert seiner Währung verantwortlich.
Fiatgeld ist eigentlich keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Immer wieder tauchte es in der Geschichte der Menschheit auf, bezeichnenderweise immer dann, wenn Staaten nach großen Konflikten in einer Krise steckten.
Beispielhaft ist die Geschichte des persischen Königs Gaichatu, der im 13. Jahrhundert lebte. Sein verschwenderischer Lebensstil brachte ihn an den Rand des Bankrotts. Als Persien eine Rinderpest heimsuchte, blickte Gaichatu eines Morgens in die Staatskasse und fand sie leer vor.
Was sollte er tun? Gaichatu druckte einfach sein eigenes Geld. Wer fortan mit seinen eigenen Waren handelte, wurde mit dem Tod bestraft.
Gaichatu hätte im Prinzip die alleinige Kontrolle über das Geld besessen. Doch es kam anders: Die Bürger akzeptierten das neue Geld einfach nicht. Sie stifteten Unruhe, stoppten den Handel und führten die gesamte Wirtschaft zum Zusammenbruch. Königliches Blut zu vergießen, galt zu dieser Zeit als Todsünde. Also erdrosselten die Bürger des Landes Gaichatu mit einer Bogensehne.
Derartiger Widerstand ist vielleicht möglich, wenn sich ein einzelner Despot dazu entschließt, seine Wirtschaft in den Ruin zu treiben. Wenn sich alle mächtigen Staaten der Erde zum Gelddrucken verbünden, ist die Lage eine andere. Genau das geschah um 1930. Fast alle Staaten dieser Erde druckten Fiatgeld. Die Definition lautet wie folgt: Tausch- und Zahlungsmittel mit nominalem, aber ohne inneren Wert.
Bis dahin war es kein einfacher Weg. Die USA mussten den ursprünglichen Goldhandel aufgeben und Gesetze erlassen, die Goldbesitz unter Verbot stellten. Der Plan ging auf. Der Wert des Geldes löste sich vollständig vom Gold. Die Geldpolitik hatte ein neues Werkzeug an der Hand.
Regierungen konnten nun über die Geldpolitik das Niveau der Preise sichern und die Inflation steuern. Wenn eine Regierung klug vorging, kann das ganze Land von dieser Geldpolitik profitieren. Aber es gibt auch Nachteile: Das Fiatgeld verleiht jenen, die die Geldpolitik bestimmen, große Macht. Geld hat keinen materiellen Wert mehr, es verkommt zu einer leeren Hülle und kann nach Belieben der Mächtigen an Wert zu- und abnehmen. Manche Ökonomen sehen deshalb die Erfindung des Fiatgeldes als Entfesselung des Kapitalismus. Die Wirtschaft begann, hypertroph zu werden.
Hypertrophie stammt aus dem Griechischen. In der Medizin bezeichnet es ein Organ oder ein Gewebe, das aufgrund einer Fehlfunktion nicht mehr aufhört, zu wachsen. Es mag von Vorteil sein, wenn unsere Muskeln wachsen, weil wir dadurch stärker werden. Ab einem gewissen Punkt jedoch wird Wachstum gefährlich für den Organismus. Oft wird es sogar tödlich.
Hypertrophie steht für Übermaß. Das Wort passt deshalb zu unserer modernen Wirtschaft. Sie ist maßlos. Sie überschreitet jede natürliche Grenze. Sie agiert längst jenseits jeder Vernunft.
DER KERN IN ALLEM UND JEDEM
Von Robert Rogner
Was ist der Sinn meines Lebens? Diese Frage stellte ich mir lange nicht, denn die Antwort schien von Anfang an klar zu sein. Ich wurde, wie jeder andere auch, in ein familiäres System hineingeboren. Es prägte mich und hinderte mich daran, mir diese Frage zu stellen. Der Sinn meines Lebens schien vom Wirken meiner Eltern bestimmt zu sein.
Mein Vater war Bauunternehmer und weil meine Mutter eine Hotelierstochter war, konzentrierte er sich vor allem auf touristische Projekte. Er baute sie nicht nur, er entwickelte und betrieb sie auch. Dies zum Teil in Osteuropa, das damals noch wirtschaftliches Neuland war.
Mir waren damit die Bauwirtschaft und der Tourismus in die Wiege gelegt worden. Sie gehörten seit meiner Geburt zu meinen wichtigsten Begleitern. Von klein auf spielte ich Baumeister, hörte meinen Eltern zu, wenn sie über neue Projekte sprachen und träumte davon, eines Tages selbst in den wilden Osten zu ziehen und dort zum Helden zu werden. Die Familientradition fortzusetzen, darum ging es in meinem Leben.
Ich machte meine Ausbildung zum Bauingenieur, studierte als perfekter künftiger Junior-Chef nebenbei Wirtschaft, machte an der Rotman School of Management der Universität Toronto, einer Kaderschmiede für Investmentbanker, meinen Abschluss als Global Executive Master of Business Administration und übernahm nach einigen Jahren, in denen ich Assistent meines Vaters war, die Leitung der Rogner Holding. Alles wie geplant und vorbestimmt.
Mit zwanzig Jahren übernahm ich ohne jegliche Erfahrung mein erstes Projekt inmitten des Zusammenbruchs des damaligen Ostblocks: die Revitalisierung eines denkmalgeschützten Gebäudes zu einer Bank im Zentrum von Sofia. In Österreich erwarteten mich dafür viel Lob und Anerkennung. Jetzt kann ich alles schaffen, dachte ich. Ich wurde ein Getriebener, ein Gefangener meines Egos. Ich traf Minister, flog in Privatjets und fuhr einen Porsche. Ich war ein erfolgreicher Repräsentant unseres auf Profit und Effizienz um jeden Preis ausgerichteten Wirtschaftssystems. Weil ich das an die Spitze treiben wollte, entwickelte ich die Vision, institutionelle Anleger ins Unternehmen zu holen.
Die Einladung dazu erfolgte in Form einer sogenannten Road Show. Dort präsentieren sich Unternehmen samt ihrer Wachstumspläne Investmentbankern. Meine Pläne sahen vor, die spektakulären, aber recht unterschiedlichen Projekte meines Vaters miteinander zu verbinden, das Unternehmen an die Börse zu bringen und weiter zu einem internationalen Konzern auszubauen.
Während dieser Road Show saß ich eines Tages in London einem Investmentbanker gegenüber, der ungefähr in meinem Alter war. Er war von meiner Geschichte überzeugt und bereit einzusteigen. »Wir haben vor kurzem ein ähnliches Projekt finanziert. Willst du dich mit dem Betreiber unterhalten?«, fragte er. Es ging um Day-Spas, die damals noch eine Neuheit waren. Ein Mann hatte die Idee gehabt, inmitten der hektischen Großstädte Oasen der Ruhe zu schaffen.
Ich erwartete, dass dieser Mann mir von seinen großartigen Gewinnen berichten würde. Stattdessen erzählte er mir, wie er den Sinn seines Lebens aus den Augen verloren hatte. Seine Vision hatte sich als effizienz- und profitgetriebene Geldmaschine materialisiert, in der es nicht mehr in erster Linie um die Interessen seiner Kunden, sondern um die der Investmentbanker ging. Mit seiner Lust darauf hatte er auch seine Kraft verloren, was ihn noch mehr zum Spielball der Mächte gemacht hatte, denen er sich aus Leichtsinn und Größenwahn ausgeliefert hatte.
Ich flog heim und stellte mir zum ersten Mal die große Sinnfrage. Wozu das alles? Was sollte ich tun? Was war der Sinn meines Lebens?
Auf dem Weg, den ich von da an beschritt, änderte sich meine Umgebung. Menschen, mit denen ich bisher befreundet gewesen war, verschwanden, weil wir einander nicht mehr viel zu sagen hatten. Neue Menschen tauchten auf. Wissenschaftler, Philosophen, spirituelle Führer, Künstler und Unternehmer wie Johannes Gutmann und Josef Zotter, die in diesem Buch ebenfalls von ihrem Weg und ihrem Wirken erzählen werden. Viele von ihnen beeindruckten und beeinflussten mich. Von einigen, wie Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, hätte ich nie gedacht, dass ich je mit ihnen in Beziehung treten könnte. Doch mein wirklicher Lehrmeister bei all dem war nicht ein Mensch, sondern ein Ort.
Dieser Ort befand sich in der steirischen Gemeinde Bad Blumau, wo in den 1970er-Jahren eine Ölfirma statt auf Öl auf heißes Wasser gestoßen war. Die Gemeinde betrachtete den Fund als Chance. Man könne dort eine Therme bauen, befand der Gemeinderat. Er wandte sich an meinen Vater, der die Anlage gemeinsam mit dem Künstler Friedensreich Hundertwasser als Verbindung zwischen Natur und Architektur realisierte.
Als das Rogner Bad Blumau 1997 aufsperrte, wuchsen auf den Dächern kleine Wälder, die Gebäude flossen in Wellenbewegungen über die Landschaft und die Fassaden waren in hunderten organisch aufeinander abgestimmten Farben gehalten. Es gab 330 Säulen, die eine Art Markenzeichen Hundertwassers waren, und mehr als 2.400 Fenster, von denen keines dem anderen glich.
Ich war insgesamt zehn Jahre lang Chef der Rogner Holding und damit auch hauptverantwortlich für das Rogner Bad Blumau. Entsprechend meiner Ausbildung und Prägung sah ich meinen Auftrag darin, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes durch eine bessere Auslastung und Kosteneinsparungen zu steigern. Dabei arbeitete ich mit den bewährten Instrumenten, die ich aus meinem Wirtschaftsstudium kannte. Vor allem setzte ich auf das hochmineralisierte Thermalwasser und investierte viel Geld in dementsprechende klassische Vermarktungsaktivitäten. Mit dem Ergebnis, dass sich niemand dafür interessierte.
Bald bemerkte ich, dass an diesem Ort alles anders lief. Die vermeintlich allgemeingültigen ökonomischen Gesetze ließen sich dort einfach nicht richtig anwenden. Doch je mehr ich losließ, je mehr ich auf das System vertraute, das an diesem Ort anscheinend im wahrsten Sinne des Wortes naturgegeben war, desto besser funktionierte die Anlage. Der Betrieb florierte, aber nicht wegen mir, sondern weil er seinen eigenen Gesetzen folgte.
Ich fing an, in den Ort hineinzuhorchen. Dabei zeigten sich Mönche, die regelmäßig hinfuhren, um im heißen Bad Blumauer Wasser zu baden. »Dieses Wasser ist wertvoll. Es bringt uns in Beziehung zu uns selbst«, sagten sie zu mir. Sie zeigten mir, was ich tun konnte, um diesen Wert zu unterstreichen. Mit klassischem Marketing und Werbung hatte ihr Vorschlag allerdings nichts zu tun.
Sie stellten Kerzen rund um das Becken auf und dimmten das Licht. Sie gingen alle paar Stunden mit Weihrauch durch das Bad, und es funktionierte. Ohne eine einzige Werbebroschüre war der Wert dieses Wassers schlagartig allen klar. Unsere Gäste und auch die Mitarbeiter sahen und schätzten es, weil wir es sahen und schätzten.
Wir bauten um. Bis dahin wollten wir das Wasser so einfach und schnell wie möglich zugänglich, es konsumfähig machen. Nun verzögerten wir die Wege dorthin bewusst. Wir versteckten und hegten das Wasser wie einen wertvollen Schatz. Wir schraubten Wegweiser ab und schickten unsere Gäste, von denen immer mehr kamen, auf eine kleine Reise durch Wandelgänge, über Schwellen und durch Portale. Die Rituale der Mönche behielten wir bei. Dabei hatte ich nicht das Gefühl, den Ort nach unserem Willen zu formen, sondern seinem eigenen Willen zu folgen.
Erfahrungen wie diese veränderte mein Bewusstsein. Mir wurde klar, dass Menschen, Unternehmen und Orte so etwas wie einen inneren Kern haben, und dass, je näher wir diesem Kern kommen, sich alles immer dynamischer und immer richtiger fügt, sich alles am richtigen Platz einordnet. Ich verstand schließlich, dass es der Kern und der Sinn meines Lebens war, mich mit Beziehungen zu beschäftigen, mit meiner Beziehung zu mir selbst und davon ausgehend mit meinen Beziehungen zu anderen Menschen, zu Orten und zur Natur, und mit den Beziehungen von anderen Menschen zu alldem.
Statt einer sinnlosen, krankmachenden, wachstumsgetriebenen Monsterwirtschaft widmete ich mich nun einer sinnvollen, gesundmachenden, qualitätsbestimmten Wirtschaft, die vom Kern, den alle Menschen und alle Dinge in sich tragen, ausgeht.
Wir deckten den enormen täglichen Bedarf des Betriebes von nun an bei regionalen Herstellern, setzten dabei auf biologisch und nachhaltig hergestellte Produkte und entdeckten beispielhaft ein bei uns in Vergessenheit geratenes Ritual neu, das es in allen Kulturen zu allen Zeiten gegeben hatte: Das Händewaschen. Wir wuschen unseren Gästen bei ihrer Ankunft in Bad Blumau die Hände und setzten sie mit dieser für sie überraschenden Intervention in Beziehung zu sich selbst und dem Ort. All dies geschah wie von selbst. Wenn es dabei Unterstützung brauchte, war sie da.
Nach der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 entwickelte ich gemeinsam mit Gutmann und Zotter das Bad Blumauer Manifest. Es entstand ebenfalls aus diesem Ort heraus und forderte dazu auf, den Sinn von Wirtschaft zu hinterfragen. Schließlich gründete ich die Gesellschaft für Beziehungsethik, die Raum für Beziehung schafft und Menschen und Unternehmen bei der Suche nach ihrem Kern begleitet.
Während wir dieses Buch schreiben, entsteht aus der Mitte meiner Beziehungen gerade ein neuer Ort. Er wird Menschen die Möglichkeit geben, sich aus ihrem Alltag, aus ihren Verhaltensmustern und damit auch aus ihren automatisierten Denkmustern herauszubewegen. In Bad Blumau habe ich erfahren, dass dieses sich Herausbewegen aus etwas ein sich Hineinbewegen in sich selbst erfordert, und damit einen Ort, eine Klause zum Beispiel, der uns inspiriert, diesen Weg nach innen zu beschreiten.
Meine »Klause« ist ein Haus aus reinem Holz, ein kleiner Bauernhof, der auf einem Felsen hoch über der Ebene steht. Hinter dem Haus steht eine tausend Jahre alte mächtige Linde, ein magischer Baum, der nicht, wie andere Naturdenkmäler dieser Art, nur noch zum Teil lebt. Jedes Jahr im Frühling begrünt er alle Äste und Zweige seiner gewaltigen Krone neu und frisch. Diese Linde steht dort wie eine Hüterin über das Haus und seine Bewohner, ganz entsprechend ihrer mythologischen Bedeutung von Schutz und Gemeinschaft. Sie steht da auch als kraftvolles Beispiel für ein Leben in Einklang mit der eigenen Natur und gibt Mut darin, sich darauf einzulassen.
An drei Seiten ist das Haus umgeben von dichtem Wald und nach einer Seite fällt der Blick frei und offen weit in das Land hinein. Es steht dort wie ein Leuchtturm und wer sich darin aufhält, kann weit unten zu seinen Füßen sehen, was er verlassen hat und wohin er mit Orientierung und neuen Inspirationen zurückkehren wird: Die Zivilisation mit ihren Lichtern, die in der Nacht da unten leuchten, und mit ihren Straßen, auf denen sich leuchtende Punkte bewegen. Dort oben werde ich in Zukunft leben und Menschen, die nach ihrem Kern suchen, Raum und Schutz gewähren.
Es wird ein guter Platz sein, um zu beten. Denn ich erkannte, inspiriert von den Mönchen in Bad Blumau, auch, dass Beten nichts anderes ist als in Beziehung zu treten mit dem eigenen Kern, mit dem Göttlichen, das in jedem und jeder von uns angelegt ist. Das Handeln aus dem Bewusstsein für unseren Kern heraus ist letztendlich das, was uns in all unserer Individualität zu einem guten Ganzen verbindet, das uns Kraft gibt und uns gemeinsam weiterbringt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.