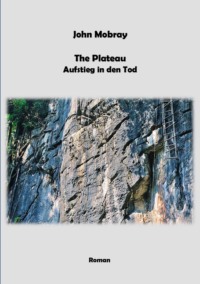Kitabı oku: «The Plateau - Aufstieg in den Tod», sayfa 2
Fred Brown
Er war von den Menschen in seiner Umwelt schon immer als Inbegriff der Durchschnittlichkeit wahrgenommen worden, und er wusste selbst, dass das stimmte. Sein ganzes Leben lang war er nur mit geringem Antrieb von einer Etappe zur anderen weitergestolpert, ohne jemals ernsthaft in Schwierigkeiten geraten zu sein. Irgendwie hatte er verinnerlicht, mit wenig Aufwand das erreichen zu können, was für ihn im Rahmen seiner selbstgewählten Möglichkeiten lag. Große Ansprüche an sich hatte er nie formuliert, und die Meinung anderer Leute über ihn war ihm ziemlich egal. Er wollte eigentlich nichts weiter, als sich ein vernünftiges bürgerliches Leben aufzubauen, in dem dann die Routine dominieren würde. Dazu zählte er die Gründung einer Familie und eine berufliche Karriere, deren Tempo er selbst bestimmen könnte. Da ihm großes Selbstvermarkungstheater fremd war, hatte er sich für ein Jurastudium entschieden. In diesem Metier würden Paragraphen und Fakten zählen, und das kam seiner beherrschten Art entgegen. So wie er organisiert war spulte er die zähen Inhalte beharrlich ab und empfand sogar so etwas wie Befriedigung, wenn er in Fallbeispielen genau auf der Linie der Lösung lag. Diese dröge Logik gab ihm die Gewissheit, dass man ein Leben zumindest in Bezug auf die Rechtsprechung doch in Regeln pressen konnte. Er schloss mit besten Noten ab, und seine Anstellung in einer Kanzlei zeigte ihm mit dem ersten Gehaltscheck, dass er nichts falsch gemacht hatte. Da er offenbar immer die Ruhe behielt und nie die Fassung verlor, wurde er zum Mann für die Fälle mit schwierigen Mandanten. Manchmal fragte er sich selbst, ob er tatsächlich so kalt und gefühllos wäre, und dann war er sich sicher, dass es so war. Er dachte aber kaum darüber nach und ging davon aus, dass jeder Mensch besonders wäre, eben auf seine ganz spezielle Art. Diese Distanziertheit beförderte ihn aber zu einem gefragten Partner vor Gericht, denn seine Verhandlungen waren gut vorbereitet, seine Ausführungen klar strukturiert, und seine Umgangsformen immer verbindlich.
Nach einem Jahr in einer Kanzlei in Detroit war ihm eine Partnerschaft angeboten worden, die er gern angenommen hatte. Sein bereits üppiges Salär könnte nunmehr im Jahr je nach Auftragslage bis zu 1,7 Millionen Dollar betragen. Fred Brown kam aufgrund seiner gut organisierten Arbeitsweise auf ungefähr zehn Stunden Beschäftigung am Tag. Am Samstag setzte er sich mehr symbolisch zu Hause am Vormittag zwei Stunden vor den Laptop und erledigte Dinge, die auch ein Sachbearbeiter hätte tun können, die er aber selbst abhaken wollte um den jeweiligen Fall komplett zu kennen. Meistens ging er dann in der Nähe eine Kleinigkeit essen und legte sich dann zwei Stunden auf die Couch. Danach zockte er an seinem Computer noch eine Weile, ließ Druck beim Ansehen eines Pornos ab und schlief dann entspannt ein.
Über einen Fall kam er an eine recht attraktive Frau heran, mit der er dann ein längeres Verhältnis über knapp anderthalb Jahre hatte. Allerdings fühlte er sich zunehmend eingeengt in seiner Entscheidungsfreiheit und beschloss, zunächst nur seinem Beruf und seinen Neigungen nachzugehen. Das war vermutlich auch besser so gewesen, denn er spürte eine starke Affinität zu pornographischen Bildern von kleinen Kindern. Da er aus dem Fach kam wusste er ganz genau, dass er haarscharf am Rande der Legalität marschierte, aber er vertraute auf die Anonymität des Netzes. Sein Verstand sagte ihm, mit der Sache aufzuhören, aber seine innere Stimme war dagegen. Erst als ein Kinderpornoring öffentlichkeitswirksam aufgeflogen war hörte er damit auf, aber wusste, dass das Internet nichts vergaß, und er für alle Zeiten Leichen im Keller hatte.
Gegen seine grundsätzliche Meinung, allein besser zurecht zu kommen, trat er jedoch eine nicht als rational zu bezeichnende Flucht nach vorn an, um seinem Leben eine angemessene bürgerliche Tünche zu verpassen. Sie hieß Judith und war Lehrerin. Anfangs gefiel ihm ihre Interessiertheit und das gute Allgemeinwissen, wenig später war er von ihren ständigen Belehrungen und Korrekturen nur noch genervt. Aber es war bereits zu spät, sie hatten zwei Kinder: Beth und Nick. Er fand sich damit ab nur der Zweitredner zu sein und sehnte sich nach der Zeit zurück, als er tun konnte, was er wollte.
Doch sein Beharrungsvermögen in diesen Zuständen war deutlich größer als die Energie, seinem Leben noch einmal eine andere Richtung geben zu wollen.
Allan Blacksmith
Wenn er mit einem Kunden einen Auftrag besprach brachte er immer seinen Standardspruch ("Die Qualität meiner Arbeit ergibt sich schon aus meinem Namen") an, und er erreichte immer die gewünschte Wirkung. Tatsächlich betrieb die Familie Blacksmith seit 1884 in der Stadt eine Schmiedewerkstatt, die zur Zeit ihrer Gründung durch seinen Urgroßvater Herbert ihre Arbeit in einem Hinterhof in der Westvorstadt unter übelsten Bedingungen begonnen hatte. Herbert Schmied, ein deutscher Auswanderer, hatte es für sinnvoll gehalten, sich in der Neuen Welt von allem zu lösen, was er in seinem Heimatland zurückgelassen hatte, und dazu zählte auch als besonderes Symbol sein Name. Aus Herbert Schmied wurde Herb Blacksmith, und dieser Name hatte in der Stadt bis heute einen guten Ruf. Anfangs ging es um grobe Schmiedearbeiten für Kutschen und Wagen, später kam ab und an ein Auftrag für einen Schmiedezaun oder eine Tür dazu. Solche Arbeiten nahm Herbert Schmied aus zweierlei Gründen an, obwohl sie wirtschaftlich ein Desaster waren: sie dienten seiner Selbstverwirklichung als Handwerkskünstler, und sie materialisierten das Ergebnis der Arbeit der Firma in der Stadt an exponierten Stellen. Die Zäune waren extrem filigran gearbeitete aber eben auch starke Schutzwälle für die Grundstücke der Vermögenden. Schmied war ein knorriger Westfale, der nur sehr schlecht englisch sprach, aber viel mehr als gedrechselte Worte demonstrierten diese Produkte die Leistungsfähigkeit seiner Firma. Dabei hatte er niemals aus den Augen verloren, dass sein Unternehmen von den Brot-und-Butter-Aufträgen lebte, und das andere eine Art Werbekampagne war. Diese Rechnung war schnell aufgegangen, so dass die "Blacksmith Company" expandieren konnte und ihren Sitz vor die Tore der Stadt verlagerte. Um 1910 hatte sich der Gründer auf das Altenteil zurückgezogen und die Fortführung der Geschäfte in die Hände seiner Söhne Alexander und Phillip gelegt. Beide hatten im Betrieb des Vaters gelernt und wussten von der technischen Seite her, worum es in einer Schmiedefirma ging. Von der Geschäftsführung indes hatten sie keine Ahnung, ließen sich öfter übervorteilen und standen 1914 kurz vor dem Ruin. Der Krieg in Europa half ihnen mit einer guten Auftragslage über die Krise hinweg, aber sie waren nur im operativen Geschäft gefangen, und es gab keine Ideen für die Zukunft. Trotzdem konnten sie das Geschäft aufrechterhalten und es sogar etwas vergrößern. 1919 war Alexanders Sohn Thomas zur Welt gekommen (Phillips Ehe sollte kinderlos bleiben) und dieser stieg 1942 als Metallurgie Ingenieur in "Blacksmith" ein. Alexander und Phillip waren in den Jahren davor auf dem Teppich geblieben und hatten vor allem versucht, den technischen Standard zu verbessern, und keine Expansion im Auge gehabt.
Das sollte sich auszahlen, denn die amerikanische Rüstungsindustrie war extrem hochgefahren worden, und "Blacksmith" wurde aufgrund der hervorragenden Qualität der Produkte zu einem wichtigen Zulieferer für den Panzer- und Flugzeugbau. Zu dieser Zeit wurde in der Familie eine kontroverse Diskussion geführt, ob man nun die Gunst der Stunde für einen großen quantitativen Entwicklungssprung nutzen sollte, oder aber den Status als Qualitätslieferant ausbauen müsste. Letztlich hatte man sich für eine Kapazitätserweiterung und eine erneute Verlagerung der Produktion sowie einen Neubau der Fertigung entschlossen. Da die Kriegswirtschaft alle Ressourcen zu dieser Zeit auffraß, konnte die Produktion erst Ende 1944 wieder ordentlich hochgefahren werden, und es gab in der Anlaufphase erhebliche Qualitätsprobleme. Als Folge davon gingen etliche Aufträge verloren, und Mitte 1945 stand die Firma mit einer hochmodernen Produktionsanlage, aber ohne Auslastung da. Die Liquidität war katastrophal, und nach einer bis 1948 reichenden Phase ohne Besserung wurde "Blacksmith" beerdigt. Alle Vermögenswerte wurden als kaum werthaltig eingeschätzt, und Thomas stand dann mit einem aus der verbleibenden Vermögensmasse erhaltenen Startkapital von 80.000 Dollar da. Der Firmenname würde aber erhalten bleiben. Er war 29 Jahre alt und davon überzeugt, dass "Blacksmith" nur an den Zeitumständen gescheitert war. Verheiratet war er nicht, dafür würde er später vielleicht noch Zeit haben. Er kaufte die nunmehr wertlosen stillgelegten Produktionsanlagen auf und wusste genau, dass er diese energieintensive Produktion nie wieder im Maß der Vergangenheit würde hochfahren können, aber auf einem Bruchteil der Fläche könnte vielleicht wieder etwas produziert oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Was ihn zum Kauf bewogen hatte war auch die Tatsache gewesen, dass er nicht nur die Fertigungsstätte erworben hatte, sondern auch den Grund und Boden, auf dem diese errichtet worden war. Er hatte zu dieser Zeit keineswegs einen Gedanken daran gehabt, dass gerade dieser Faktor wertvoll werden könnte, es hatte einfach zum Geschäft dazugehört. Mit dem Rest seines Startkapitals hatte er eine kleine Kette von Läden für Handwerkerbedarf hochgezogen und die Sache lief blendend. In großen Etappen ließ er die schmutzigen Hinterlassenschaften von "Blacksmith" über einen langen Zeitraum beseitigen, und verfügte nach Abschluss der Arbeiten über ein Grundstück, dessen Wert enorm war. Er ließ es aber unberührt liegen und setzte auf die Zeit, und eine weitere Wertentwicklung. Die Stadt hatte einen heftigen Bevölkerungszuwachs erlebt, und in der Hochphase der Knappheit von Bauland hatte er verkauft.
Gut 40 Jahre später zog "Blacksmith" erneut um. Thomas Tochter Judith hatte war 1951 geboren worden und hatte 1977 Kenneth, einen Studienfreund, geheiratet. Sie bekamen 1980 Marie, 1984 Tim und 1988 Allan. "Blacksmith" war wieder in das Umland der prosperierenden Stadt ausgewichen und hatte nochmals neu gebaut. Der Firmenname war allerdings nur aus der Familientradition heraus erhalten geblieben, denn was in den modernen Hallen und Anlagen neben den Hallen für die Fertigung der Gartenbedarfsartikel des Unternehmens hergestellt wurde, hatte mit der altehrwürdigen Schmiedekunst fast rein gar nichts mehr zu tun. Dass das gesamte Firmengelände des neuen Werkteils rund um die Uhr von bewaffneten Personen bewacht wurde deutete darauf hin, dass dort nicht gerade kleine Heckenscheren für den Gartenbedarf gefertigt wurden, die in "Blacksmith Garden Market" der Renner waren.
“The Needle"
Ungefähr 1.200 Meter vom "Plateau" entfernt stand ein schmaler, etwa drei Meter im Durchmesser großer und knapp 25 Meter hoher Gesteinsturm. Diese Erhebung wurde von den Touristen zwar gehörig angestaunt, aber war für ihre Erfolgsberichte nach dem Urlaub vollkommen nutzlos. Dafür gab es vor allem einen Grund und der war ziemlich banal: keiner der untrainierten Leute hatte es jemals geschafft, den nicht einmal drei Meter hohen Sockel des Gebildes zu erklimmen. Der Fels war wie glattgeschmirgelt, wies kaum Vorsprünge oder Einbuchtungen auf und der Sockel hatte außerdem noch die ungefähre Form einer sich nach oben hin verbreiternden Kaffeetasse. Wer davor oder darunter stand konnte zwar noch an das glatte Gestein über sich greifen aber musste dann gleich konstatieren, dass ein Hochkommen absolut unmöglich war. Die Beschaffenheit des Steins und seine Gestalt machten das unmöglich. Einige besoffene Schlaumeier waren einmal mit einer Klappleiter angerückt, aber entweder waren sie zu betrunken gewesen, oder es war tatsächlich nicht möglich, dort hochzukommen. Im Ergebnis des Versuchs hatte sich einer der Abenteurer leider das Rückgrat gebrochen was die Verwaltung in Yellowknife veranlasst hatte, um die "Needle" herum auffällige Verbotsschilder mit drastischen Strafandrohungen aufzustellen. Der Gesteinsturm lag ohnehin nicht auf dem Weg zu "The Plateau" und kaum jemand kam daran vorbei. Dabei war die "Needle" kaum weniger ungewöhnlich als "The Plateau". Ohne dass es vom aus Boden richtig zu erkennen war, befand sich in zirka 20 Meter Höhe eine Verdickung des Gesteins und gleichzeitige Aushöhlung im Felsen, die ungefähr 80 Zentimeter hoch und etwa 150 Zentimeter breit war, sich über die gesamte Durchmesserbreite von drei Metern längs erstreckte, und fast genau in der Blickrichtung auf die Strickleiter und die obere Plattform des anderen Felsens lag. Im Verlauf der vielen Jahrtausende seit dem Herauswachsen dieser kleinen geologischen Formation hatten Regen und Wind eine recht plane Fläche im Auge der Nadel geschliffen, auf der ein mutiger Mensch durchaus eine Nacht verbringen könnte. Sicher wäre das keine bequeme Art des Aufenthalts, aber ein durchschnittlicher Erwachsener sollte mit dem Platz auskommen können. Aber das war nur eine theoretische Betrachtung, denn wer würde schon auf hartem Felsgrund dort oben liegend irgendeinen Gewinn aus diesem Aufenthalt ziehen können. Noch theoretischer war die Annahme, dass es irgendwer jemals dort hinauf, und auch wieder herunterschaffen könnte.
Es war unmöglich.
Kurt Perlmann
In seiner frühen Kindheit war er in dem großen Familienverbund mit einer Mischung aus Respekt und leichtem Spott das "Riesenbaby" genannt worden, und diese Titulierung hatte er bis heute nicht verloren. Ihn selbst störte das nicht, denn er konnte sehr selbstironisch sein. Vielleicht gab es einen Zusammenhang zwischen seiner beeindruckenden körperlichen Gestalt und seinem Gemüt, so etwa, als würde er aufgrund seiner Konstitution niemals an seiner Stärke zweifeln und damit jeder Situation gelassen entgegentreten können. Das auf den ersten Blick recht grobschlächtige Bild eines möglicherweise intellektuell schlichten Mannes stimmte aber so nicht. Kurt Perlmann war eigentlich künstlerisch-musisch begabt und hatte von seinen Eltern vehement zu seinem sechsten Geburtstag eine Gitarre verlangt. In seiner Familie war der Ton durchaus rau, und seine drei älteren Brüder lästerten unverhohlen über dieses Ansinnen.
"Ich frag mich" hatte Jakob gesagt "wie das Riesenbaby mit seinen dicken Wurstfingern überhaupt die Saiten treffen will. Sehr Euch diese Griffel doch einmal an! Der wird es nie schaffen, der Klampfe vernünftige Töne zu entlocken."
Das sollte sich so bestätigen, aber für Kurt war das nicht entmutigend, denn er war stur und beharrlich und sagte sich, dass er mit viel Übung doch schon irgendwie weiterkommen würde. Ob die Gitarre das richtige Instrument war konnte er noch nicht abschließend einschätzen, aber es sollte schon ein Saiteninstrument sein, keines mit Tasten. Jedenfalls übte er weiter und es erschien ihm wichtig, besonders die Finger seiner linken Hand ordentlich koordinieren zu können. Das gelang ihm nach und nach immer besser, aber tatsächlich bereiteten ihm seine großen Finger Probleme. Er konnte seine Finger zwar schnell auf dem Griffbrett setzen, aber das Problem der Größe seiner Hände ließ sich eben nicht aus der Welt schaffen. Nach zwei Jahren Training gab er auf, weil er nie über ein halbwegs passables Spielen hinauskommen würde, und das befriedigte ihn nicht. Zu dieser Zeit hatte er in der Schule mit erheblichen Lerndefiziten insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern zu kämpfen und er merkte, dass er nur mit immensen Anstrengungen im Stoff mitkommen könnte. Da er sich ungern helfen ließ biss sich selbst durch und in dieser Phase war ihm klar geworden, dass er nicht unbedingt ein mit allzu großer Logik gesegneter Mensch war, und sich vieles würde erarbeiten müssen, was anderen keine Mühe bereitete. Er wusste aber auch, dass er dass er auf musikalischem Gebiet etwas erreichen könnte, wenn er das für ihn passende Instrument finden sollte. Dabei lag das schon ziemlich klar auf der Hand und es war ausgerechnet sein Vater, der ihm den entscheidenden Anstoß gab.
"Weißt du Kurt" hatte er gesagt "als ich früher Rockmusik gehört habe war klar, wer die Chefs auf der Bühne sind. Erst kommt der Sänger, dann der Gitarrist, der Schlagzeuger, falls es einen gibt, der Keyboarder, und zum Schluss der Bassist. Ich sehe noch wie heute Mick Jagger, Jon Anderson von "Yes" oder Robert Plant vor mir. Wobei mir Plant immer etwas steif und ungelenk erschien, aber seine Stimme war schon der Hammer. Jagger war eine alte Rampensau, und Anderson derjenige, der alle zur Liebe bekehren wollte. Aber all deren Theater war nur möglich, weil sie weitere Könner um sich herum hatten. Jimmy Page an der Gitarre, Keith Richards, der alte Saufaus an der Klampfe. Im Hintergrund hauten die Drummer auf die Pauken und zupften die Bassmänner ihre Melodien. Man kann ja heute mit Software die Parts der einzelnen Musiker mal aus einem Song rausnehmen, also meinethalben mal den Bass verschwinden lassen. Wie klingt das dann? Scheiße! Warum versuchst du es nicht noch einmal mit einer Bassgitarre?"
Da Kurt mittlerweile einen vernünftigen Lernrhythmus gefunden hatte fiel für ihn wieder mehr Freizeit zum Üben ab. Mit 16 Jahren war er soweit, sich nach einer Band umzusehen. Zu dieser Zeit wusste er selbst nicht genau wie sein Leben weitergehen sollte, aber er musste sich langsam Gedanken über seine berufliche Zukunft machen. Bis zum Abschluss der 12. Klassenstufe an der High School blieben ihm noch zwei Jahre. Auf der Bassgitarre waren seine Fähigkeiten recht beachtlich, und nicht mit seinen Anfängen auf der Akustikgitarre vergleichbar. Er beherrschte nunmehr komplizierte Basslinien und spielte schnell, sicher und sehr sauber. Ob das allerdings ausreichen würde um als Profimusiker seinen Unterhalt verdienen zu können konnte er selbst nicht bewerten. Auch deswegen zog es ihn jetzt auf die Bühne, um sich dort ausprobieren zu können.
Kurt Perlmann war mit seinen mittlerweile 33 Jahren unter den Bassisten eine Institution. Er vereinte in seinem Spiel beste Technik und bekam schnelle Läufe ohne Mühe hin, aber das machte keinen Unterschied zu den anderen Gitarristen, die handwerklich genauso gut waren. Was ihn von den anderen abhob war seine Experimentierfreude. Und wenn er weiter so kreativ bleiben würde, könnte er eines Tages zu den ganz Großen seiner Zunft gehören.
Dave Brody, der Junge
Seine Mutter war zweimal in eine Suchtklinik eingewiesen worden, als sich ihr Problem nicht mehr unter den Teppich kehren ließ. Bei einem Einkauf war sie offensichtlich volltrunken zusammengebrochen und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. In ihrem Blut war ein Alkoholgehalt von 3,2 Promille festgestellt worden. Der Arzt hatte Richard Brody klipp und klar erklärt, dass seine Frau dabei wäre, sich in das Grab zu trinken. Eine Ultraschalluntersuchung hätte zudem ergeben, dass sowohl Leber als auch Bauchspeicheldrüse irreversibel geschädigt wären, und es letztlich nur eine Frage der Zeit wäre, bis sie sterben würde. Selbst bei einem sofortigen und absolutem Alkoholverzicht würde es nur noch für einen kurzen Aufschub des Unabänderlichen reichen, der Zug wäre längst schon abgefahren. Ob er, Richard Brody, denn gar nichts vom Problem seiner Frau mitbekommen hätte, hatte der Arzt noch wissen wollen. Doch hatte er zugegeben, aber er wäre gar nicht mehr zu ihr vorgedrungen, sie wäre wie verschlossen gewesen. Dann hätte er eben professionelle Hilfe holen müssen war der Arzt laut geworden, aber vermutlich wäre der heile Schein wichtiger gewesen, wie er es einschätzen würde.
Richard Brody hatte die langen Jahre seit dem Ausbruch der Suchtkrankheit seiner Frau ständig das Gefühl gehabt, mit den Angelegenheiten seines Lebens überfordert zu sein. Anfangs hatte sich alles so glücklich gefügt, sie liebten sich, er kam in seinem Job voran, dann wurden die Kinder geboren. Als er die ersten Anzeichen des Alkoholismus bei Alice bemerkt hatte war er der Überzeugung gewesen, dass sie einfach mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau unzufrieden war. Er versuchte sie zu bewegen sich im Ort irgendwie ehrenamtlich zu engagieren, so dass sie vielleicht eine sinnvolle Aufgabe finden könnte, die sie mit Gleichgesinnten zusammen bewältigen könnte. Aber zu dieser Zeit war seine Frau bereits in einen Abwärtsstrudel aus Langeweile, Unterforderung und einer beginnenden Depression gefangen. Selbst wenn er es richtig gewollt hätte, er hätte ihr niemals richtig helfen können. Stattdessen hatte er die Augen zugemacht, und die Dinge einfach laufen lassen.
Dave Brody würde es seinem Vater nie verzeihen können, dass er aus falscher Scham und Angst vor einer schlechten öffentlichen Meinung nicht gehandelt hatte. Er selbst erlebte ständige Sticheleien in der Schule und wusste auch nicht, wie er sich dagegen wehren sollte. Er war aber zu dieser Zeit gerade einmal zehn Jahre alt gewesen, sein Vater aber ein erwachsener Mann, von dem man Tätigwerden verlangen konnte.
2004 war Alice Brody an Leberzirrhose gestorben, und danach war ihr Mann zusammengebrochen. Er wusste wohl sehr gut, dass seine Schuld an dem Drama hoch war. Dave wurde in die Rolle des Familienoberhauptes gedrängt, da sein Vater nur noch apathisch reagierte, aber wenigstens noch seinem Job nachging, so dass Geld glücklicherweise kein Problem war. Dave richtete alle Aufmerksamkeit auf seine jüngere Schwester Lea, um diese vor bösartigen Meinungen von außen zu bewahren, und er entzog sie dem Einfluss seines Vaters immer mehr. Mahlzeiten nahm er mit ihr zusammen ein, sein Vater musste allein essen. Er betreute sie in schulischen Dingen, ging mit ihr Kleidung kaufen, redete mit ihr. Sein Vater war nur noch Luft für ihn.
Richard Brody war als Bezirksleiter eines Baustoffhändlers zu einem großen Teil seiner Arbeitszeit bei seinen Kunden vor Ort. Das hatte für ihn immer ein Reiz dieses Jobs ausgemacht: im Büro erarbeitete er die Verkaufsplanungen und rechnete die Zahlen durch, aber dann ging er mit dem Firmenwagen auf die Reise. Selbstverständlich ließ er sich diese Touren von seinen Vorgesetzten absegnen. Was er aber in welcher Zeit schaffte, ob er tatsächlich stundenlang verhandelte, oder welche Strecken er fuhr, das war einzig und allein seine Entscheidung. Brody war gewieft genug geworden, auch die vielen kleinen Annehmlichkeiten mitzunehmen. Eine Einladung zum Essen da, einen entspannten Plausch im Ferienanwesen eines Großkunden, ein Schmiergeld für bevorzugte Belieferung, es kam einiges zusammen. Obwohl er innerlich kaputt war, gab er nach außen hin immer noch den stets positiv daherkommenden Verkäufer, der alle Probleme aus dem Weg räumen konnte. Das tat er auch mit großer Routine, aber immer mehr wie ein Automat.
Das, was er erlebt und zu verantworten hatte, konnte er nicht wie ein bisschen Schweiß auf der Stirn wegwischen. Es saß in seinen Gedanken und bohrte gnadenlos. Er konnte kaum noch schlafen. Nach einem Geschäftstermin am Vormittag war er zu seinem Firmensitz aufgebrochen. Wie sich dann bei den Ermittlungen herausstellen sollte, war sein Blut vollkommen rein von Alkohol oder Drogen gewesen. Sein letzter Besuch beim Hausarzt hatte eine gute und beschwerdefrei Konstitution bescheinigt. Allem Anschein nach war Richard Brody ein ziemlich gesunder Mann Anfang der vierziger Jahre gewesen.
Vermutlich war es nur Pech gewesen, dass er von einem entgegenkommenden maroden VW T3 vorn schräg links erwischt, und von der Straße gerammt worden war. Brodys Auto hatte sich mehrfach überschlagen und war dann an einen Baum geschleudert worden. Brody selbst war aus dem aufplatzenden Wrack herausgeschleudert und an einen weiteren am Unfallort stehenden Baum katapultiert worden. Die Obduktion zeigte später, dass er kaum noch einen unversehrten Knochen im Leib hatte. Sein Unfallgegner, ein zweiundsiebzigjähriger Hippie, hatte bis unter die Schädeldecke voller Gras gestanden und war vollkommen unverletzt geblieben. Der Mann hatte sich verplaudert und zugegeben, dass er sich im Augenblick der Kollision gerade in eine Urinflasche entleert hatte, weil er keine Möglichkeit zum Anhalten gefunden hätte. Die Schuldfrage an dem Unfall war somit eindeutig geklärt gewesen.
Für Dave Brody und seine Schwester Lea war dieses Ereignis zwar kein Jubeltag, aber ein Lichtblick gewesen. Richard Brody hatte eine Lebensversicherung für sich laufen gehabt. Obwohl die Versicherung alle möglichen und unmöglichen Einwände gegen eine Auszahlung der Versicherungssumme ins Felde führten, musste sie schließlich 1,435 Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto einzahlen.
Wenn Dave Brody 18 Jahre alt wäre, könnte er darauf zugreifen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.