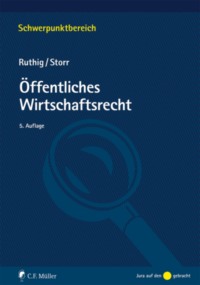Kitabı oku: «Öffentliches Wirtschaftsrecht», sayfa 12
2. Richtlinien
94
Gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV ist die Richtlinie für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, überlässt diesen aber die Auswahl von Form und Mittel, die sie für die Erreichung des Zieles als geeignet ansehen[237]. Auch im Wirtschaftsrecht wird daher die Richtlinie immer dann eingesetzt, wenn die Besonderheiten des nationalen Rechts möglichst weitgehend gewahrt bleiben sollen. In einigen Fällen wurde aber auch mit dem Instrument der Richtlinie eine weitgehende Harmonisierung erreicht (s. zum Regulierungsrecht Rn 496). Die Umsetzung einer Richtlinie durch die Mitgliedstaaten muss vollständig, genau und innerhalb der in der Richtlinie gesetzten Frist erfolgen. Sie muss es den Betroffenen ermöglichen, von ihren Rechten und Pflichten Kenntnis zu erlangen, um sie vor den nationalen Gerichten geltend machen zu können. Eine bloße innerstaatliche Verwaltungspraxis oder eine Umsetzung durch Verwaltungsvorschriften ohne Außenwirkung gegenüber dem Bürger genügt daher nicht[238]. Für den Fall, dass diese Anforderungen nicht eingehalten werden, hat der EuGH drei Durchsetzungsmechanismen entwickelt: Die unmittelbare Wirkung, die richtlinienkonforme Auslegung und die Staatshaftung[239].
a) Unmittelbare Anwendbarkeit von Richtlinienbestimmungen
95
Obwohl diese sich ihrem Wortlaut nach nur an die Mitgliedstaaten richten, leitet der EuGH auch aus Richtlinien unmittelbar wirkende Rechte Einzelner gegenüber einem Mitgliedstaat ab (vertikale Wirkung)[240]. Bei fehlender oder fehlerhafter Umsetzung kann sich der Einzelne auf eine konkrete Richtlinienbestimmung berufen, sofern sie „inhaltlich unbedingt und hinreichend genau“ ist. Inhaltlich unbedingt ist eine Bestimmung, wenn sie vorbehaltlos und ohne Bedingung anwendbar ist und keiner weiteren Maßnahme seitens der Mitgliedstaaten oder der Union bedarf. Hinreichend genau ist sie, wenn sie unzweideutig eine Verpflichtung begründet, also rechtlich in sich abgeschlossen ist und als solche von jedem Gericht angewandt werden kann[241]. Liegen die Voraussetzungen einer unmittelbaren Anwendbarkeit vor, haben nicht nur die nationalen Gerichte, sondern auch alle anderen staatlichen Stellen diese trotz möglicherweise entgegenstehenden nationalen Rechts von Amts wegen anzuwenden.
Voraussetzung der unmittelbaren Anwendbarkeit ist außerdem der Ablauf der Umsetzungsfrist. Mögliche Wettbewerbsverzerrungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die aus einer zeitlich unterschiedlichen, aber fristgemäßen Umsetzung resultieren, sind hinzunehmen[242]. Die unmittelbare Wirkung beschränkt sich allerdings auf das Verhältnis zu den Mitgliedstaaten. Allerdings wird der Begriff der staatlichen Stellen dabei weit verstanden. Der Umstand, dass im Verhältnis zwischen Privaten eine sog. horizontale unmittelbare Richtlinienwirkung ausgeschlossen ist[243], bedeutet allerdings für das öffentliche Recht keineswegs, dass eine (mittelbare) Belastung Dritter ausgeschlossen ist, wenn sich ein Privater auf umwelt- oder wirtschaftsrechtliche Richtlinienbestimmungen beruft (sog. mittelbare Horizontalwirkung)[244].
b) Richtlinienkonforme Auslegung und Anwendung der GRCh
96
Das vom EuGH entwickelte Instrument der richtlinienkonformen Auslegung ist fester Bestandteil der Durchsetzungsmechanismen des europäischen Rechts. Danach sind auch unverändert gebliebene Vorschriften des nationalen Rechts „im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen“[245]. Dieses Gebot gilt unabhängig von der Umsetzung ab Inkrafttreten der Richtlinie[246] und betrifft insbes die Generalklauseln. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind alle Träger öffentlicher Gewalt zur Durchsetzung der Ziele einer Richtlinie verpflichtet. Diese Auslegung ist unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den das nationale Recht ihnen einräumt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Unionsrechts vorzunehmen[247]. Grenzen findet die richtlinienkonforme Auslegung auf nationaler Ebene im eindeutig entgegenstehenden Wortlaut eines Gesetzes[248] und unionsrechtlich in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbes in den Grundsätzen von Rechtssicherheit und Rückwirkungsverbot[249]. Die richtlinienkonforme Auslegung führt aber auch zu einem Vorrang unionsrechtlicher Maßstäbe vor dem nationalen Verfassungsrecht (s. schon Rn 41 ff).
Zum einen wird durch Richtlinien auch der Anwendungsbereich der GRCh eröffnet. Diese gilt für die Mitgliedstaaten bei der „Durchführung von Unionsrecht“; dazu gehört in jedem Fall[250] das richtliniengeprägte Verwaltungshandeln und damit fast das gesamte öffentliche Wirtschaftsrecht (zu den Konsequenzen für Informationsansprüche Rn 129 ff). Dies begrifft allerdings nicht nur die materiellen Grundrechte, sondern auch die Anforderungen an den effektiven Rechtsschutz. Insoweit wird auch Art. 19 Abs. 4 GG verdrängt durch Art. 47 GRCh, aber auch die „einfachrechtlichen“ Konkretisierungen in den Richtlinien, zB für das Telekommunikationsrecht in Art. 4 Abs. 1 S. 2 RahmenRL. Bereits die Entscheidung zum Verhältnis von effektivem Rechtsschutz und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen hat bestätigt, dass der EuGH diesem Grundsatz herausragende Bedeutung zumisst[251]. Es überzeugte daher nicht, wenn BVerfG und BVerwG in diesem Zusammenhang die zu Art. 19 Abs. 4 GG entwickelten Maßstäbe anlegten[252]; dieser Ansatz ist aber durch die jüngste Rechtsprechung des BVerfG zum Vorrang des Unionsrechts (vgl oben Rn 42 f) wohl überholt[253]. Damit verdrängen jedenfalls im richtliniengeprägten öffentlichen Wirtschafts- und Umweltrecht die europäischen Anforderungen an ein faires (gerichtliches und behördliches) Verfahren die nationalen Standards[254]. Dies betrifft nicht nur Art. 47 GRCh (dazu schon Rn 40), sondern in besonderer Weise auch das Verwaltungsverfahren. Zu den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Richtlinien tritt zunehmend das „Recht auf gute Verwaltung“ des Art. 41 GRCh (zu den angloamerikanischen Wurzeln schon Rn 18)[255].
3. Vereinbarkeit von Verordnungen und Richtlinien mit dem Primärrecht
97
Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 und 2 AEUV) wird die Union nur im Rahmen ihrer Zuständigkeit tätig (vgl ▸ Klausurenkurs Fall Nr 1). Davon zu unterscheiden ist die Frage nach dem Rangverhältnis. Ähnlich wie zwischen Verfassungs- und einfachem Recht ist auch im Unionsrecht der Grundsatz der Normhierarchie anerkannt. Das Primärrecht nimmt die oberste Rangstufe ein,[256] genießt also Vorrang vor dem sekundären Unionsrecht[257]. Nach der Rechtsprechung des EuGH[258] bildet es „Grundlage, Rahmen und Grenze“ der von den Unionsorganen erlassenen Rechtsakte. Insoweit kann auch Sekundärrecht gegen die Grundfreiheiten verstoßen.
Davon zu unterscheiden sind die Konsequenzen für die Prüfung der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem Unionsrecht. In der Literatur wird dem (spezielleren) Sekundärrecht Vorrang vor den Grundfreiheiten zugebilligt[259]. Praktische Anwendungsfälle sind zB die Garantie effektiven Rechtsschutzes in den Telekommunikationsrichtlinien (näher Rn 40). Teilweise wird dies damit begründet, es sei schon der Tatbestand der Grundfreiheiten nicht eröffnet, da die Verbürgungen der Grundfreiheiten durch die Richtlinien in konkrete, abgegrenzte Rechte und Pflichten ausformuliert und konturiert werden würden[260]. Der EuGH scheint zu differenzieren. In einigen Entscheidungen erachtet er den Anwendungsbereich der jeweiligen Grundfreiheit als eröffnet und berücksichtigt einschlägiges Sekundärrecht erst auf der Ebene der Rechtfertigung[261]. In anderen Fällen stellt er hingegen heraus, dass eine nationale Maßnahme, die den Mitgliedstaaten durch eine Richtlinie gestattet wird, schon tatbestandlich nicht gegen die Grundfreiheiten verstößt[262]. Die Differenzierung orientiert sich am Regelungsgehalt der Richtlinie. Soweit sie auf Konkretisierung der Grundfreiheiten angelegt ist, entscheidet in erster Linie die Richtlinie und damit der Unionsgesetzgeber über die Rechtfertigung von Beschränkungen der Grundfreiheit. Dieses jucidial self restraint erklärt auch, dass der EuGH dann den Sachverhalt nicht zusätzlich am Primärrecht überprüft[263], sondern in einem „erst-recht-Schluss“ Einschränkungsmöglichkeiten einer Richtlinie auf nur vom Primärrecht geprägte Sachverhalte überträgt[264].
98
Fall 7a (Rn 89):
Im Rahmen der Begründetheit ist zu unterstellen, dass die Anforderungen der VO eingehalten sind[265]. Nach Art. 36 Abs. 1 AEUV stehen die Bestimmungen des Art. 35 AEUV Beschränkungen nicht entgegen, die aus bestimmten Gründen, ua zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, gerechtfertigt sind[266]. Dabei ist zu beachten, dass der EuGH bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung den Schwerpunkt auf die Erforderlichkeit legt und die Angemessenheit einer Maßnahme idR nicht gesondert prüft[267]. Erforderlich ist sie insbes deswegen, weil der Markt allein die Sicherstellung von Qualitätsstandards für bestimmte traditionelle Produkte nicht erreichen konnte. Hierfür hielt der EuGH die Herstellung im Ursprungsland für erforderlich. Er erstreckte dies sogar auf Abfüllen/Verpacken und Zubereiten, worin der GA einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit gesehen hatte, weil solche Standards überall eingehalten werden könnten und jedenfalls eine entsprechende Kennzeichnung genüge[268]. Auf der Grundlage der GRCh legt der EuGH gegenüber Verordnungen strengere Maßstäbe an[269].
Fall 7b (Rn 89):
Würde sich die Regelung demgegenüber in einem delegierten Rechtsakt befinden, würde dies sowohl gegen den Wesentlichkeitsvorbehalt des Art. 290 Abs. 1 wie gegen den grundrechtlichen Wesentlichkeitsvorbehalt des Art. 52 Abs.1 GRCh verstoßen.
§ 2 Der unions- und verfassungsrechtliche Ordnungsrahmen › IV. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen: Grundrechtlicher Schutz wirtschaftlicher Betätigung
IV. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen: Grundrechtlicher Schutz wirtschaftlicher Betätigung
99
Fall 8:
| a) | Apotheker A betreibt in Mannheim die A-Apotheke. Die Apothekerkammer legte ihm zur Last, er habe seine Berufspflichten als Apotheker und die Berufsordnung durch unzulässige Werbung verletzt, indem er Verkaufsschütten und Werbetafeln aufgestellt und in der Nachbarschaft Werbezettel verteilt habe, mit denen er die Aufmerksamkeit der Kunden auf sein nicht apothekenpflichtiges Nebensortiment (Säuglingsnahrung, Körperpflegeartikel sowie Frucht- und Gemüsesäfte) richten wollte. Wegen dieser Vorfälle wurde er durch Urteil des Berufsgerichts für Heilberufe zu einer Geldbuße von 15 000 € verurteilt. Er habe durch sein Verhalten aber nicht nur gegen Rechtsvorschriften verstoßen, sondern auch andere Apotheker in Zugzwang gebracht und in Kauf genommen, einen ruinösen und die Arzneimittelversorgung beeinträchtigenden Konkurrenzkampf der Apothekeninhaber untereinander auszulösen. Nach Erschöpfung des Rechtswegs erhebt A Verfassungsbeschwerde. Wie wird das BVerfG entscheiden? |
| b) | A sieht sich auch durch das Verbot der Werbung für apothekenpflichtige Waren in seinen Grundrechten verletzt. Könnte er unmittelbar gegen § 10 HeilmittelwerbeG Verfassungsbeschwerde erheben? |
| c) | Könnte er im Internet Informationen zu apothekenpflichtigen Arzneimitteln anbieten? |
100
Fall 9:
Bürger B hat das Vertrauen in die Bankenaufsicht verloren und will sich lieber selbst von der Bonität seines Kreditinstituts überzeugen. Er beantragt deshalb auf der Grundlage des IFG bei der BaFin Einsicht in die dort vorhandenen Unterlagen. Diese wird ihm mit der Begründung verweigert, eine Preisgabe dieser Informationen verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht der Behördenmitarbeiter. Die Bundesanstalt dürfe die ihr und ihren Bediensteten bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstige Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse des beaufsichtigten Instituts oder eines Dritten liege, nicht unbefugt offenbaren.
101
Fall 10:
Bei einer Betriebskontrolle wurden in der Mainzer Filiale einer bundesweit vertretenen Backhauskette B gravierende Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften festgestellt.
| a) | Die Behörde will den Betrieb unter namentlicher Nennung auf eine Internetliste aufnehmen, auf der sie die Liste ihrer Beanstandungen veröffentlicht. Könnte sie auf der Grundlage ihrer Informationen auch ein Ranking der besten Bäckerei in der Stadt veröffentlichen? |
| b) | Das privat betriebene Internetportal TopfSecret ermöglicht es Verbrauchern, bei den zuständigen Behörden die Ergebnisse von Hygienekontrollen bei Unternehmen elektronisch abzufragen und die herausgegebenen Berichte dann auf einer Website der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. V begehrt mittels dieser Plattform Auskunft über die Kontrollberichte aus der Mainzer Filiale. Die Behörde hält dies für rechtsmissbräuchlich. Bundesweit würde mit gezielten Abfragen, die alle die Backhauskette B beträfen eine Kampagne vorbereitet. |
102
Fall 11:
Der Gesetzgeber beschließt formell ordnungsgemäß folgende Regelung: Die Gaststättenerlaubnis ist zu versagen, „wenn der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer nachweist, über die zum Betrieb einer Gaststätte erforderliche Sachkunde zu verfügen. Diese umfasst insbes die Kenntnis der lebensmittelrechtlichen Vorschriften sowie der betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Grundlagen. Der Nachweis ist durch einen Lehrgang mit Abschlussprüfung zu erbringen“. Ist das Gesetz verfassungsgemäß?
1. Allgemeine Grundrechtslehren
a) Funktionen der Grundrechte
aa) Grundrechte als Abwehrrechte
103
Freiheitsrechte fungieren auch im öffentlichen Wirtschaftsrecht primär als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe[270]. Die Vorschriften des öffentlichen Wirtschaftsrechts müssen sich also vor allem an den Grundrechten der Gewerbetreibenden messen lassen. Nach der allgemeinen Definition ist ein Eingriff jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich des konkreten Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht. Auf die vom Staat gewählte Handlungsform kommt es dabei nicht an. Jeder Eingriff muss aber nicht nur den Anforderungen an das Verhältnismäßigkeitsprinzip genügen, sondern bedarf nach der Lehre vom Vorbehalt des Gesetzes einer gesetzlichen Grundlage. Als „vorverlagerte Verteidigungslinie der Grundrechte als Abwehrrechte“[271] verlangt dieses zentrale Element des Rechtsstaatsprinzips nicht nur, dass überhaupt eine gesetzliche Grundlage für einen Grundrechtseingriff vorhanden ist, sondern auch, dass die wesentlichen Entscheidungen durch den Gesetzgeber getroffen werden (sog. Parlamentsvorbehalt)[272]. Dies gilt insbes für intensive Grundrechtseingriffe[273]. Dabei ist die Intensität keineswegs zwingend von der gewählten Handlungsform abhängig (zur Eingriffsqualität staatlicher Information s. Rn 133 f). Umstritten ist die Reichweite des Gesetzesvorbehalts im Bereich der Leistungsverwaltung, wo diese Frage vor allem im Zusammenhang mit staatlichen Subventionen relevant wird (dazu unten Rn 780 ff).
Einerseits hat das BVerfG zu Recht die Lehre vom Totalvorbehalt abgelehnt, so dass grundsätzlich die Aufnahme der Subventionsmittel in einen Haushaltsplan genügt[274]. Strengere Anforderungen gelten dann, wenn die Subventionierung gleichzeitig in Grundrechte der Konkurrenten eingreift, insbesondere bei der Pressesubvention[275] bzw im Schutzbereich des Art. 4 GG[276]. Nicht abschließend geklärt ist die Frage des Grundrechtsschutzes gegen sonstige Subventionen, die einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das BVerfG tendiert zu einer Ausweitung des Gesetzesvorbehaltes. Dann nämlich, wenn der Gesetzgeber Vorteile im beruflichen Wettbewerb schafft, bedeutet die Verweigerung des Vorteils einen Eingriff in die Berufsfreiheit. Dies wiederum wird keinesfalls nur bei Subventionen, sondern auch in anderen Zusammenhängen relevant[277]. Allerdings relativiert sich die Bedeutung der Grundrechte überall dort, wo die Rechtsprechung eine besondere Schwere des Grundrechtseingriffs verlangt.
104
Nur selten führt der Grundrechtseingriff freilich zur Verfassungswidrigkeit wirtschaftsverwaltungsrechtlicher Normen. Grundrechte wirken in aller Regel normintern; unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume lassen ausreichend Raum für eine verfassungskonforme Auslegung. Die Bedeutung der norminternen Grundrechtswirkung kann jedoch kaum überschätzt werden. So ergibt sich beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen einer berufsbezogenen Genehmigung grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung dieser Genehmigung.
Vor allem aber ergeben sich Konsequenzen für den Rechtsschutz. Haben grundrechtlich geschützte Rechtsgüter eine verfassungsmäßige Konkretisierung in einfachgesetzlichen Rechtsvorschriften erfahren, sind diese im Zweifel verfassungskonform im Sinne subjektiver Rechte der Betroffenen auszulegen[278]. Gleichzeitig schließen solche einfachgesetzlichen Vorschriften wegen ihrer Spezialität einen unmittelbaren Rückgriff auf Grundrechte aus. Normextern wirken Grundrechte daher eher selten. Doch auch dann ist ihre Wirkung keinesfalls auf die mögliche Verfassungswidrigkeit einer Regelung beschränkt. Sie können auch für den Rechtsschutz relevant werden. Es liegt in der Logik des subjektiven Grundrechtsschutzes auch gegenüber dem Gesetzgeber, den Grundrechten dann eine normexterne Wirkung zuzubilligen, wenn der Gesetzgeber es versäumt hat, den grundrechtlich gebotenen Mindestschutz[279] durch unterverfassungsrechtliche Vorschriften zu gewährleisten[280].
bb) Schutzpflichten
105
Lediglich unter engen Voraussetzungen gewähren die Grundrechte auch einen Anspruch auf staatlichen Schutz bestimmter Freiheitsräume[281]. Diese jedenfalls bei einzelnen Grundrechten ausdrücklich anerkannte Pflicht trifft in erster Linie den Gesetzgeber, dem bei der Erfüllung der Schutzpflicht eine weite Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsfreiheit zusteht[282]. Für die Exekutive werden die Schutzpflichten im Zusammenhang mit der Ermessensausübung relevant, sie können jedoch keine Eingriffskompetenzen schaffen. Mit Bezug auf die Wirtschaftsgrundrechte spielen die Schutzpflichten herkömmlich nur eine untergeordnete Rolle. So ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern die hier primär einschlägigen Grundrechte der Art. 12 und 14 GG überhaupt Schutzpflichten begründen. Jedenfalls aber gewähren die Grundrechte (und insbes Art. 12 GG) keinen Schutz vor der Konkurrenz Dritter, auch nicht vor der Konkurrenz des Staates. Auch der Schutz Dritter vor den Gefahren wirtschaftlicher Tätigkeit dürfte angesichts des erreichten Niveaus kaum Ansprüche gegen den Gesetzgeber begründen[283]; am ehesten wäre ein Anspruch auf präventive Kontrolle bei besonders gefährlichen Tätigkeiten denkbar[284]. Allerdings kann sich ein Anspruch auf Einschreiten gegenüber der Aufsichtsbehörde ergeben (indem sich deren Ermessen auf Einschreiten reduziert). Grundrechtliche Schutzpflichten, wie sie sich aus anderen Grundrechten und insbes Art. 2 Abs. 2 GG ergeben, spielen allerdings als Schranke unternehmerischer Tätigkeit eine Rolle, etwa beim Nichtraucherschutz in Gaststätten (dazu Rn 126; ▸ Klausurenkurs Fall Nr 2). Auch das Verbraucherinformationsrecht lässt sich teilweise mit der grundrechtlichen Schutzpflicht begründen[285]; allerdings argumentiert das Informationsverwaltungsrecht allgemein aus dem Blickwinkel eines für die behördliche Tätigkeit geltenden Transparenzgebotes (vgl Rn 133). Dogmatisch von der Schutzpflichtdimension zu unterscheiden ist die Frage einer grundsätzlich abzulehnenden unmittelbaren Grundrechtsgeltung im Verhältnis zu Privaten.