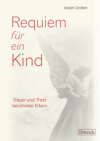Kitabı oku: «Requiem für ein Kind», sayfa 7
Der Tod des »Grand Dauphin«
Im April 1711 verlor Ludwig seinen einzigen legitimen Sohn, den »Grand Dauphin«, den Liebling der Pariser, der Armee und der einfachen Menschen. Er war der Einzige, der es wagte, vor dem König das Thema der verelendeten Bauern aufzuwerfen. Bis dahin war er fast nie krank gewesen, und jeder erblickte in ihm den zukünftigen König. Aber in seiner Residenz von Meudon wurde der Dauphin am Abend des 8. April plötzlich von heftigen Kopfschmerzen befallen. Am nächsten Tag zwang die Migräne den leidenschaftlichen Jäger, eine Jagdpartie abzubrechen und sich niederzulegen. Die herbeigeeilten Hofärzte befürchteten, dass er von den Pocken angesteckt sei, und ihre Diagnose erwies sich als zutreffend. Schon am nächsten Tag war das Schlimmste nicht mehr auszuschließen. Der Dauphin träumte mit offenen Augen. Die Ärzte ließen ihn mehrfach zur Ader. Der König verbot den Zugang zum Zimmer des Dauphins. Nach einer kurzen Besserung erfolgte dann das jähe Ende am 14. April. Monsieur de Sourches schreibt: »Gegen sieben Uhr abends begann er mit dem Tod zu ringen, er starb um elf Uhr.« Schon eine halbe Stunde später ließ der König seine Karosse vorfahren und kehrte zurück nach Marly. Erst drei Stunden nach seiner späten Ankunft konnte er sich niederlegen, da er fürchtete, vor übergroßem Schmerz zu ersticken (»appréhendant d’étouffer, tant sa douleur était grande«.)
Zwei Tage später schrieb Madame: »Ich habe den König gestern abend um elf Uhr gesehen, er ist so niedergeschlagen, daß es einen Felsen erweichen könnte; (»il est en proie à une telle affliction qu’elle attendrirait un rocher«) … er spricht mit jedermann mit einer gefaßten Traurigkeit und gibt seine Befehle mit großer Festigkeit, aber jeden Augenblick steigen die Tränen ihm in die Augen, und er erstickt sein Schluchzen. Ich habe einen tödlichen Schrecken, daß er selbst krank werde, denn er sieht sehr schlecht aus. Ich bedaure ihn mit ganzer Seele.« – Bei einer Sitzung des Staatsrates war das Gesicht des Monarchen tränenüberströmt, so dass auch die Minister alle zu weinen begannen.
Auch Personen, die sich früher über seine Frömmigkeit lustig gemacht hatten, waren tief beeindruckt von seiner Ergebenheit, seiner Unterwerfung unter den Willen Gottes. Ein großer Trost für den König war, dass der Beichtvater seines Sohnes ihm versicherte, dieser habe vor seinem christlichen Ende noch seine Ostern gehalten. Sobald der König sich über das Seelenheil seines Sohnes beruhigt hatte, führte er selbst so fromme Gespräche, dass sie vielen zu Herzen gingen.
Der Dauphin wurde schnell und fast heimlich in der königlichen Nekropole von Saint-Denis beigesetzt. Einerseits bestand große Ansteckungsgefahr. Andrerseits bemühte sich der König, seine Tränen in der Öffentlichkeit zu verbergen. Als Familienvater und sehr empfindlicher Mensch war er zutiefst von diesem Verlust betroffen. Er durfte seiner persönlichen Trauer indes keinen zu starken Ausdruck verleihen, sonst hätte man ihm vorgeworfen, die zahllosen Schwierigkeiten und Unglücksfälle seines Königreichs zu vergessen.
Manche Historiker glauben, dass Frankreich mit diesem sehr humanen und beliebten Dauphin seinen vielleicht besten König verloren habe, trotz der abfälligen Urteile, die Saint-Simon in seinen »Memoires« über ihn gefällt hat.
»Gott straft mich, ich habe es wohlverdient«
Zu Beginn des nächsten Jahres wurde der nächste Thronanwärter, der älteste Sohn des Grand Dauphin, der Duc de Bourgogne, zusammen mit seiner Gattin Marie-Adelaïde, der Dauphine, von einer geheimnisvollen und jähen Krankheit, – man vermutet, dass es die Masern waren –, dahingerafft. Die Dauphine starb als Erste, am 12. Februar. Ludwig XIV. schrieb über diesen Verlust an seinen Enkel, den spanischen König Philipp V, am 16. Februar 1712:
»Ich habe meine Tochter, die Dauphine, verloren, und obschon Sie wissen, wie sehr sie mir immer lieb gewesen ist, können Sie sich den Schmerz nicht richtig vorstellen, den ihr Verlust mir verursacht …« (»J’ai perdu ma fille, la Dauphine, et quoique vous saviez à quel point elle m’a toujours été chère, vous ne pouvez encore vous représenter assez la douleur que sa perte me cause.«) Die Dauphine, eine Prinzessin von Savoyen, war noch keine 26 Jahre alt. Ihr jugendfrischer Charakter hatte die allzu ernste Atmosphäre des Hofes stark gelockert, zur großen Freude des Königs. Sogar Madame de Maintenon musste zugeben, nicht ohne Neid, dass die junge Frau von jedermann geliebt wurde. (»Elle se fait aimer de tout le monde.«)

Ludwig XIV. umgeben von den drei Thronfolgern
Einige Tage später, am 18. Februar, folgte der Dauphin seiner Gattin in den Tod. Über diese neue Hiobsbotschaft schrieb der Monarch: »Sie werden die Mehrung meines Schmerzes verstehen, wenn Sie den Tod des Dauphins erfahren. Das sind in wenig Tagen zwei schreckliche Prüfungen, die Gott über mich verhängt hat, um mich seinen Befehlen zu unterwerfen.« (»Ce sont en peu de jours deux terribles épreuves que Dieu a voulu faire de ma soumission à ses ordres.«) Lieselotte von der Pfalz schrieb an ihre Tochter, dass die Ärzte die arme Prinzessin auf dem Gewissen hätten.
Der zweite Dauphin war von Fénelon erzogen worden, der danach getrachtet hatte, aus ihm einen modernen Telemachos zu machen. Auch er hatte hohe Hoffnungen geweckt, vor allem in der gebildeten Klasse. Ein Satz, den er im Salon von Marly ausgesprochen hatte, hatte für beträchtliches Aufsehen gesorgt: »Die Könige sind für die Völker da, nicht die Völker für die Könige.« Der Abstand zum berühmten Ausspruch des absolutistischen Sonnenkönigs »L’État, c’est moi!« war gewaltig. Der Akademiker Dangeau schrieb über diesen Verlust: »Mit ihm ist der weiseste und frömmste Fürst gestorben, den es vielleicht auf Erden gegeben hat.« Der Maréchal de Tessé schrieb, die Hand Gottes sei schwer über Frankreich niedergefallen, indem sie dem Land einen Fürsten von so hohen Tugenden geraubt habe.
Kurze Zeit später, am 8. März 1712, starb der älteste Sohn des zweiten Dauphins, der Urenkel des Königs und dritte Thronanwärter, der Duc de Bretagne, im Alter von 5 Jahren. Er war nur 19 Tage lang Dauphin gewesen.
Dem Marschall Villars gegenüber äußerte sich der König über seine Verluste: »Es gibt wenig Beispiele dessen, was mir zustößt, daß man in derselben Woche (sic) seinen Enkel, seine Schwiegertochter und deren Sohn verliert, in die alle ich hohe Hoffnungen gesetzt hatte und die ich zärtlich liebte. Gott straft mich, ich habe es wohlverdient; ich werde darum weniger im Jenseits leiden …« (»Il y a peu d’exemples de ce qui m’arrive, et que l’on perde dans la même semaine son petit-fils, sa belle-fille et leur fils, tous de très grande espérance et tendrement aimés. Dieu me punit, je l’ai bien mérité; j’en souffrirai moins dans l’autre monde …«).
Die Pfalzgräfin notierte: »Man spricht ›im Allerheyligsten‹ weder vom Krieg noch vom Frieden. Man spricht ebenfalls nicht von den drei Dauphins und der Dauphine aus Angst, den König ins Grübeln zu bringen … Sobald er dieses Kapitel berührt, spreche ich sofort von andern Dingen, und ich tue, als ob ich nichts vernommen hätte.« (24.3.1712)
Die wiederholten Todesfälle in der königlichen Familie riefen Angst und Bestürzung auch beim französischen Volk hervor. Die einen erblickten darin einen »Fluch«, den Zorn Gottes gegen den König und gegen die Zustände am Hofe, andere erwogen die Hypothese von Giftmorden. Vor allem Philippe von Orleans, der zukünftige Regent, den jeder Sterbefall näher an den Thron rückte, wurde von manchen verdächtigt, die Hand im Spiel zu haben. Aber der König nahm kaum Notiz von diesen bösen Gerüchten.
Die heutige Geschichtsschreibung glaubt, für die mysteriöse Serie von Todesfällen eine plausible Erklärung gefunden zu haben: Die Ignoranz der Leibärzte Fagon und Boudin. Die königlichen Patienten sind das Opfer ihrer Ärzte geworden, die bei hohem Fieber zu einem probaten Allheilmittel griffen: zum Aderlass. Dadurch verhinderten sie, dass die Krankheit ausbrach und normal bis zur Heilung verlief – aber sie sprachen damit ein Todesurteil über die Kranken aus. Dieser Verdacht wurde schon damals geäußert, aber die Leibärzte, in die Enge getrieben, behaupteten, die Autopsie habe den Beweis einer Vergiftung erbracht. Molières Farcen über die Scharlatanerie und Wichtigtuerei der Ärzte, vor allem in seinem »Malade imaginaire« (1672) mit den standardisierten Prüfungsantworten von »seignare und purgare«, haben durch die Ereignisse des Jahres 1712 eine tragische Aktualität gewonnen, fünfzig Jahre nach der Aufführung des »Eingebildeten Kranken«, die Molière selbst das Leben kostete.
Das geistige Vermächtnis
Ab März 1712 hing die ganze Zukunft der Dynastie von dem vierten Dauphin, Louis duc d’Anjou, ab, der am 15. Februar 1710 geboren worden war. Auch er wurde von den Röteln befallen, genas aber paradoxerweise, – oder ganz natürlich – weil seine Gouvernante, die Herzogin von Ventadour, das Krankenzimmer absperrte und die Ärzte nicht zu ihm ließ. (»S’est opposée catégoriquement aux médecins«.) Die Krankheit nahm einen normalen Verlauf, und das Kind blieb am Leben, zur großen Schande der Ärzte. (»Cet enfant a été sauvé à la honte des médecins«, wie Lieselotte schrieb.) Nach der Régence wurde dieser vierte Dauphin im Jahre 1725 in der Kathedrale von Reims als Ludwig XV. gesalbt und gekrönt.
Ludwig XIV. traute dem Schicksal nicht mehr. Im Jahre 1714 änderte er das Grundgesetz über die Thronnachfolge, indem er auch seine unehelichen Nachkommen als erbberechtigt anerkannte. Auch sie waren von »königlichem Blute«, und wenn es um das Überleben der Dynastie ging, glaubte der König sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt berechtigt.
Als der Sonnenkönig sein Ende nahen spürte, erhielt er am 24. August 1715 die Sterbesakramente und nahm in seltsamer Gelassenheit Abschied von seinen Höflingen. Dann ließ er seinen fünfjährigen Urenkel an sein Sterbebett kommen, um ihm sein geistiges Vermächtnis mitzuteilen, das auch ein vernichtendes Urteil über seine Herrschaft beinhaltete: »Mein Kind, Sie werden ein großer König sein. Ahmen Sie mich nicht nach in der Freude, die ich an Gebäuden und an Kriegen hatte; bemühen Sie sich im Gegenteil, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben. Geben Sie Gott, was Sie ihm schuldig sind; erkennen Sie die Verpflichtungen an, die Sie ihm gegenüber haben; lassen Sie ihn durch Ihre Untertanen ehren. Folgen Sie immer den guten Ratschlägen; bemühen Sie sich, das Leben Ihrer Völker zu erleichtern, was ich nicht fertiggebracht habe und worüber ich sehr unglücklich bin.«
Als am 31. August die Sterbegebete für ihn gesprochen wurden, betete der König mit lauter Stimme das Ave Maria und das Credo. In seinen Memoiren überliefert Saint-Simon, dass die letzten Worte des Sonnenkönigs gewesen sind: »O mein Gott, komm mir doch schnell zu Hilfe!«
Ludwig XIV. starb in Versailles am 1. September 1715 im Alter von 77 Jahren. Er hinterließ ein durch seine Eroberungskriege und seine maßlose Prunksucht völlig ruiniertes Königreich. »Niemand weinte ihm eine Träne nach«, wird berichtet. Die Nachwelt vergaß schnell den ruhmvollen Titel »Louis le Grand«, den man ihm in den Glanztagen seiner Herrschaft verliehen hatte.
François Bluche: Louis XIV. Fayard. Paris 1986.
Michel de Grèce: L’envers du Soleil. Louis XIV. Paris 1979.
Nancy Mitford: Le Roi-Soleil. Gallimard. Paris 1968.
Dirk Van der Cruysse: Madame Palatine, princesse européenne. Fayard. Paris 1998.
Bernd-Rüdiger Schwesig: Ludwig XIV. Rowohlt. Reinbek 1986.
Ziegler: Les coulisses de Versailles. Paris 1963.
PETER DER GROSSE UND EUDOXIA
Der tragische Tod des russischen Thronerben ist ein untypischer Extremfall im Rahmen dieser Darstellungen. Wo sonst in der Regel ein unabwendbares und unerbittliches Schicksalsgesetz den Verlust des Kindes verursachte, stand in diesem Fall eine persönliche Entscheidung des Vaters. Vor das Dilemma gestellt, entweder sein gesamtes politisches Lebenswerk, die radikale Reformierung des russischen Imperiums, oder seinen Sohn zu opfern, glaubte sich der Zar gezwungen, der Staatsraison zu gehorchen. Er wurde damit, notgedrungen und widerwillig, selbst mitverantwortlich für den Untergang des Zarewitschs. Der ungewöhnlich komplexe Sachverhalt erfordert ein weiteres Ausgreifen der Vorgeschichte.
Nach dem Tod seines Vaters, des Zaren Alexej (1645–1676), und seines Halbbruders, des Zaren Theodor (1676–1682), wurde Peter 1682, im Alter von zehn Jahren, zum Zaren gekrönt, gemeinsam mit seinem Halbbruder Iwan. Diese Doppelherrschaft war ein Kompromiss zwischen den Familien der beiden Gattinnen des Zaren Alexej, den Miloslawskis und den Naryschkins, die einen unerbittlichen Kampf um die Macht im Kreml führten. Da beide Jungzaren aber nicht imstande waren, die Herrschaft wirklich anzutreten, setzte ihre 25-jährige Schwester Sophie, eine sehr ehrgeizige und intelligente Frau, es durch, dass sie zur Regentin bestellt wurde und so die Macht jahrelang ausüben konnte.
Kurze Zeit später ließ sie das Gerücht ausstreuen, ihr Bruder Theodor sei von der Naryschkin-Familie vergiftet worden und auch ihr Bruder Iwan sei bedroht. Daraufhin brach ein Aufstand der Strelitzen aus, der Garde des Kremls, die sich der meisten Mitglieder und Anhänger der Naryschkin-Familie bemächtigten und sie niedermetzelten. Seit der 10-jährige Thronfolger diese Schreckensszenen im Kreml erlebt und selbst um sein Leben gezittert hatte, hasste er die Hauptstadt Moskau, wo er sich nur noch ungerne aufhielt. Dieses Jugendtrauma gehörte mit zu den Gründen, die ihn später an der Ostsee eine neue Hauptstadt gründen ließen. (Ähnlich war der 10-jährige Ludwig XIV. durch den Aufstand der Fronde (1642) traumatisiert worden, was auch die Gründung der neuen Königsresidenz Versailles stark beeinflusste.)
Bis zu seinem 17. Lebensjahr hielt sich Peter fast ausschließlich auf dem Lande, in Kolomenskoje, auf und kam nur nach Moskau, um protokollarische und repräsentative Pflichten auszuüben. Er erhielt zwar keine geordnete geistige Ausbildung, aber er erlernte zahlreiche Handwerke und füllte seine Zeit mit Kriegsspielen aus. Er ließ immer neue Waffen, Kanonen und Pulver kommen und hielt wahre Manöver ab. Immer mehr junge Adlige scharten sich um ihn, unterwarfen sich einer eisernen militärischen Disziplin und bildeten schließlich zwei Regimenter von je 300 Soldaten, die den Kern der späteren Armee Peters darstellten. Auf einem See, 120 km nördlich von Moskau, baute er mit zwei holländischen Seeleuten mehrere kleine Schiffe und manövrierte mit ihnen wie mit einer Kriegsflotte. Die Regentin Sophie, die auf die Treue der 20.000 Strelitzen zählte, sah mit Nachsicht und Geringschätzung auf die »Spiele« des jungen Zaren herab.
Im August 1689, als Peter 17 Jahre alt war, kam es zur Kraftprobe zwischen den beiden »Gegnern«. Viele Strelitzen schlugen sich auf die Seite des Zaren, so dass Sophie schließlich abdanken und sich in das »Neujungfrauenkloster« bei Moskau zurückziehen musste, wo sie ihre letzten 15 Lebensjahre verbrachte.
Der Aufstieg Russlands zur Großmacht
In wenigen Jahren revolutionierte Peter den rückständigen russischen Staat. Zuerst unternahm er – »inkognito« mit einem großen Gefolge, aber schnell erkannt wegen seiner außergewöhnlichen Größe von 2 Metern – eine zweijährige Reise nach dem Westen, um alle technischen und kulturellen Errungenschaften gründlich kennenzulernen und um geschulte Spezialkräfte für seine Reformpläne anzuwerben. In Holland arbeitete er als einfacher Zimmermann auf einer Schiffswerft. Er besuchte England, Deutschland, Polen, Österreich. Um einen Zugang zum Meer zu finden, führte er jahrelang Kriege mit der Türkei, wobei ihm fast der Durchbruch zum Schwarzen Meer gelang. Der »große nordische Krieg« (1700–1721) gegen Schweden, die führende Seemacht in der Ostsee, begann mit der Niederlage von Narwa (1700). Aber in der Schlacht von Poltawa (1709) wurde der Schwedenkönig Karl XII. vernichtend geschlagen und musste in die Türkei fliehen. Beim Friedensschluss von 1721 gewann Russland große Teile der baltischen Staaten. An der sumpfigen Newa-Mündung hatte Peter schon 1703 Sankt Petersburg gegründet, die neue Hauptstadt, das »Fenster nach dem Westen«.
Russland wurde gewaltsam, gegen manche Widerstände im Adel, im Klerus und im Volk, und unter unermesslichen Opfern, zu einem modernen Imperium mit einer starken Armee, einer großen Flotte. Die übermenschliche Leistung, die größtenteils das persönliche Verdienst des Zaren war, brachte ihm 1721 offiziell den Beinamen »der Große« ein.
Eudoxia und Katharina
Die Bilanz im privaten Bereich ist weit weniger glänzend. Als Peter 17 Jahre alt war, suchte ihm seine Mutter eine Frau unter den adligen Mädchen Moskaus aus, Eudoxia Lopuchin, die drei Jahre älter war. Es wurde eine in jeder Hinsicht unglückliche Verbindung. Zwar gebar Eudoxia dem jungen Peter zwei Söhne, den Zarewitsch Alexej im Jahre 1690 und Alexander (1692), der schon nach einigen Monaten starb, aber der Zar nahm so wenig Anteil am Schicksal seiner ungeliebten Gattin, dass er nicht einmal zum Begräbnis seines jüngsten Sohnes erschien. Jahrelang mied er Eudoxia und suchte nur nach einer Gelegenheit sich ihrer zu entledigen. Als Alexej acht Jahre alt war, wurde er seiner Mutter gewaltsam entrissen, sie selbst wurde in ein Kloster nach Susdal gebracht. Zehn Monate später nahm Eudoxia den Schleier unter dem Namen Helene. So hatte Peter seine Freiheit wiedergewonnen.
1703 begegnete ihm ein junges litauisches Bauernmädchen, Martha Skawronski, das seine Geliebte wurde. Sie hatte sich zur Orthodoxie bekehrt und den russischen Namen Katharina angenommen. In ihr fand der Zar die »ebenbürtige« Frau: mutig, aufgeschlossen, tatenfreudig. In seinen epileptischen Anfällen war sie es, die ihn beruhigte, in kritischen Lagen war sie es, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stand. 1712 heirateten Peter und Katharina mit großem Pomp und sie wurde jetzt offiziell als Zarin anerkannt. Sie gebar zwölf Kinder, sechs Knaben und sechs Mädchen. Zehn davon starben sehr jung. Es überlebten Anna, die Mutter des späteren Zaren Peters III., und Elisabeth, die von 1740 bis 1762 als Zarin herrschte. Katharina selbst folgte ihrem Mann auf dem Thron als Katharina I. (1725–1727).
Die Erziehung des Zarewitschs
Das Verhältnis Peters zum Thronfolger war nie sehr herzlich, allmählich wurde es immer schwieriger. Zuerst vernachlässigte der Zar das Kind, da er zu sehr mit seinen Schiffen, seinen Kriegen und seinen Reformen beschäftigt war und die Mutter seines Sohnes verachtete. Später ließ er ihn durch deutsche Gelehrte erziehen, die ihm große sprachliche und wissenschaftliche Kenntnisse sowie moralische Grundsätze beibrachten. Einer seiner Erzieher berichtete an Leibniz über die Anlagen und Fortschritte des Prinzen: »Ich finde bei ihm einen großen Hang zur Frömmigkeit, zur Gerechtigkeit, zu geradem Sinn und zu sittlicher Reinheit. Er liebt die Mathematik und die Fremdsprachen und zeigt einen starken Wunsch, fremde Länder zu besuchen. Er möchte Deutsch und Französisch gründlich beherrschen. Er hat schon Tanzstunden zu nehmen begonnen und unternimmt militärische Übungen, die ihm viel Vergnügen bereiten. Der Zar hat ihm erlaubt, das Fasten nicht streng einzuhalten, aus Angst, seine Gesundheit und seine körperliche Entwicklung zu gefährden, aber aus Frömmigkeit weist der Prinz jede Vergünstigung in dieser Hinsicht zurück.«
Aber der Zarewitsch konnte sich nie für die kriegerischen Pläne seines Vaters begeistern. Nur ungern wohnte er dem Stapellauf eines neuen Schiffes bei. Er liebte die alten Traditionen, verkehrte viel mit orthodoxen Geistlichen und weilte lieber in Moskau mit seinen unzähligen Kathedralen, Kirchen und Klöstern als in Sankt Petersburg mit seiner westlichen Architektur und seinem Hafen. Infolgedessen beschloss der Zar, seinen Sohn noch stärker westlich erziehen zu lassen und ihm eine Frau aus dem Westen zu suchen.