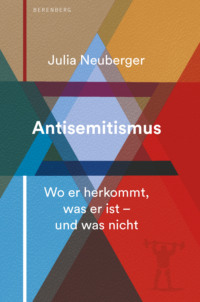Kitabı oku: «Antisemitismus», sayfa 3
Wiederauflage der »Protokolle der Weisen von Zion«
Wer in den sozialen Medien nur einen kurzen Blick auf muslimische, ultralinke und ultrarechte Seiten wirft, muss verzweifeln angesichts dessen, was dort alles verbreitet wird. IsraHell für Israel ist ein gängiger Ausdruck, und besonders deprimierend ist die Fülle der Bezüge auf die Protokolle der Weisen von Zion.
Die Protokolle der Weisen von Zion ist ein antisemitischer Text, der erstmals 1903 in Russland erschien und vorgeblich einen jüdischen Plan für die Erlangung der Weltherrschaft beschreibt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er, in zahlreiche Sprachen übersetzt, weltweit zum Bestseller. Der namhafte ultrarechte Antisemit Henry Ford finanzierte den Druck von 500.000 Exemplaren, die in den 1920er Jahren überall in den USA verbreitet wurden. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verordneten einige Lehrer den Text ihren Schulkindern als Pflichtlektüre. Die Protokolle, die der renommierte Historiker Norman Cohn als »Vollmacht zum Völkermord« bezeichnete,27 wurden vom NS-Staat für seine judenfeindliche Propaganda genutzt, obwohl die Times in London sie bereits 1921 als Fälschung entlarvt hatte.
Erdacht wurden die Protokolle 1903 von Sergej Nilus, einem ultra-orthodoxen Christen und Mitglied der Geheimpolizei Zar Nikolaus’ II. Steven Leonard Jacobs und Mark Weitzman untersuchen in ihrem Buch Dismantling the Big Lie: The Protocols of the Elders of Zion die verheerenden Auswirkungen der Protokolle und stellen fest, dass es »von allen judenfeindlichen Tiraden besonders die Protokolle der Weisen von Zion sind, die Antisemiten ermutigen und stärken. Andere antisemitische Werke mögen intellektuell besser fundiert sein, doch die konspirative Bildsprache der Protokolle hat die Fantasie befeuert und den Hass auf Juden und Judentum geschürt, vom Industriellen Henry Ford bis hin zu den jugendlichen Selbstmordattentätern der Hamas.«28
Heute tauchen die Protokolle sowohl im Rechtsextremismus und im Islamismus wieder gehäuft auf und werden im Internet auch von der linksextremen Szene in bösartigen Vorwürfen angeblicher jüdischer Verschwörungen immer wieder zitiert. Der Rückgriff auf die Protokolle, der dem gefälschten Werk Glaubwürdigkeit zugesteht, ist für sich schon antisemitisch.
Antisemitismus in der modernen muslimischen Welt
Erst mit dem Scheitern des arabischen Nationalismus Ende der 1970er Jahre nahm der islamische Antisemitismus tatsächlich an Fahrt auf. Die Hamas bezog sich in ihrer Gründungscharta auf die Protokolle, und der Führer der iranischen Revolution von 1979 Ajatollah Chomeini schrieb in seinem 1970 erschienenen Buch Der islamische Staat, dass »die Juden und ihre ausländischen Helfershelfer sich grundsätzlich gegen den Islam stellen. Sie wollen einen jüdischen Weltstaat errichten«.29 Chomeinis Nachfolger Ajatollah Chamenei leugnet gern den Holocaust und spricht wie andere Männer in der iranischen Führung von der globalen Weltherrschaft »jüdischer« und »zionistischer« Kräfte, wobei diese beiden Begriffe synonym verwendet werden.
Im Libanon hat sich die Hisbollah, ein schiitischer Ableger der Iranischen Republik, ebenfalls der Holocaustleugnung verschrieben und hält daher unter anderem das Tagebuch der Anne Frank aus libanesischen Schulen fern. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist für seine antisemitischen Äußerungen und die Leugnung des Holocaust bekannt; berüchtigt ist seine Aussage, wenn sich alle Juden in Israel versammelten, müsse die Hisbollah sie wenigstens nicht mehr rund um die Welt verfolgen – mutmaßlich, um sie zu vernichten.30
Expliziter Antisemitismus ist heute im politischen Diskurs des Nahen Ostens an der Tagesordnung. Und vieles davon wird nach Europa reimportiert. Hier, wo der Judenhass seinen Anfang nahm, nistet er sich nun leider in einigen von Armut und Unzufriedenheit geprägten muslimischen Einwanderergemeinden wieder ein.31
Für seinen TV-Dokumentarfilm Blaming the Jews traf sich der Journalist David Aaronovitch 2003 mit dem damaligen Hamas-Führer Abdel Asis Rantisi. Er fragte ihn, warum in Artikel 32 der Hamas-Charta auf die Protokolle der Weisen von Zion Bezug genommen werde und warum die Hamas in diesem Text behaupte, »die Zionisten« wollten ein Israel, das von Kairo bis Basra und über die ganze Welt reiche. Auf die Frage, warum er an einem Text festhalte, der anerkanntermaßen eine Fälschung sei, antwortete Rantisi: »Ich wollte es erst nicht glauben, aber dann sah ich, was in Palästina geschah, und ich verstand, dass es stimmte.« So lautete seine Antwort. So ähnlich lautete auch Hitlers Antwort. In Mein Kampf räumte der künftige Führer ein, viele hielten die Protokolle für eine Fälschung; er sei dennoch sicher, dass sie der Wahrheit entsprächen. »Die beste Kritik an ihnen jedoch bildet die Wirklichkeit«, schrieb er.32
Aaronovitch verweist auf die Vielzahl antisemitischer Äußerungen in Büchern und Fernsehsendungen der arabischen Länder. Seit sein Film 2003 herauskam, haben die sozialen Medien die Aufgabe übernommen, den Hass zu verbreiten. Er ist unzweifelhaft da. Doch besonders eigenartig ist, dass Aaronovitch zufolge Journalisten und Politiker in Teilen des Nahen Ostens in den »politischen Kloaken des alten Europas nach Argumenten« fischen. »Was um Himmels willen«, fragt er, »hat die Ritualmordlegende in einer Kolumne des ägyptischen Massenblattes Al-Ahram, in einem Buch des syrischen Verteidigungsministers und in Fernsehandachten palästinensischer Moscheen zu suchen?«
Wie Aaronovitch aufzeigt, greift der moderne muslimische Antisemitismus alte christliche Erzählmuster politisch wieder auf. Im 19. Jahrhundert habe sich der religiöse Antisemitismus der christlichen Welt in einen »rassischen« Antisemitismus verwandelt – sofern, wie wir uns später noch ansehen werden, Juden überhaupt als »Rasse« bezeichnet werden können. In muslimischen Ländern fabrizieren einige Politiker und Journalisten daraus eine politische und rassistische Weltsicht – und das, obwohl sich Muslime und Juden in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich sind.
Es gibt somit eine relativ moderne Form des Antisemitismus, die sich in einigen muslimischen Gruppierungen, weit häufiger aber in islamistischen Kreisen findet. In Organisationen wie der Hamas und der Hisbollah ist er besonders stark vertreten. Die Frage, inwieweit dieser Antisemitismus »politisch« oder »religiös« sei, stellt einen falschen Gegensatz her. Man könnte die israelische Politik und die Präsenz Israels im Nahen Osten ja auch ablehnen, ohne antisemitische Versatzstücke christlichen Ursprungs aus den Protokollen der Weisen von Zion und anderen entsetzlichen judenfeindlichen Texten heranzuziehen.
Auch ist dieses Phänomen nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Ein typisches Beispiel ist der malaysische Premierminister Mahatir bin Mohamad. In einem Interview der Associated Press sagte er: »Es gibt eine Rasse, an der keine Kritik erlaubt ist. Wer antisemitisch ist, der ist schon fast kriminell […] Der Begriff antisemitisch wurde erfunden, um zu verhindern, dass man Juden für ihr Fehlverhalten kritisieren kann.«33
In seinem Blog schrieb Mahatir 2012, dass »Juden diese Welt über Stellvertreter regieren«. Und auf dem Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Kuala Lumpur schien er 2003 auf die Vernichtung aller Juden zu drängen:
Es muss einen Weg geben. Und wir finden nur einen Weg, wenn wir aufhören zu denken, unsere Schwächen und Stärken zu bewerten, zu planen, Strategien zu entwerfen und Gegenangriffe zu starten. […] In Wahrheit sind wir sehr stark. 1,3 Milliarden Menschen lassen sich nicht einfach auslöschen. Die Europäer haben 6 von 12 Millionen Juden umgebracht.34
Der malaysische Staatschef verbreitet nicht nur klassische antisemitische Versatzstücke, sondern lehnt auch die Existenz Israels rundweg ab. So entschied Malaysia, israelische Sportler von den Paralympischen Schwimmweltmeisterschaften 2019 auszuschließen, woraufhin dem Land die Ausrichtung der WM entzogen wurde.35
In einigen Teilen der muslimischen Welt hat somit eine neue Form des Antisemitismus Fuß gefasst. Ihre Verwurzelung in antisemitischen Erzählmustern des christlichen Mittelalters ist zutiefst beunruhigend. Es muss doch möglich sein, dass muslimische Politiker und andere die israelische Politik oder Regierung kritisieren, ohne in solche Schmähungen, in solch himmelschreienden Antisemitismus abzugleiten.
Doch alle Muslime in Bausch und Bogen als antisemitisch zu stigmatisieren, wäre weder zutreffend noch hilfreich, denn obwohl in einigen muslimischen Gruppierungen die antisemitische und antiisraelische Gesinnung zunimmt, lehnt ein maßgeblicher Teil der Muslime solche Vorurteile ab. In Großbritannien etwa ist in der Gruppe nichtreligiöser Muslime der Antisemitismus nicht stärker verbreitet als in der Bevölkerung insgesamt. Auch vertreten viele Muslime und muslimische Organisationen eine völlig andere Haltung, verwenden eine andere Sprache und zeigen sich im Falle antisemitischer Übergriffe ebenso solidarisch mit Juden wie diese umgekehrt mit Muslimen. Dennoch hat der britische Journalist und Autor Mehdi Hasan zu diesem Thema Trauriges zu berichten:
Wenn ich morgen, was Gott verhüten möge, mit dem Auto den Tod eines unschuldigen Mannes verursachte, Minuten, nachdem ich auf meinem Handy diverse Texte abgesetzt hätte, würden mich den Rest meines Lebens Schuldgefühle plagen. Was ich sicher nicht tun würde, wäre, die Schuld für meine zwölfwöchige Haftstrafe öffentlich im Fernsehen den … Achtung, jetzt kommt’s … Juden in die Schuhe zu schieben. Doch genau das hat Nazir Ahmed, der für Labour im House of Lords sitzt, getan. [Ahmed] ist kein moderner Goebbels. Aber genau da liegt das Problem. Es gibt Tausende von Lord Ahmeds, sanftmütige und gut integrierte britische Muslime, die dennoch zutiefst antisemitische Ansichten hegen […]. Der anhaltende israelisch-palästinensische Konflikt ist auch keine Hilfe. Aber hier geht es nicht nur um den Nahen Osten […]. Es ist schiere Heuchelei, wenn Muslime in Großbritannien allenthalben über Islamophobie in der britischen Öffentlichkeit klagen und die Presse der Muslimhetze beschuldigen, gleichzeitig aber den ungezügelten Antisemitismus im eigenen Hinterhof geflissentlich übersehen. Wir können Islamophobie nicht glaubhaft bekämpfen, wenn wir gleichzeitig Judeophobie entschuldigen. […] Wir sind nicht alle Antisemiten. Aber als Gesellschaft haben wir ein echtes »jüdisches Problem«.36
Moderner Antisemitismus in Europa: Das 19. Jahrhundert
Der moderne Antisemitismus, der als politische Kraft über den früheren religiösen Hass hinausging, gewann 1879 an Fahrt, als der deutsche Journalist Wilhelm Marr sein Pamphlet Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum: Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet veröffentlichte. Darin verwendete er die Begriffe »Semitismus« und »Judentum« synonym für die Juden als Kollektiv und für »das Jüdischsein«.
Marr heiratete dreimal; seine ersten beiden Frauen waren Jüdinnen, seine dritte Frau die Tochter eines christlichjüdischen Ehepaars. Er dürfte also Juden gekannt und unter ihnen gelebt haben. Trotzdem war er ein fanatischer Antisemit. Als Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft hatte Marr den gewählten liberalen Bürgerschaftspräsidenten, den jüdischen Rechtsanwalt Isaac Wolffson, heftig angegriffen. Er und andere Juden, so Marr, hätten die demokratische Bewegung verraten und die jüdische Emanzipation – die Aufhebung rechtlicher Beschränkungen, denen Juden vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert unterlegen hatten – missbraucht, um sich Zugang zur Hamburger Kaufmannschaft zu verschaffen. Nach massiven öffentlichen Protesten wurde Marr nicht wiedergewählt.
Marr vertrat die Ansicht, dass die Assimilation den Juden nicht half, »richtige« Deutsche zu werden. Vielmehr hätten sich Deutsche und Juden in einem langwierigen Konflikt verhakt, dessen Ursachen Marr in ethnischen Unterschieden sah. Die Juden gingen aus diesem Konflikt siegreich hervor, so Marr, denn dank der Emanzipation rissen sie sich das deutsche Finanzwesen und die Industrie unter den Nagel – eine Anschuldigung, die noch heute allzu oft in den sozialen Medien geäußert wird. Da der Konflikt aus den »Gegensätzen zwischen dem Judenthum und dem Germanenthum« hervorgehe, könne nicht einmal die vollständige Assimilation der jüdischen Bevölkerung oder gar ihre Bekehrung zum Christentum diesen Konflikt lösen, sondern nur der Sieg des einen und der letztliche Tod des anderen.37 Wie vorausschauend.
Marr gründete die Antisemitenliga, die sich als erste deutsche Organisation dem Kampf gegen die angebliche Bedrohung Deutschlands und der deutschen Kultur durch die Juden und ihren Einfluss verschrieb und ihre Vertreibung aus dem Lande propagierte. Seine Ideen gewannen an Popularität, wurden veröffentlicht und verbreitet und von einflussreichen Politikern und Professoren übernommen.
Der preußisch-nationalistische Historiker Heinrich von Treitschke unterstützte als einer von wenigen bedeutenden Persönlichkeiten die antisemitischen Übergriffe, die sich ab 1879 häuften. Er war sich mit Marr in vielen Punkten einig. Wie Marr glaubte er, dass Juden grundsätzlich anders seien; er warf ihnen vor, sich nicht in die deutsche Kultur und Gesellschaft einfügen zu wollen, und bestritt, dass sie überhaupt von Nutzen seien. Seine Ansichten illustrieren, was Antisemitismus von anderen Formen des Rassismus absetzt, nämlich die Vorstellung, dass Juden an allem schuld sind und dass sie gleichzeitig fremd, nutzlos und zu mächtig sind. Das erinnert verdächtig an eine Verschwörungstheorie. Von Treitschke prägte auch den Satz »Die Juden sind unser Unglück«, der Jahrzehnte später von der NS-Propaganda aufgegriffen wurde.38
Ende des 19. Jahrhunderts kam der Begriff »Antisemitismus« auf. Zuerst dokumentiert ist das Wort »antisemitisch« 1880, als der österreichisch-jüdische Orientalist Moritz Steinschneider der Behauptung des französischen Philosophen Ernest Renan widersprach, »semitische Rassen« seien den »arischen Rassen« unterlegen.
Bis dahin hatte das Wort »semitisch« die entsprechende Sprachfamilie bezeichnet: Arabisch, Hebräisch, Akkadisch, Assyrisch, Aramäisch und so weiter. Der Begriff Antisemitismus bezog sich dagegen von Anfang an nicht auf die Sprecher semitischer Sprachen, sondern ausschließlich auf Vorurteile gegen Juden, die damals, Ende des 19. Jahrhunderts, in der Mehrheit Hebräisch gebetet haben mögen, es aber sicherlich nicht sprachen.
Es ist ein merkwürdiger Begriff, wenn man bedenkt, dass es zwar semitische Sprachen gibt, aber keinen »Semitismus«. Er wurde mal mit, mal ohne Bindestrich geschrieben, wobei sich die Variante ohne Bindestrich durchgesetzt hat; sie macht immerhin deutlich, dass niemand »anti-semitisch« sein kann, weil es den dazugehörigen Semitismus gar nicht gibt.
Viele Gelehrte waren damals vom Missbrauch der Begriffe »Semit« und »semitisch« dermaßen entsetzt, dass sie einen neuen Begriff erfanden, »Judophobie«. Zugeschrieben wird die Wortschöpfung Leon (Jehuda Leib) Pinsker in seinem 1882 anonym veröffentlichten Pamphlet Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden. Pinsker stellte Judophobie als irrationale Furcht dar, als einen ererbten Hass: »Resumiren wir das Gesagte, so ist der Jude für die Lebenden ein Todter, für die Eingeborenen ein Fremder, […] für alle Classen ein verhasster Concurrent.«39
Trotz seiner und anderer Leute Bemühungen konnte sich das Wort Antisemitismus jedoch durchsetzen, und antisemitische Vorstellungen griffen weiter um sich.
Die jüdische »Rasse«
Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Rassentheorie und Eugenik groß in Mode. Anthropologen lehrten in ihrer relativ neuen Wissenschaft, »Rasse« sei ein ausschließlich biologisches Phänomen und präge das Verhalten und die Identität einer Person grundlegend. Dieser sogenannte »rassische Essentialismus« ging in die »Rassenkunde« oder »Rassentheorie« ein. Theoretiker wie Georges Vacher de Lapouge (1854–1936), Begründer der Sozialanthropologie, genossen Ansehen und Einfluss. Vacher de Lapouge veröffentlichte 1899 sein Buch Der Arier und seine Bedeutung für die Gemeinschaft (unter diesem Titel ist es 1939 auf Deutsch erschienen), in dem er auf der Grundlage von Schädelmaßen die Menschheit in hierarchisch gestufte Rassen einteilt. Aus den »kurzen Schädeln« der Juden schloss er, dass sie dafür bestimmt seien, von stärkeren Rassen beherrscht zu werden. Er sprach ihnen zwar Ähnlichkeiten mit den Ariern zu, doch genau das mache sie gefährlich: Die Juden seien die einzige Gruppe, welche die arische Aristokratie ersetzen könne.
Vacher de Lapouges Werk war später eine der wichtigsten Quellen für Antisemitismus und Rassenideologie des Nationalsozialismus. Er und andere hüllten mit ihren Arbeiten antijüdische Vorurteile in ein »wissenschaftliches« Gewand: Sie verbreiteten nicht einfach eine Meinung, sondern vermeintliche Fakten. Juden wurden stigmatisiert. Angeblich trete bei ihnen männliche Menstruation, pathologische Hysterie und Nymphomanie auf. Das klingt heute absurd, doch damals griffen diese Theorien dermaßen um sich, dass sie nach und nach sogar Juden überzeugten. Anerkannte jüdische Forscher wie Joseph Jacobs und Samuel Weißenberg machten sich die pseudowissenschaftlichen Theorien zu eigen und waren überzeugt, dass Juden eine eigene Rasse bildeten.40
Infolge der nationalsozialistischen »Rassenhygiene« fiel der rassische Essentialismus natürlich in Ungnade. Nach dem Zweiten Weltkrieg erklärten im Westen Anthropologen und Biologen »Rasse« als genetische und biologische Kategorie des Menschen für hinfällig. Obwohl einige wenige Anthropologen immer noch anhand distinktiver Merkmale kategorisieren, ist man sich in der Wissenschaft heute weitgehend einig, dass die Rasse beim Menschen keine taxonomische Bedeutung hat. Alle heute lebenden Menschen gehören derselben Art an, Homo sapiens. Also können Juden, unabhängig davon, wie wir uns sonst definieren, jedenfalls keine eigene Rasse bilden.
An dieser Stelle lohnt es sich, kurz darüber nachzudenken, was Juden denn sind, wenn schon keine Rasse.
Juden sind gewissermaßen ein »Volk«, wenn auch keine Nation im Sinne eines Staates. Juden können einer gemeinsamen Ethnie angehören oder auch nicht. So haben aschkenasische Juden mehr genetische Merkmale mit Menschen ihrer Gruppe gemein als mit sephardischen Juden und umgekehrt. Juden verbindet der jüdische Glaube, doch keinesfalls sind alle Juden gläubig oder üben ihre Religion aus. Und Juden kommen, unabhängig vom Glauben, häufig aus einer jüdischen oder teilweise jüdischen Familie. Juden können auch zum Judentum konvertiert sein und somit nicht die ererbten historischen Beziehungen derer haben, die aus einer jüdischen Familie stammen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts definieren viele Antisemiten, der widerlegten »Rassentheorie« folgend, Juden nicht nach ihrer Religion, sondern danach, ob ihre Vorfahren Juden waren, auch wenn das die meisten Juden ablehnen. Danach wäre man sogar Jude, wenn die Urgroßeltern vor langer Zeit zum Christentum konvertierten. Im Judentum wiederum ist traditionell die jüdische Mutter ausschlaggebend, nicht der Vater. Das hat sich allerdings in Teilen der Judentums geändert, wo heute Kinder mit mindestens einem jüdischen Elternteil, egal, ob Mutter oder Vater, als jüdisch gelten.
Beinahe allen Juden gemein ist das Gefühl, einem Volk anzugehören. Das entsprechende hebräische Wort lautet Am – Am Israel Chai, »Das Volk Israel lebt«, wobei »Israel« eher eine Gruppe bezeichnet als den Staat. Ein enger Verwandter dieser Bezeichnung ist das arabische umma für »Volk« oder »Gemeinschaft« (am und umma haben beide Bedeutungen), mit dem die Muslime das Gemeinschaftsgefühl der Muslime beschreiben; im Einzelnen unterscheidet sich die Haltung zum »Volk« im Judentum und im Islam allerdings erheblich.
Wir dürfen uns also einem Volk zugehörig fühlen. Im Lauf der Geschichte waren es allerdings oft andere, die sich berufen fühlten, Juden und damit auch Antisemitismus zu definieren. Dafür hat es immer neue Ansätze gegeben, vom christlichen Antijudaismus des Mittelalters über die pseudowissenschaftlichen Rassenstereotypen des 19. Jahrhunderts bis hin zur rückhaltlosen Übernahme dieser Pseudowissenschaft und der Kombination mit fanatischem Hass durch die Nationalsozialisten.
In jüngster Zeit hört man oft, dass es zumindest bis zu einem gewissen Grad die Opfer des Rassismus sein sollten, die seine Ausprägung und Merkmale beschreiben: Diejenigen, die ihm ausgesetzt sind, müssten ihn auch definieren. In Großbritannien leitet sich diese Ansicht aus dem sogenannten Macpherson-Bericht über den rassistisch motivierten Mord an dem schwarzen Studenten Stephen Lawrence in London ab; darin wird ein rassistischer Übergriff definiert als ein »Vorfall, der vom Opfer oder einer anderen Person als rassistisch wahrgenommen wird«.41
Führte man diese Vorgabe zu ihrem logischen Schluss, könnten nur Opfer rassistischer Übergriffe entscheiden, ob ein Vorfall rassistisch motiviert war oder nicht. Das bringt uns natürlich nicht weiter, und im Macpherson-Bericht ist davon auch keine Rede. Dort heißt es vielmehr, die angegriffene Person oder das Opfer eines Übergriffs könne aus der eigenen Wahrnehmung heraus am besten entscheiden, ob ein spezifischer Vorfall rassistisch war. Das heißt aber nicht, dass nur Schwarze Rassismus gegen Schwarze, nur Muslime Islamophobie oder nur Juden Antisemitismus definieren können. Im Falle von Stephen Lawrence und dem Macpherson-Bericht war die Definition eines rassistischen Übergriffs nicht aus semantischen, sondern aus praktischen Erwägungen notwendig geworden. Mithilfe einer entsprechenden Einordnung ließ sich nämlich der Umgang der Polizei mit einem solchen Vorfall besser beurteilen. Da bis dahin kaum mit der Sicht der Opfer, dafür aber ausgiebig die Sicht möglicherweise voreingenommener und ignoranter Polizeibeamter berücksichtigt worden war, hatte die Polizei den Anstieg rassistisch motivierter Übergriffe systematisch ignorieren können. Mit der Zunahme antisemitischer Vorfälle in Großbritannien wuchs der Bedarf an einer praxistauglichen Definition des Antisemitismus, die zu Beginn dieses Jahrtausends dann auch erarbeitet wurde.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.