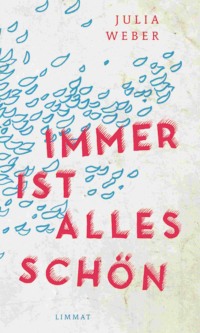Kitabı oku: «Immer ist alles schön»
Über dieses Buch
Anais liebt ihre Mutter, sie liebt ihren Bruder Bruno und insgeheim auch Peter aus der Schule.
Die Mutter sagt, das Leben sei eine Wucht, und dass sie gerne noch ein Glas Wein hätte. Denn es hält ihren Sehnsüchten nicht stand, das Leben, und die Männer halten ihrer Liebe nicht stand. Das Tanzen, das sie liebt, ist zum Tanz an der Stange vor den Männern geworden.
Es ist nicht einfach, so ein Leben zu leben, sagt die Mutter, darum will sie noch ein Glas.
Anais und Bruno versuchen, sich und die Mutter zu schützen vor der Außenwelt, die in Gestalt von Mutters Männern mit Haaren auf der Brust in der Küche steht. Oder in der Gestalt von Peter, der ihre Wohnung seltsam findet und nichts anfangen kann mit den tausend, auf der Straße zusammengesammelten Dingen. In Gestalt eines Mannes vom Jugendamt, der viele Fragen stellt, sich Notizen macht, der Anais und Bruno betrachtet wie zu erforschendes Material, und in Gestalt einer Nachbarin, die im Treppenhaus lauscht. Je mehr diese Außenwelt in ihre eigene eindringt, desto mehr ziehen sich die Kinder in ihre Fantasie zurück.
«Immer ist alles schön» ist ein komisch-trauriger Roman, der mit leisem Humor eine eindrückliche Geschichte erzählt: von scheiternder Lebensfreude in einer geordneten Welt und davon, wie zwei Kinder versuchen, ihre eigene Logik dagegenzusetzen. Mit Anais und Bruno fügt Julia Weber der Literatur ein zutiefst berührendes Geschwisterpaar hinzu.

Foto Ayşe Yavaş
Julia Weber wurde 1983 in Moshi (Tansania) geboren. 1985 kehrte sie mit ihrer Familie nach Zürich zurück. Nach Berufslehre und Matura studierte sie 2009 bis 2012 literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 2012 hat sie den Literaturdienst gegründet, und sie ist Mitbegründerin der Kunstaktionsgruppe «Literatur für das, was passiert». Julia Weber lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind in Zürich.
Julia Weber
IMMER IST ALLES SCHÖN
Roman
Limmat Verlag
Zürich
INNEN
Ich wünsche mir einen Urlaub mit Feuer und Ferne, und Bruno wünscht sich einen Urlaub ohne Alkohol.
Gut, sagt Mutter, weil ihr einen Geburtstag habt.
Dann machen wir Urlaub. Und berühre ich auf dem Weg zur Busstation die Büsche, zwitschern sie. Und bewege ich die Arme, berühren sie Luft. Und strecke ich die Zunge aus dem Mund, bleibt sie warm.
Mutter raucht vor einem Plakat, auf dem ein Mann am Frühstückstisch lächelt, und Mutter schließt dabei die Augen. Wir fahren in Urlaub. Im Bus kommt der Uringeruch aus dem dreidimensionalen Muster der Sitze. Wir fahren in Urlaub bis zur Endstation. Bruno trägt sein Buch über die Brücken der Welt unter dem Arm, alle paar Minuten muss er es ablegen und die Arme schütteln.
Und auf einem Steg den Schilfweg entlang gehend, sagt Mutter, dass es schön ist. Ein Blesshuhn schreit, der Wind zieht an den rostigen Schilfköpfen.
Sehr schön, sagt sie.
Fantastisch, sagt sie.
Wunderbar, sagt sie.
Ganz, ganz wunderbar.
Das ist wegen dem nicht absehbaren Bier, sagt Bruno. Verzweiflung, sagt er noch.
Es ist wirklich schön, sage ich, weil der Wind ganz warm die Armhaare aufstellt.
Immer ist alles schön, sagt Bruno, dann zählt er die Schilfstangen mit seinem dicken Buch auf dem Kopf.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ich schaue beim Gehen abwechselnd über den See, auf seine silbernen Wellen, dann an mir herunter auf den zitronengelben Stoff an meinem Bauch. Und es schmatzt das Wasser unterhalb meines Bauches, unter dem Steg.
Ein Mann mit Doppelkinn starrt Mutters Körper an. Neben ihm liegt ein Hund, auch er mit Falten. Der kleine Bruno legt das Buch ins zertrampelte Gras und macht aus seinen Händen Fäuste.
Wir wollen einen Wohnwagen, sagt Mutter, sie steht vor uns, schüttelt ihr Haar. Mit den Absätzen sinkt sie langsam nach hinten in die Erde. Der Mann lacht. Und durch sein Lachen bewegt sich alles an ihm und auch alles um ihn herum. Seine Haut bewegt sich, der winzige Tisch, an dem er sitzt, bewegt sich, der Boden bewegt sich und hinter ihm das Rezeptionshäuschen mit der abgesplitterten weißen Farbe und den Blumenkisten vor den Fenstern. Der Mann trägt eine kurze, weiße Hose, bei der ich mir nicht vorstellen kann, wie er in sie hineingekommen ist, und erst recht kann ich mir nicht vorstellen, wie er jemals wieder aus ihr herauskommt.
Dann gehen wir durch vereinzelt herumstehende Fichten und Birken. Ich sehe die Abdrücke der Zelte zwischen den Bäumchen, ich sehe, wo im letzten Sommer die Zelte standen, wo die Klappstühle, wo die Tische, wo die Luftmatratzen lagen. Und jetzt ist hier niemand außer uns und dem Koloss, der den Wohnwagen aufschließt, dreimal an die Außenwand des Wagens klopft und geht.
Und wir sitzen auf Baumstücken feierlich. Wir sitzen im Feuerlicht. Bruno, der Luftgitarre spielt; die Flammen in Brunos Brillenglas, sie tanzen zu seiner Musik. Der Wohnwagen, der nach fremden Menschen und ihrem Schlaf riecht. Das alkoholfreie Bier in Mutters eleganten Händen, das lauwarm wird, kommt auch als bitterer Geruch aus ihrem Mund.
Mutter, die in Gedanken ist und schweigt; das Knistern.
Der dunkelbraune Tisch, den man aus dem Wagen herausklappen kann, der wackelt, an dem ich sitze, und die Schatten im Wald, die ich beobachte, ihre Unheimlichkeit, die Möglichkeit von allem in der Dunkelheit. Mein zitronengelbes Kleid, unruhig im Feuerlicht, und meine feinen Finger mit dem goldenen Kaugummiautomatenring. Und das Grün der Wiese, das beinahe schwarz ist.
Später liegt Mutter auf einer Matte am Boden, summt leise eigene Melodien. Bruno und ich liegen auf dem Hochbett. Wir können mit Füßen und Händen die Decke berühren. An die Decke hat jemand geschrieben: «Der einzige Unterschied zwischen mir und Salvador Dalí ist, dass ich nicht Dalí bin.»
Am Morgen hat sich der Geruch der fremden Menschen mit unserem vermischt. Mutter schläft. Bruno und ich gehen herum, sind hungrig, versuchen zu schwimmen, aber das Wasser ist kalt und der Boden des Sees so weich, dass wir uns zu gut vorstellen können, was sich noch alles in diesem Boden befindet, auf das man treten könnte, was einen dann beißen oder erschrecken würde. Weil uns nichts mehr einfällt, sammeln wir leere Schneckenhäuser, lecken die Tautropfen vom Klee, werfen Holzstücke in den See, füttern Fische mit Brot. Der Wind ist lauwarm und riecht nach der Gülle in den Güllelöchern der Bauernhöfe, die hinter dem kleinen Wald liegen. Wir beobachten den Hund vor der Hütte und den Koloss, der mit einem Schlauch ein Motorboot abspritzt, dabei stolpert er manchmal über den Schlauch. Es ist warm in der Sonne und kalt im Schatten, und das Boot heißt Susanna.
Am Abend sitzen wir wieder am Feuer, die Sonne ist weg, die Luft blau. Mutter hält den Zahnputzbecher mit Wein gefüllt in die Höhe.
Auf uns, sagt sie.
Davor sagte sie, entweder Urlaub oder kein Alkohol, aber beides gehe nicht, denn sie könne uns nichts gönnen, wenn sie nicht sich selber was gönnen könne, und das Einzige, was sie sich wünsche, sei am Abend ein Becher voll Wein.
Mit dem Becher wird Mutter weich wie das Licht des Feuers.
Jetzt ist alles gut, sagt sie.
Hast du mit Peter geredet?, fragt sie.
Noch nicht, sage ich.
Hast du geküsst?
Nein, sage ich, ich möchte nur mit ihm reden.
Aber das wird großartig, das Küssen, sagt Mutter.
Und dann erscheint der Koloss zwischen den Bäumen. Er kommt näher, wird immer größer, wird riesengroß, steht im Feuerlicht vor uns mit einem langen Schatten hinter sich. Seine Zehen schauen aus den weißen Sandalen, und sein Gesicht ist im Licht ein Ungeheuer. Er fragt Mutter, ob sie wohl mit ihm tanzen gehen wollen würde.
Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier.
Ob wir wohl alle mit ihm tanzen gehen wollen würden, also tanzen würden nur Mutter und er, aber wir könnten ja Steine ins Wasser werfen oder eine Cola trinken oder was Kinder eben so tun, wenn die Erwachsenen zusammen tanzen.
Er bewegt die Zehen beim Reden. Seine Zehennägel haben die Farbe von Ohrenschmalz.
Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier, um mit ihnen hier zu sein.
Und wenn jetzt aber, sagt der Mann, sie nur für einen Tanz, er fände sie nämlich reizend und würde so gerne mit ihr einen Tanz haben.
Nein, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier.
Also keinen einzigen Tanz?
Es zuckt ihm das Flammenlicht im Gesicht, und er trägt die gleiche kurze Hose, aber zu der Hose ein Safarihemd mit dunklen Flecken unter den Achseln. Er riecht nach frisch rasiert und auch ein bisschen nach altem Wasser.
Nein, verdammt, sagt Mutter.
Einen nur, sagt er.
Bruno singt. Ich schaue dem Koloss auf die Haare an den Beinen. Mutter starrt ins Feuer und trinkt schnell. Der Wein leuchtet rot im Feuerschein.
Also, sagt sie.
Mutter steht auf.
Ist das gut für euch?, fragt sie.
Ich nicke.
Bruno?
Bruno singt.
Dann geht sie schön und rot davon neben dem Koloss, der von oben auf ihre Stirn einredet.
Er freue sich also so sehr, sagt er.
Wenn er sich doch so freut, sage ich.
Bruno singt lauter.
Bruno, wenn er sich doch so freut, dann ist doch nichts dabei, Mutter ist doch eine Gute, deshalb nur.
Bruno singt lauter. Und ich schweige am Feuer. Ich möchte Mutter fragen, wie es war.
Wir können die Tänze hören, aber sie kommt nicht zurück nach einem Tanz, nicht nach zwei, nicht nach drei, nicht nach vier. Ich stochere in der Glut, höre die Geräusche im Wald, stelle mir Wildponys vor. Bruno singt nicht mehr. Ich denke ein bisschen an Peter, aber nur kurz, und weiß nicht, was ich damit soll. Ich denke noch ein bisschen an ihn. Ich denke, was er wohl gerade tut, ob er mich schön findet, also mein Gesicht, ob er es wohl so schön findet, dass er auch mal mit mir reden würde, weil er gerne in mein Gesicht schaut.
Das ist wichtig, hat Mutter gesagt, es ist wichtig, ein schönes Gesicht zu haben, wenn man nicht hart ist, und du Anais, bist der weichste Mensch, den ich kenne, aber eben auch der mit dem schönsten Gesicht. Es ist wichtig, weil, wenn man weich ist, dann trampeln die Menschen gerne auf einem herum, wenn man aber ein schönes Gesicht hat, nicht.
Ich denke daran, wie er mir damals sein Pausenbrot gegeben hat, wie er auf mich zugelaufen kam, seine Freunde weit hinten standen. Er kam zu mir gelaufen, hielt mir sein Brot hin. Magst du?, hat er gefragt. Ich habe nichts gesagt, habe es in meine Hände genommen, ihn weiter angeschaut. Ich nahm einen Bissen vom Brot, sagte nichts. Peter lächelte, nahm das Brot wieder und ging weg.
Ich denke, dass ich Peter einmal nach seinen Hobbys fragen sollte.
Was Peter wohl für Hobbys hat?, frage ich ins Feuer hinein.
Fechten vielleicht, sagt Bruno, gehen wir sie suchen.
Fechten. Wie schön.
Dann gehen wir sie suchen, weil sie auch nach sieben Tänzen nicht kommt.
Wir gehen vom Wohnwagen weg zwischen ein paar Bäumchen hindurch. Wir hören die Musik von Weitem, sehen die Scheune, darin das Licht und kleine Menschenschatten. Bruno wirft Blätter in den schwarzen See, auf dem See sind Glitzerpunkte. Eine Ente erschrickt und quakt, die Glitzerpunkte werden Glitzerwellen. Wir gehen zur Scheune hin. Mit der Musik vermischen sich schwere Stimmen. Sie singen und schreien auch. Wir bleiben beim Scheunentor stehen.
Und dann sehen wir Mutter. Hinten auf der Tanzfläche leuchtet sie in ihrem roten Leinenkleid mit goldenen Knöpfen. Männer sehen wir im Kreis um Mutter herumstehen. Einer zieht sie zu sich hin, dann wirbelt sie davon und zum nächsten Mann. An langen Bänken sitzen Menschen, manche klatschen. Und ein sehr alter Mann spielt Akkordeon auf einer kleinen Bühne aus Holzkisten. Er trägt ein rosa Hemd, hat einen langen Bart und große Ohren. Mutters Kleid ist eine rote Glocke, sie dreht sich im Kreis, ihr Haar ist hell wie das Feuer. Sie lacht und lässt sich in Arme fallen und weiterwerfen. Dann löst sie sich und tanzt in der Mitte der Männer einen wilden Tanz. Sie hebt die Beine, hebt ihr Kleid, stampft und dreht sich. Sie legt die Hände in ihr Haar und hält den Mund, an die Decke blickend, offen.
Ich höre auf dem See die Enten quaken und denke, jemand hat sie aufgeschreckt. Ich denke, dass Bruno nicht da ist, aber er steht neben mir. Ich denke, es gibt keine Kinder, die Steine in den See werfen. Ich denke, dass der Mann nicht mit Mutter tanzt, sondern alle Männer mit Mutter tanzen, und ich denke, das sind viele, die mit Mutter tanzen.
Ich sehe den Koloss vom Wohnwagen im Kreis stehen und sehe sein Lachen. Er lacht, und alles an ihm bewegt sich.
Bruno läuft vorbei an den Männern und Frauen, an den aufgereihten Festbänken und geht in den Kreis hinein. Ich gehe ihm nach. Er geht zu Mutter in den Kreis und fasst sie am Arm. Ich stehe hinter Bruno im Kreis, und die Männer bewegen sich nicht mehr. Sie wenden ihre Blicke und Bärte und Ohren und Ohrringe ab.
Mitkommen, sagt Bruno, bitte.
Warum seid ihr nicht im Bett?, fragt Mutter, sie redet, als hätte sie Steine im Mund.
Warum seid ihr hier, das hier ist nichts für euch, sagt sie mit den Steinen im Mund.
Mitkommen, sagt Bruno.
Wir haben auf dich gewartet, du sagtest, einen Tanz, sage ich.
Es ist ja ein Tanz, sagt sie, es ist hier ein großer Tanz, und er tut mir gut, dieser Tanz, ich brauche jetzt unbedingt genau diesen einen Tanz und noch was zu trinken und noch einen Tanz. Ich will noch einen Tanz, den brauche ich auch wegen euch, unter anderem auch wegen euch. Ich finde, ich habe ihn mir verdient, so einen Tanz, einen Tanz, sagt sie. Geht heim, meine Tierchen, geht heim.
Wir wollen, dass du mitkommst.
Bruno schaut Mutter von unten an.
Ich kann jetzt nicht, es ist schon gut hier. Lasst mir doch diesen einen Abend, sagt sie leiser.
Und dann schiebt sie uns weg.
Bitte, sagt Bruno.
Bitte, sage ich.
Jetzt nervt mich nicht, wirklich, ich will das jetzt, das ist lustig hier, mit euch am Feuer ist es langweilig.
Draußen drehe ich mich um und sehe den Schein der Kerzen in roten Plastikschälchen auf den Tischen, sehe die Strohballen in der Ecke der Scheune, sehe die Menschen weiterklatschen, sehe ihre Beine wippen unter den Tischen und wie die Männer sich langsam auf die Tanzfläche zurückbewegen. Mutter in der Mitte hebt ein kleines Glas zum Mund.
Im Wasser spiegeln sich nur noch wenige Lichter, die Ente ist still. Wir gehen durch die Bäume zurück, die Glut ist aus. Wir putzen die Zähne und pinkeln in den Wald, ich trete auf eine Nacktschnecke, und Bruno streift eine Brennnessel. Unter dem Schlafsack halten wir uns fest, weil es kalt ist.
Am nächsten Morgen sitzen Bruno und ich vor dem Wohnwagen unter dem kleinen Vordach, wir essen das restliche Weißbrot, Tropfen fallen auf unsere Hände und das Brot. Tropfen prallen am Gefieder einer Amsel ab, während der Rest der Welt langsam aufweicht. Mutter kommt durch die Bäume gelaufen, auch sie aufgeweicht. Auf uns liegt ein Blätterschattenspiel, hinten in den Bäumen ruft ein Kuckuck kuckuck.
Tierchen, meine Tierchen, sagt sie.
Sie nimmt die Haare nicht aus dem Gesicht, steht vor uns. Hinter ihrem Vorhang ein Lächeln.
Ich denke, könnten wir neben dieser aufgeweichten Welt nochmals eine komplette Welt haben, eine weniger komplizierte, eine mehr mit Tieren als mit Menschen, dann wäre es gut.
Ist schon gut, sage ich zu Mutter, die sich nicht bewegt, und nehme ihre und meine Tasche. Bruno nimmt das Buch.
Wir gehen durch die Fichten. Über den Rasen gehen wir fort.
Der Koloss steht neben der Hütte, lächelt ein Kolosslächeln am Telefon. Seine Körperabdrücke sehe ich im Gras neben dem Motorboot mit dem Namen Susanna.
Beim Vorübergehen an seiner Hütte kommt aus dem offenen Fenster der Geruch von Paprikachips und kaltem Zigarrenrauch. Auch vermischt sich ein süßlicher Menschengeruch mit dem Geruch der Gülle. Sein Klappbett steht in einer Spinnwebenecke, Kissen und Bettbezug mit Löwenkopf, der Löwe darauf schreit. Das Poster einer Frau im silbernen Bikini hängt über seinem Tisch und über dem Bett das Bild von Mohn. Das Safarihemd liegt auf dem Bretterboden, da, wo die dunklen Flecken waren, sind jetzt Salzränder. Auf dem Schreibtisch die militärgrünen Ordner, zerkaute Bleistifte, ein Locher, ein einziger Stuhl am Tisch.
Sein Blick ist in unserem Rücken, als wir das Areal verlassen. Koloss, Hütte und Hund bleiben zurück, nach Hund und dem Inneren des Menschen riechend. Ich habe den Hund nicht gesehen, ich habe seine Abdrücke neben den Abdrücken des Kolosses im Gras vor der Hütte gesehen.
Ich stelle mir den Koloss vor, wie er im Bett liegt und mit seiner Mutter telefoniert. Er streichelt beim Telefonieren mit der freien Hand seinen über den Bund hängenden Bauch. Er hebt den Bauch an und lässt ihn fallen, hebt ihn an, lässt ihn fallen. In der Fensterscheibe sieht er sein Spiegelbild, vermischt mit Rasen und Feldern, dahinter, draußen wartet der bellende Hund.
Ich stelle mir die Brote vom Koloss vor, die Butterbrote. Seine Zehen bewegen sich, wenn er kaut, und unter ihm sitzt der Hund, wartet auf das Herunterfallen der Brotstücke, und da, wo sie sitzen, vor dem Häuschen, sind ihre Abdrücke im Gras, ist der Rasen dunkel.
Der Koloss, der das Boot namens Susanna abspritzt. Der Koloss, der sich danach auf seinen im Gras hinterlassenen Abdruck legt und wartet. Der Koloss, der die Frau im Bikini betrachtet, die in seinem Raum hängt, die er ebenfalls Susanna nennt. Sein Tag, der mit Sonnenlicht und Güllegeruch beginnt. Sein Tag ist warm. Der Koloss schwitzt neben seinem hechelnden Hund, er schwitzt in den Abend hinein und schwitzt über den Nudeln, die er sich kocht auf einer Herdplatte in der Ecke. Er schwitzt und schiebt Dinge in sich hinein. Würstchen, Nudeln, Brot, Bier. Der Koloss sitzt vor dem kleinen Fernseher. Bilder von tanzenden Frauen und um sie herumtanzenden Männern, von Auswanderern und Verwandten und von Streit und Liebe, Küssen. Der Koloss wird größer und voller von den Bildern, von den Broten und Würsten. Bald ist sein Bett zu klein, und er bringt den Hörer kaum ans Ohr, seine Arme sind zu dick, die Finger, um den Hörer zu halten. Die Abdrücke wachsen vor dem Haus. Er versucht, den Hund zu streicheln. Am Abend schiebt er Dinge in sich hinein. Ein Brot, zwei Brote, drei Brote, viele Brote, während die Frauen und Männer am Strand tanzen, während auf den Bildern die Sonne untergeht und Palmenblätter sich vor dem Sonnenuntergang bewegen. Auch beim Koloss verschwindet die Sonne, er wird größer und größer. Er füllt den Raum, kann sich nicht mehr bewegen. Er sieht seine Arme nicht, die Beine nicht, den Bildschirm sieht er nicht. Der Koloss kann die Tür nicht öffnen, durch das Fenster kommt der Sommergeruch, kommt ein feiner Wind hinein und streichelt ihn am Bein. Und das Telefon klingelt irgendwo unter seinem Fleisch.
Zu Hause streichle ich, bei Mutter im Bett liegend, ihren Rücken. Sie schläft. Ich schreibe Mutter einen Brief.
Liebe Mama,
bei uns im Treppenhaus riecht es nach alten Sachen. Nach altem Öl oder nach alten Spaghetti, nach Kleidern. Aber in unserer Wohnung riecht es gut und ist es hell. Ich bin sehr gerne hier.
Deine Anais.
Bruno und ich betrachten das Sonnenlicht, das in der Küche in der Form des Fensters über den Tisch wandert und über den Beton des Balkons. Wir nennen es das schleichende Licht. Wir zupfen Haare und Staubbällchen von unseren Socken, lassen Staubbällchen und Haare zu Boden segeln. Wir schließen Wetten ab, wo sie landen werden, und pusten, um sie dorthin fliegen zu lassen. Wir ziehen mit dem Finger die Milchhaut von der Milch, streichen sie an der Unterseite der Sitzfläche unserer Stühle ab. Wir spucken vom Balkon. Wir denken darüber nach, dass es in uns warm ist, dass es in uns warm ist und wir dennoch frieren. Wir denken darüber nach, dass man nicht mehr weiß, wo der eigene Körper beginnt, wenn das Außen gleich warm ist wie man selbst. Wir halten zum Beweis unsere Hände in lauwarmes Wasser und finden die richtige Temperatur nicht. Wir stellen fest, dass ich innen wärmer bin als Bruno. Wir suchen nach fremden Orten, wir sitzen auf dem Balkon und zählen die Kaugummis an der Reckstange im Hof: 197.
Dann steht Mutter nackt im Flur. Ihr Oberkörper wankt, als wäre sie ein Baum und als gäbe es Wind in der Baumspitze. Hinter ihr die Bilder an der Wand. Hinter ihr sie selber noch einmal nackt, hinter ihr die Wolke in Tassenform, hinter ihr ein Fahrrad mit winzigen Rädern. Ich erinnere mich, wie Mutter mit dem Bild vom Fahrrad nach Hause kam, wie sie es unter ihrem leuchtend roten Pullover hervorgenommen hat, wie sie gesagt hat, es regnet.
Das weiß ich noch, weil von Mutter das Wasser auf den Boden tropfte, und sie hat uns angesehen, dann auf das Bild, dann wieder uns, wieder das Bild, als hätte unser Dasein etwas mit den Proportionen des Fahrrads zu tun. Das Wasser tropfte von ihrer Nase und den Schultern, den Armen zu Boden und bildete dort kleine Lachen, es lief auch in die Rillen des Bodens hinein. Mutter war aufgeweicht und sah Bruno und mich an, wie wir im Schlafanzug vor ihr standen. Sie hat das Bild vorsichtig auf den Boden gelegt und uns dann gefragt, ob wir vielleicht kurz zu ihr kommen könnten, dann hat sie uns lange umarmt, ich erinnere mich an das langsame Nasswerden meiner Brust, des Bauches und der Arme. Ich erinnere mich, dass es gar nicht unangenehm war, nass zu werden.
Jetzt liegen ihre Haare als Vorhang vor dem Gesicht, und sie atmet durch den Mund. Sie legt Arm und Kopf an den Türrahmen. Durch ihr Haar hindurch blickt sie irgendwo in die Küche oder in irgendeine Küche hinein.
Hallo Tierchen, sagt sie, neben ihrem Gesicht klebt ein halb abgekratzter Pferdekopf, und dann geht sie ins Bad.
Später nimmt der Wind das Vogelbrot vom Balkongeländer. Später lässt der Wind Werbeprospekte durch den Innenhof fliegen. Später ist Mutter noch immer unter der Dusche, und auf Brunos Schlafanzug ist noch immer das Monster mit den vielen Beinen. Ich stehe vor dem Bad.
Alles gut?, frage ich und klopfe an die Tür.
Mutter antwortet nicht.
Alles gut?, frage ich.
Das Wasser fällt.
Geht es dir gut?
Nur das Geräusch vom Wasser, das auf Mutter und in die Wanne fällt. Das Plätschern, durch das ich weiß, dass sie steht. Ich frage Bruno, was ich tun soll, setze mich auf den Boden, weil ich zu unruhig zum Stehen bin, stehe auf, weil ich nicht sitzen kann, setze mich, weil ich nicht stehen kann. Bruno weiß es nicht, obwohl er viel weiß. Bruno weiß, wie hoch die höchste Brücke der Stadt und wo der tiefste Punkt des Meeres ist.
Ich gehe zurück. Ich schlage die Faust gegen die Tür, bewege die Türklinke auf und ab. Drinnen das Plätschern.
Es wächst draußen am Himmel eine fantastische Wolke, sie wächst in den Himmel hinein, ist hinten schiefergrau und vorne weiß. Und Frau Wendeburgs weiche Katze sitzt auf den Briefkästen, in ihrem Fell spielt der Wind. Und draußen geht Frau Wendeburg in ihrem grünen Wollmantel durch den Hof. Sie hält sich selbst im Arm, und sie schaut nach oben, an die Fassaden der Häuser. Sie sieht aus, als wäre sie allein auf der Welt, und würde ich hinausgehen und sie grüßen, könnte es sein, dass sie erstaunt wäre darüber, dass es mich gibt. Und neben ihr im Hof steht der Baum allein und hinter ihm sein Schatten.
An Frau Wendeburgs Arm tanzt der Leinenbeutel im Wind.
Als das Plätschern endlich endet, höre ich den Duschvorhang, der zur Seite geschoben wird, höre Mutter den Spiegelschrank öffnen und schließen, ich höre Bruno, wie er sich ankleidet, wie er sein Taschenmesser von der Kiste neben dem Bett nimmt und es in der Hand dreht, dann am Hosenbund befestigt, seine Hand auf den Fuchs legt. Ich sehe ihn, wie er einmal über das Fell des Fuchses streicht. Der Fuchs, der innen kalt ist, den Mutter uns mitgebracht hat, der neben unserem Hochbett steht, um uns zu beschützen, wie Mutter sagte. Der Fuchs, dem ein Auge aus dem Kopf gefallen ist und dessen Beine krumm sind, weil Bruno sie verbogen hat, als er noch nicht reden konnte und nichts verstanden hat.
Bruno sagt, er könne sich nur schwer vorstellen, einmal sprachlos gewesen zu sein. Er könne sich mich aber gut als Säugling vorstellen. Ich schlage Bruno daraufhin die Brille vom Gesicht. So ist Bruno vorübergehend blind und flucht über mich, dann schreit Mutter im Bad, dass sie genug habe von diesen Stimmen immer, diesen Menschen ständig um sie herum und den Stimmen und dem Jammern, und immer wolle jemand etwas von ihr. Ich stehe erschrocken neben dem Fuchs und rufe, dass wir von niemandem überhaupt nichts wollen.
Dass wir bloß streiten, weil wir Kinder sind, ruft Bruno.
Der kleine Bruno dreht mir den Rücken zu, ich sehe seine Magerkeit, hebe die Brille auf, schiebe ihm die Bügel hinter die Ohren. Er schaut hoch zu mir.
Was ist mit Liebe?, frage ich.
Das Fell des Fuchses ist trocken, und unter dem Fell ist der Fuchs hart.
Keine Zeit, sagt Bruno und will davon, aber ich halte ihn am Hosenbund fest. Er dreht sich um.
Bruno mit dem tiefseeblauen Klebeband am Brillenrand.
Bruno mit dem ausgefransten Ausschnitt des Pullovers, den er beim Denken in den Mund nimmt, bis der Stoff verschwindet.
Bruno mit den dicken Brillengläsern und den vom Wissen vergrößerten Augen dahinter.
Ich habe bei Bruno einen Zettel gefunden.
Liebe Anita,
ich habe bemerken müssen, dass du in Geografie nicht sehr gut bist, um ehrlich zu sein, fand ich es schockierend, dass du die Hauptstadt Lettlands nicht kennst.
(Riga, 699 203 Einwohner, 7 m ü.M., größte Stadt des Baltikums.)
Ich könnte dir helfen. Ich könnte zu dir nach Hause kommen, und wir würden zusammen die Landkarte betrachten, und ich würde dich abfragen.
Lieber Gruß
Bruno
Bruno ist in Anita verliebt, und ich denke manchmal an Peter.
Das ist das Leben, sagte Mutter, das ist ganz normal.
Sie sagte, jetzt wirst du bald mein Rouge haben wollen und wirst sehr große Busen bekommen und deine Tage auch. Dann willst du eine Tätowierung und rote Lackstiefel haben wollen, Glitzerhemden, Kondome, alles.
Das will ich überhaupt nicht, sagte ich.
Du wirst schon sehen, sagte Mutter.
Wirklich nicht, sagte ich.
Doch, doch, sagte sie.
Mutter kommt aus der Dusche. Sie trägt ihren Kopf auf einem langen Hals, auf dem die Muttermale oberhalb des Schlüsselbeins beinahe eine Perlenkette ergeben. Manchmal möchte ich ihren Hals berühren, die Muttermale, aber ich weiß nicht wie; ihre feinen blonden Härchen am Hals. Manchmal denke ich, dass Mutter zu groß, zu blond und zu lebendig ist, dann tut es mir leid. Manchmal wünsche ich mir eine Mutter mit mattem Haar, zerknitterter Schürze, sanften, müden Augen.
Manchmal vermisse ich Mutter, obwohl sie da ist, und manchmal habe ich das Gefühl, sie sitzt in mir drin.
Mutter sagte einmal, wenn man tanze, dann liebe man das Leben, und wenn man tanze, liebe einen das Leben auch. Das weiß ich noch, weil sie, als sie das sagte, einem Huhn ein Bein abtrennte, ich erinnere mich an das Messer im Huhn.
Wenn sie hingegen Tee trinke, sagte sie, dann werde sie krank. Das sei wegen des Geschmacks, da reagierten die Zellen drauf, die reagierten auf den Geschmack von Tee mit Krankheit.
Also ist Tee das Gegenteil von Tanz, sagte Mutter.
Blödsinn, flüsterte Bruno. Das weiß ich noch, weil, als Bruno das sagte, Mutter mit dem Messer auf ihn zeigte. Ich erinnere mich an die Lichtreflexion auf dem Messer.
Wind schlägt die Fensterläden gegen die Wand. Tack, tack.
Mutter sitzt auf ihrem unendlichen Bett und lächelt.
Zu mir kommen, sagt sie mit den Fingern.
Wir legen uns auf sie, und sie sagt, es ist gut.
Die Tropfen kleben als Perlen an der Scheibe. Dann zündet sie sich eine Zigarette an, und der Rauch steigt als Faden vor ihren Augen an die Decke. Wir liegen in ihrer seidenen Goldbettwäsche. Im Kleiderschrankspiegel und den drei Spiegeln hinter Mutters Bett sehe ich uns unendlich oft auf dem Bett sitzen. Unendlich viele Rauchfäden steigen an die Decke, unendlich viele Brunos haben ihren Kopf auf Mutters Beine gelegt, unendlich viele Ichs schauen mich an, und unendlich viele Mutterkörper sind von ihren Kindern halb bedeckt.
Ist gut?, frage ich.
Ja, ist gut, sagt sie.
Was ist gut?, fragt Bruno.
Alles, sagt sie.
Alles ist gut?, frage ich.
Ja, sagt Mutter, alles gut.
Dann kratzt sie Eingetrocknetes vom Nachttisch und schaut sich selbst dabei zu.
Also wirklich alles gut, sage ich und umarme Mutters Rücken. Ich lege mein Gesicht an ihr Schulterblatt, das von der Kratzbewegung ihrer Finger auf und ab geht. Ihr Hemd ist aus einem feinen Stoff.
Und als Mutter aus ihrem Schweigen auftaucht, beginnt sie, von Freundinnen zu reden. Sie hätte Freundinnen gehabt, früher, sagt sie, mit denen sie auch so gesessen und gelegen habe, manchmal, und sie hätten über dies und das und Träume und Männer und Vorstellungen und Begegnungen und Bewegungen geredet. Und irgendwann hätte sie aber bemerkt, wie es immer weniger Bewegungen, Begegnungen und Vorstellungen wurden. Immer weniger Wahrheit in den Begegnungen, sagt sie. Bis sie irgendwann ihren Freundinnen so fremd geworden sei, dass sie sich gewünscht habe, ihnen fiele der Mond auf den Kopf.
Warum der Mond?, fragt Bruno.
Ja, der Mond, sagt Mutter.
Und dann saßen wir nie mehr zusammen und auch sonst nirgends mehr, und jetzt bin ich mit euch hier. Ihr seid jetzt meine Freundinnen, sagt Mutter.
Wir sind deine Kinder, sagt Bruno.
Noch schöner, sagt sie, und dann singt sie ein Lied, aber kann den Text nicht, also summt sie, aber weil das Summen nicht Singen ist, verstummt sie. Und dann schweigen wir. Es ist ein gutes Schweigen. Bruno schweigt am stillsten. Mutter eher emotional.