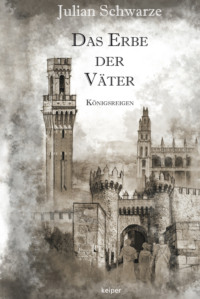Kitabı oku: «Das Erbe der Väter», sayfa 2
Tandûn von Amosthal war zweifellos nicht der gesprächigste Wegbegleiter gewesen, doch hätte sie sich einen Menschen aussuchen können, der an ihrer Seite weilen sollte, so wäre es ihr Lehrmeister gewesen, von dessen unerschöpflichem Wissen sie jeden Tag mehr erlernt hatte. Warum war er nur so stur gewesen? Warum hatten sie nicht gewartet? Das letzte Dorf im Tal zu verlassen, war zu gefährlich gewesen. Hatten sie denn einen Grund gehabt, so bald hier in die Berge hinaufzusteigen?
Der Priester trat näher an sie heran und legte seine Hand behutsam auf ihre Schulter. »Komm, wir sollten die Seele deines Meisters aus dessen Körper befreien. Sie ist schon zu lange an das Leblose gebunden, Horodius der Ewige wird seine aufsteigende Seele erwarten.«
Gemeinsam schritten sie den kurzen Weg ins Zentrum des Bergdorfes hinauf. Jeder Dorfbewohner warf ihr misstrauische Blicke zu. Alle begannen zu tuscheln, einige verschwanden in ihren Hütten, andere hüllten ihre Häupter in Tücher oder verschränkten gar die Arme vor der Brust, um sie wütend anzustarren.
»Sie geben mir die Schuld für das Unwetter«, sprach das Mädchen, ohne darauf zu achten, ob es gehört werden konnte.
»Verzeih ihnen«, antwortete der Priester mit bedacht leiser Stimme. »Hier in den Bergen glaubt man, den Göttern näher zu sein als in den tiefgelegenen Städten. Umso härter trifft uns die Strafe eines Gottes, wenn wir dessen Groll auf uns gezogen haben.«
Sie erreichten einen runden Platz auf einer Anhöhe, in dessen Mitte ein großer steinerner Altar stand. Über dem Altar war ein Gestell aus Holz aufgebaut, auf das Tandûn von Amosthal gebettet war. Langsam traten sie näher und blieben wenige Schritte von dem Leichnam entfernt stehen. Marbana hatte noch nie zuvor einer Opferung beigewohnt, nun trat sie verlegen von einem Fuß auf den anderen. Eine Mauer hatte sich wie eine Blockade in ihrem Inneren aufgebaut, die weder Schmerz noch Trauer zuließ. Mit emotionslosem, leerem Blick starrte sie ihren einstigen Lehrmeister an, der über noch so viel Wissen verfügt hatte, das er nun nicht mehr seiner Schülerin weitergeben konnte.
Ihre ganze Familie war ihr genommen worden, doch die Leere der Einsamkeit war von Tandûn gefüllt gewesen, der ihr ein Vater gewesen war. Sie konnte sich kaum noch an ihre Mutter erinnern, nicht an Geschwister und auch nicht an einen leiblichen Vater. Einzig ihr Lehrmeister hatte sie großgezogen, solange sie zurückdenken konnte. Er hatte sie alles gelehrt, all ihre Fähigkeiten beherrschte sie dank ihm. Bei jedem Schmerz war er ihr beigestanden. Zwar hatte sie sich oft ein tröstendes Wort gewünscht, vielleicht auch eine zärtliche Geste, eine Umarmung, die sie nie empfangen hatte, aber er war treu an ihrer Seite geblieben und sie hatte stets Trost in seiner Gegenwart gefunden. Doch nun war auch er ihr genommen. Und nichts schien diese Leere jemals wieder füllen zu können.
Der Priester berührte ihren Arm und riss das Mädchen aus seinen Gedanken. Marbana sah auf und erkannte den Bärtigen, der sie im strömenden Regen gefunden und aufgenommen hatte. Neben ihm ging die Frau einher, die sie gepflegt hatte. Ihnen folgte der junge Bursche, der vom Bärtigen fortgeschickt worden war, um Hilfe zu holen. Die drei kamen näher, verneigten sich vor dem Altar, legten ihre Hand aufs Herz und sprachen ein leises Gebet. Dann stellten sie sich neben den Priester und schwiegen mit gesenkten Häuptern.
Varen berührte das Mädchen erneut an der Hand und reichte ihm einen silbernen Dolch. Es bedurfte keiner weiteren Worte, um zu wissen, was zu tun war. Marbana trat langsam auf den Altar zu, wo ihr Lehrmeister mit geschlossenen Augen auf dem Gestell lag, unter dem trockenes Heu gesammelt war.
Der Erzählung nach musste der Körper eines jeden Toten geopfert werden, auf dass die Seele von den reglosen Gebeinen getrennt werde, um zu Horodius dem Ewigen aufsteigen zu können. Noch nie zuvor hatte Marbana über alte Riten und den Glauben im Allgemeinen nachgedacht. Ihr Lehrmeister hatte sie gelehrt, ihre Vernunft zu gebrauchen, doch hatte auch er die Macht oder gar die Götter selbst nie infrage gestellt. Nun hielt sie den silbernen Dolch in Händen und blickte zu jenem Mann hinab, der ihr ein Vater gewesen war – und es immer bleiben würde. Sie beugte sich vor, küsste seine blasse, kalte Stirn, ehe sie den Dolch an seiner Brust ansetzte und mit zusammengepressten Zähnen die Klinge in das Herz bohrte. Sogleich brach sie in Tränen aus und sackte auf die Knie. Ein lautloser Schrei entglitt ihrer Kehle.
Der Priester trat an das Mädchen heran und überreichte ihm eine Fackel. Noch war die Opferung nicht vollzogen, der Körper musste verbrannt werden, damit die Seele mit dem Rauch auch sicher aufsteigen konnte. Mit schmerzendem Herzen entzündete das Mädchen das Heu unter dem Gestell und legte anschließend die Fackel auf die Kleidung des alten Mannes, die mit geweihter Flüssigkeit getränkt war, auf dass der Körper auch vollständig in Feuer aufging.
Sie saß in der Hütte auf einem Bett, die Beine angezogen, und starrte bei der kleinen Luke hinaus ins Freie. Es war später Nachmittag, die Sonne war bereits hinter der Bergspitze verschwunden. Die Tür wurde aufgeschoben und der Bärtige trat zusammen mit seiner Frau und dem Priester ein. Sie warfen dem Mädchen einen besorgten Blick zu, dann deuteten sie ihm stumm, zum Tisch zu kommen, wo sie sich eben niederließen.
»Du sagtest, nicht zu wissen, weshalb ihr hergekommen wart?«, fragte der Priester mit auffordernder Stimme, als das Mädchen sich zu ihnen auf die Eckbank gesellte.
»Mein Lehrmeister war auf der Suche.«
»Auf der Suche wonach?« Jegliches Mitgefühl oder etwa Besorgnis war aus den Augen des Bärtigen gewichen, der nun die Fremde mit strengem Blick musterte.
Als das Mädchen nicht antwortete, legte der Priester ein Bündel auf den Tisch. »Dies hattest du bei dir.«
Marbana wusste nur zu gut, was darin war. Es war die Schriftensammlung, erst jetzt wurde ihr das Abhandensein bewusst. Hastig griff sie danach und drückte die Sammlung an ihre Brust, als würde das Bündel eine Wärme ausstrahlen, welche die Kälte aus dem Körper trieb, die Muskeln lockerte und alles Misstrauen weichen ließ. Das Mädchen beugte sich vor und musterte die drei Dorfbewohner abschätzend.
»Mein Lehrmeister sprach von Männern, die geflohen sind. Einzelnen Männern, die als Fremde an den entlegensten Orten leben.«
Der Bärtige wechselte einen schnellen Blick mit dem Priester, dann starrten sie wieder das Mädchen an. »Was wollte dein Meister von dem Narren?«
»Dem Narren?«, fragte Marbana überrascht. Tandûn hatte nie einen Namen genannt.
»Der Narr ist vor einigen Jahren zur kalten Zeit in unser Dorf gekommen. Er verbrachte sieben Tage und Nächte am geweihten Altarsplatz, ehe er das erste Wort an unseren Dorfältesten richtete. Er bat um einen Platz in einer Scheune, dafür werde er jagen und seinen Dienst an der Dorfgemeinde leisten. An jenem Tag, an dem wir dich gefunden haben, ist der Narr jedoch verschwunden.«
Marbana sah einen nach dem anderen an. Sie wusste, dass ihr Lehrmeister zweifellos den Narren gesucht haben musste, doch konnte sie sich nicht erklären, weshalb. Hastig breitete sie das Bündel, das von mehreren Stofffetzen umgeben war, auf dem Tisch aus. Im Inneren lagen unzählige kleine Briefe, mit Namen versehen, teils noch versiegelt. Während die anderen ihr gespannt zusahen, überflog sie all die Adressaten, in der Hoffnung, einen Hinweis auf den Narren zu finden. Umso mehr überraschte es sie, als sie ein versiegeltes Schriftstück entdeckte, das ihren Namen trug. Zwar hatte sie all die Zeit über dieses Bündel bei sich getragen, Tandûn von Amosthal hatte ihr jedoch stets verboten, die Briefe durchzusehen oder gar zu lesen. Sogleich erbrach sie das Wachssiegel, das den Stempel ihres Lehrmeisters trug, und begann zu lesen.
Dir, Marbana, tüchtigste Schülerin und treueste Gefährtin.
Wenn Du diesen Brief liest, habe ich bereits versagt.
Doch in Dir liegt die Kraft, meinen Weg fortzuschreiten, meine Aufgaben zu vollenden.
Verzeihe mir, dass ich Dich nicht eingeweiht habe, Dir nicht den wahren Grund unserer Reise genannt hatte. Ich bin geplagt von Zweifel, ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, auch der richtige ist. Mit meiner Suche nach den Abtrünnigen begehe ich Hochverrat am Königshaus! Sollte man uns gefangen nehmen, so will ich nicht, dass Du von meinem Vorhaben gewusst hast, sondern vielmehr, dass dieser Brief Dich womöglich entlasten könnte. Doch nun, da ich Dich nicht mehr führen kann, musst Du diesen Weg alleine fortsetzen. Wir brachen eben aus Tarangien auf, wo ich erfahren habe, dass jener, den wir suchen, in einem entlegenen Dorf in den Bergen zurückgezogen lebt. Er hat sich von seinem Weg als Krieger abgewandt, doch niemand kann sich seinem Schicksal entziehen, selbst ein Schützling der Göttin Helemâs nicht. Er hat geschworen, dem Volk zu dienen. Diesem Schwur muss er wieder Folge leisten!
Finde den Ersten dieser einstigen Krieger, den man den Narren nennt. Zeige ihm das Siegel auf diesem Brief. Er wird wissen, wer Dich schickt. Er wird wissen, wem er von mir berichten muss und welchen Dienst ich ihm abverlange.
Es erfüllt mich mit Stolz, Dich als meine Schülerin ausgebildet zu haben. Doch Du bist nicht mehr meine Schülerin. Deine Ausbildung ist seit unserer Abreise aus Bermos abgeschlossen. Nun bist Du die stolze Kriegerin, die Schriftenkundige, die Du einst sein wolltest. Es liegt an Dir selbst, ferne Städte zu bereisen, Wissen zu sammeln, um eines Tages als Gelehrte einem mächtigen Herrn dienen zu können.
Stolz und Enttäuschung erfüllten sie, als sie von dem Brief aufsah. Stolz darüber, was ihr Lehrmeister über sie geschrieben hatte. Stolz darüber, dass der alte Mann sie anerkannt und nicht mehr als das kleine Mädchen betrachtet hatte; Enttäuschung darüber, dass sie nicht mehr über den Narren erfuhr und weshalb sie ihn tatsächlich suchen musste.
»Was hat dein Meister geschrieben?«, fragte der Bärtige vorsichtig. Wortlos schob Marbana ihm den Brief zu, doch der Mann griff nicht danach, sondern starrte sie nur weiter auffordernd an. Als keiner Anstalten machte, den Brief lesen zu wollen, begriff das Mädchen und las den ersten Teil vor.
»Ihr kommt aus Tarangien?«, fragte der Priester überrascht, der nun doch den Brief genommen hatte und ihn still überflog. »Ihr habt einen weiten Weg hinter euch!«
»Komm!« Der Bärtige erhob sich von seinem Stuhl und schritt zur Tür hinaus. Hastig sammelte Marbana die Briefe zusammen und legte sie in das Bündel, das sie sich erneut um die Brust wickelte, ehe sie dem Dorfbewohner hinaus folgte.
Es dämmerte bereits, als sie das kleine Dorf querten und an eine Hütte traten. Der Bärtige schob die Tür auf und deutete ihr hineinzugehen. »Du schläfst heute hier. Es ist das Heim des Narren. Morgen verlässt du das Dorf! Du hast bereits genug Unheil über uns gebracht.« Ohne ein weiteres Wort wandte sich der Mann um und stapfte den Weg zurück.
Vorsichtig trat sie in das Innere der Hütte und sah sich mit zusammengekniffenen Augen um. Alles erweckte den Anschein, als hätte der Narr sein Heim fluchtartig verlassen. Die Felle, welche die Holzbank wohl in ein Bett verwandelt hatten, lagen verschoben oder waren zu Boden gefallen. Ein Stuhl stand inmitten des Raumes, im hinteren Bereich war eine Truhe, daneben eine Feuerstelle. Viel mehr an Einrichtung gab es nicht. Mit einem wehmütigen Seufzen schloss Marbana die Tür, ging zur Schlafstätte, rückte die Felle zurecht und legte sich nieder, um erneut, wie die Nächte zuvor, in trister Einsamkeit in Schlaf zu verfallen.
Ein leises Atmen war zu vernehmen. Jemand stand dicht neben ihr, sie konnte ihn riechen. Zweifellos ein Mann, dessen Kleidung nach modriger Erde und Tierfellen roch. Kaum wahrnehmbar öffnete sie die Augenlider für einen Spalt. Es war noch düster in der Hütte, doch sie konnte die Umrisse einer Gestalt neben sich klar erkennen. Mit einer schnellen Bewegung rollte sie sich zur Seite, holte mit ihrem Arm aus und schlug mit geballter Faust dem Eindringling in den Schritt. Noch ehe der Fremde stöhnend zurücktaumeln konnte, war sie aufgesprungen, umschlang seinen Hals mit dem Arm, schwang sich über seine Schulter und hielt ihn von hinten gefangen, während sie ihm mit der freien Hand über dem Becken in die Seite schlug. Sogleich sackte der Fremde erneut stöhnend unter ihrem Griff zusammen.
»Was willst du?«, fuhr sie ihn an.
»Lass mich los!« Die Stimme war erstaunlich jung.
»Sag mir, weshalb du hier bist!«
»Verrate du mir, was du vom Narren willst!«
Marbana ließ den Fremden los und stieß ihn nach vorn. Es wäre ihr ein Leichtes, den Eindringling erneut zu bezwingen.
»Wer bist du?«, fragte sie mit aufgeregter, aber bestimmter Stimme.
»Jophur. Meinem Vater gehört der Hof am oberen Ende des Dorfes«, antwortete der Junge zögernd, sichtlich von der Kraft des Mädchens überrascht.
»Was willst du hier?«
»Der Narr war ein Freund! Was willst du von ihm?«
»Weißt du, wo er ist?«, fragte Marbana, ohne auf seine Frage einzugehen.
Jophur zuckte mit den Schultern. Er war eingeschüchtert.
Marbana seufzte. »Mein Lehrmeister war auf der Suche nach ihm. Wir sind nicht die Einzigen, die ihn suchen, und bestimmt werden ihn die anderen finden, wenn ich es nicht tue. Nur dass ich nicht die Absicht habe, ihn zu töten.«
Misstrauisch musterte sie der Junge. Waffen trug sie tatsächlich keine – zumindest nicht sichtbar. Schließlich gab er nach und deutete ihr, ihm nach draußen zu folgen.
»Er ist in den Wald gegangen, nach Westen.«
»Hat er dir gesagt, wohin er wollte?«
»Nein, aber es führen Spuren dorthin, die nicht zurückführen – und er ist der Einzige, der das Dorf verlassen hat.«
»Was will er im Westen?«
»Es gibt einen Pfad durch die Berge, wenn man dem folgt, kommt man zu den Bergweiden und weiter nach Lamarn, wo auch die Tempelschule ist. Man kann auch in die Tiefebene hinabsteigen, nach Dumgust.«
»Kannst du mich dorthin führen?«
Jophur trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Der Narr war sein Freund gewesen, er war vor den zwei Fremden geflohen. Andererseits sah das Mädchen – trotz seines erstaunlichen Geschicks – nicht gefährlich aus und bestimmt würde der Narr es bezwingen können.
Was, wenn die Fremden eine Art Botschaft für den Narren hatten, schließlich war er hurtig geflohen, ohne abzuwarten, wer auf dem Weg ins Dorf war. Hin- und hergerissen starrte der Junge dem Mädchen schließlich in die Augen.
»Ich muss diesem Narren lediglich einen Brief geben«, seufzte Marbana ungeduldig. »Hilfst du mir nun oder nicht?«
»Ich zeige dir den Weg!«, gab Jophur schließlich nach.
Es setzte bereits das Morgengrauen ein, als sie durch das inzwischen belebte Dorfzentrum schritten. »Bist du bewaffnet?«, fragte er leise an Marbana gewandt, als sie zu ihm aufgeschlossen hatte.
»Ich benötige keine Klinge, um dich niederzustrecken, solltest du dich gegen mich stellen!«, zischte sie argwöhnisch zurück.
»Das hast du bereits bewiesen.« Er verzog schmerzlich den Mund. »Doch du wirst ein Messer im Wald brauchen und Proviant, zumindest eine Decke.«
Marbana nickte stumm. Der Bursche hatte recht, sie hatte alles in den Regengüssen verloren.
»Wir können alles für die Reise hier im Dorf besorgen – sofern du bezahlen kannst?«
»Sorge dich nicht darum!«, antwortete sie gereizt. Tandûn von Amosthal hatte großen Wert darauf gelegt, dass Marbana stets einige Kupferlinge eingesteckt hatte, sollten sie beide getrennt werden, ihr etwas zustoßen oder sie etwas besorgen müssen.
Sie erreichten im Dorf den Schmied, der mit seinem Sohn schon am Werke war. Bei ihm konnten sie ein kleines Messer kaufen. Im Haus gegenüber gab es einen Trinkschlauch und etwas Proviant zu erstehen. Zuletzt suchten sie den Hof von Jophurs Eltern auf, der etwas abseits im Westen des Dorfes lag. Während der Vater im Stall die Tiere fütterte, saß die Mutter in der Stube und flickte Kleider. Jophur gab Marbana eine Decke für die Nächte mit und führte sie zu der schmalen Straße, die in den Wald ging. Dort verabschiedete er sich von ihr.
Es war der zweite Tag, an dem sie durch den endlosen, einsamen Nadelwald ging. Sie war bisher keinem begegnet, wurde von niemandem verfolgt. Es war trostlos. Die meiste Zeit war sie in Gedanken versunken und dachte an ihren Lehrmeister. Inzwischen waren Wut und Zweifel in ihr aufgestiegen. Wut darüber, dass Tandûn sie nicht in seine Absichten eingeweiht hatte, Zweifel darüber, ob sie der Aufgabe gewachsen sein würde.
Wenn die Gedanken zu erdrückend wurden, versuchte sie sich den Narren vorzustellen, einen wohl verrückten Mann, vielleicht sogar bucklig und alt, der nur wirres Zeug sprach. Warum sonst nannte man ihn den Narren?
Gegen Abend erklomm sie, wie die Nacht zuvor, einen der breiteren Tannenstämme. Sie glaubte nicht an Verfolger, doch fürchtete sie Raubtiere, die im Dunklen gierig die kargen Wälder nach Fressbarem absuchten.
2. Kapitel
Eisiger Wind peitschte ihm ins Gesicht. Seine Augen waren zusammengekniffen, der Wasserdunst hatte in seinem dichten grauen Bart Kristalle gebildet. Sein Haar war von dem langen Marsch durch den tiefen Schnee verschwitzt und klebte nun steif auf seiner Stirn. Während seine rechte Hand den Wanderstab führte, umklammerte seine Linke fest den gefilzten Umhang vor der Brust. Er wagte nicht, die bläulich gefärbten Finger zu bewegen, in denen er kein Leben mehr fühlte.
Jeder Atemzug schmerzte den alten Mann in der Brust, seine Wollkleider waren gefroren, die lederne Hose steif, in den Stiefeln sammelte sich Schnee, den er bei jedem Schritt hineinschaufelte.
Seine Gedanken waren längst von dichtem Nebel verschleiert. Die Worte, die er immerzu stammelte, gaben ihm Mut, zwangen ihn zu weiteren Schritten und erinnerten ihn an den Eid, den er vor vielen Jahren geschworen und vor wenigen Wochen erneuert hatte. Er war Ermon, ein Gesandter, Phindorch und Quarandor des Hohen Sanglors Echandus von Dagosturas. Sein Leben war in Hinblick auf die Botschaft, die er geschworen hatte zu überbringen, bedeutungslos. Zu sterben sei ihm erst gestattet, wenn er seine Nachricht überbracht hatte.
War der Wind wie Peitschenhiebe, das gefrorene Wasser in den Stiefeln wie scharfe Dolchklingen, so war die Kälte sein größter Feind. Sie umschlang ihn wie einen Freund, ließ ihn allen Kummer und Schmerz vergessen – um ihn zuletzt, sobald er sie in sein Herz ließe, in die Knie zu zwingen und über seinen ewigen Schlaf zu wachen.
Er saß bereits gebeugt, die Hand die kleine Rolle unter seinem Umhang berührend, auf die er den Wortlaut seiner Botschaft geschrieben hatte, als das Peitschen des Windes dem Heulen der verlorenen Seelen wich.
Feuer prasselte. Mit einem tiefen Atemzug sog er den Qualm in sein Inneres. Ermon wagte nicht, die Augen aufzuschlagen und den gehässigen Fratzen der Torwächter entgegenzublicken. Jener Torwächter des Horodius, die über die Seelen urteilten, die Verdorbenen als ruhelose Schatten wandeln ließen, die Seligen bis zur Ewigen Halle geleiteten, wo all die tapferen Krieger, die starken Herrscher, Sangloren und Könige und Tempelwächter, zu steinernen Statuen verwandelt standen. Selbst große Künstler und begabte Handwerker weilten unter ihnen.
Sein ganzes Leben hatte er gedient, treu ergeben, nie des Eigennutzes bedacht. Nur dieses eine Mal war er von seinem Schwur abgewichen und die Strafe des Horodius fiel nun auf ihn herab wie die Axt des Henkers.
»Die Torwächter des Horodius sind weit fort, sie wagen es nicht, über die Seele des Phindorchs Ermon zu urteilen, sie in die Ewige Halle aufzunehmen oder ruhelos wandeln zu lassen.«
Verwundert riss er die Augen auf. Keine finsteren Kreaturen fielen über ihn her.
Er lag auf dem Boden, im Kamin lechzten Flammenzungen um Holzscheite und wärmten seine Brust, die mit einem dicken Bärenfell zugedeckt war. Zu seiner anderen Seite gähnte ein Villar, ein wildes Tier aus dem Bergreich, kaum zu zähmen, scheu und dennoch begehrt. Villare waren dem Hund sehr ähnlich, doch ihr Fell war dichter. Sie lebten meist als Einzelgänger in den hohen Bergen, waren ausgezeichnete Jäger, die alles Leben rissen, welches dem vielen Schnee trotzen konnte. Nur wenige dieser Tiere ließen sich domestizieren. Das Tier schnüffelte kurz an seinem Kopf, als er sich bewegte, und wandte sich, ohne weiteres Interesse an ihm zu zeigen, wieder ab.
Der Duft von warmem gewürztem Wein und Rauch lag in der kleinen Hütte. Licht gaben nur das Kaminfeuer und das Aufflammen der Glut einer Pfeife im Dunklen.
»Du hattest wahrlich geglaubt, Horodius der Ewige habe deine Seele aufsteigen lassen, wenn ich nicht gänzlich irre?« Die Glut der Pfeife leuchtete erneut auf und gab das bärtige Gesicht eines stämmigen Mannes zu erkennen, in dicke Filzkleidung mit einem Pelzüberwurf gehüllt. »Timerus der Mächtige selbst muss sich deiner angenommen haben, als er Kurus nach Osten zu den Hängen getrieben hat, um dort zu jagen.«
Der Villar hob kurz den Kopf, als er seinen Namen hörte, brummte, als kein Befehl des Herrn folgte, und bettete sein Haupt wieder auf seine Tatzen.
»Wahrlich, dass du mich gefunden hast! Den Göttern sei Dank.«
»Was treibt dich, dass du dieser Tage den Osthang erklimmst? Das ewige Weiß, der Schnee, der selbst zur warmen Jahreszeit nicht schmilzt, ist des Pilgers größter Feind.« Der Bärtige nahm einen Zug aus der Pfeife. »Warum bist du nicht der Straße gefolgt, hast bei den kleinen Gaststätten genächtigt, auf dass deine Reise sicher ist?«
»Mein Weg führt mich zum Niederen Sanglor Ogondorus dem Weißen«, murmelte Ermon mit schwacher Stimme.
»Doch nicht direkt, wie mir scheint.« Der Bärtige legte seine Pfeife auf den kleinen Tisch neben sich, hob einen Kessel hoch, der darauf stand, und befestigte den Henkel an einem Haken über der Feuerstelle.
»Ich wollte den Rat eines Freundes einholen, ehe ich in der Feste des Sanglors vorspreche.«
»Die Kunde, die du zu überbringen hast, muss von großer Bedeutung sein, dass du es wagst, den Schwur zu brechen.« Der Bärtige warf einen Blick auf die Rolle, die auf dem Tisch stand, seufzte und setzte sich wieder auf seinen knarzenden Holzschemel.
»Hast du ihr meine Worte entnommen? So weißt du von meinen Nöten.«
»Es stand mir nicht zu, sie zu lesen – nicht solange dein Herz noch schlägt, die Brust sich hebt und senkt!«
Der Quarandor seufzte schwermütig. »Du weißt, mein Herr und Manarch war kein Freund des Königs, doch er war der Krone ein treuer Diener und gehorchte dem Machtwort.« Er hielt inne, suchte mit den Augen die dunkle Holzdecke ab, als hoffte er, dort die rechten Worte zu finden.
»Du sprichst, als stünde der König nicht mehr«, sprach der Bärtige leise, ahnend, welch Botschaft der Quarandor überbrachte.
»Kein Schwert wird er noch heben, doch treu seine eigene Klinge in der Ewigen Halle halten.«
Es folgte ein Schweigen, während sie dem Knistern des brennenden Holzes lauschten und des Königs Tod gedachten.
»Mein Herr und Manarch schickte mich, noch ehe der Rat der Hohen Sangloren zusammen mit den Niederen Sangloren und den Adelsherren des Ostens in der Königsstätte zusammentreffen wird. Mein Herr bittet um das Gespräch mit Ogondorus dem Weißen.«
»Soweit mir bekannt, ist kein Niederer Sanglor an der Königswahl beteiligt. Warum sollten auch jene zur Königsstätte aufbrechen?«
»Der Rat der Hohen Sangloren wählt zumeist einen bereits bestimmten Nachfolger, den Erben des Vaters, um ihn als den neuen Herrscher zu legitimieren. Doch dieser Erbe nun, ein junger Knabe, ist zu viele Winter vom Mannesalter entfernt. Seine Mutter, Königin Sarina von Kairaden, hält noch die Munt über ihren Sohn. Doch sie ist verhasst beim Volk, man wird verlangen, dass sie heiratet. Einen Mann, welcher der Krone würdig ist! Verweigert die Königin eine erneute Eheschließung, damit ihr Sohn eines Tages das Erbe des Vaters antreten kann, wird er gewiss einem … Unfall … zum Opfer fallen.«
»Könige kommen und gehen.« Der Bärtige zuckte mit den Schultern, während er seine Pfeife ausklopfte, säuberte und mit frischem Tabak stopfte. »Es hat stets der Rat der Hohen Sangloren geherrscht. Er wird einen neuen mächtigen Mann zum König wählen, so verlangt es die Tradition.«
»Dir, mein Freund, mögen die Gehässigkeiten und Kämpfe um die Thronfolge fremd sein. Hier in den Bergen, wo einzig die Kälte des Mannes Feind ist. Sangloren, Manarchen, Krieger, Vanarchen, Söhne reicher Händler und selbst Künstler, Gelehrte und Phindorchen werden zur Königsfeste kommen, um die Hand der Königsmutter zu erbitten, während der hohe Adel eigene Pläne und Intrigen schmiedet, allen voraus Prinz Vindigor von Tallân, der Neffe des verstorbenen Königs. Unser Reich wird in Krieg verfallen! Die Quaranenreiche im Süden und Westen werden ihre alten Bündnisse und damit den Frieden brechen, sie werden ihre eigenen Grenzen stärken wollen, wegen eines Paktes mit dem neuen Königsgeschlecht. Man stelle sich vor, Bargodon von Milang würde seine Schätze nicht selbst verwalten, sondern dem neuen König – oder dessen Feind – übertragen! Das Reich Milang würde nicht länger den Frieden und den Handel sichern, es würde einen Keil zwischen alle Adelsfamilien treiben.«
Die Stimme des alten Mannes brauste, sein Bart bebte bei jedem Wort. »Doch während in unserem vereinten Königreich die Stadtstaaten und die Quaranenreiche gegeneinander zu Felde ziehen, werden die Königreiche weit jenseits unserer Grenzen ein Heer aufstellen. Sie werden erneut ihre Soldaten über den Salzigen See schicken, um unsere Länder zu erobern.«
Der Bergmann schwieg, seine Augen funkelten im dämmrigen Licht der glimmenden Pfeife, während dichter Rauch sein Gesicht verhüllte. Er war ein Mann des Schwertes, ein Krieger, kein Ratgeber, der das Spiel der Politik beherrschte, der Intrigen ausfocht und nach Macht strebte. »Ein Sturm ist aufgezogen. Der Mond wird sich leeren, ehe wir den Pass überwinden können«, sagte er schließlich bei dem Gedanken, den Alten zur Feste des Niederen Sanglors Ogondorus des Weißen zu geleiten.
»So viele Tage? Mir bleibt nicht diese Zeit!«
»Ich fürchte, mein Freund, deine Reise hat mehr Tribute eingefordert, als dir bewusst ist.« Der Bärtige schob die dichten Augenbrauen zusammen und deutete auf das Bärenfell.
Schmerz erfüllte den Leib des Quarandors. Er hätte geschrien, wäre er nicht von Schweigen umhüllt gewesen. Vorsichtig bewegte er seinen rechten Arm, führte ihn unter dem Fell hervor und betrachtete die bleiche Hand, in die das Leben zurückkehrte.
»Du solltest den Blick davor bewahren!« Der Bärtige erhob sich und kniete neben seinen alten Freund, doch dieser war von Bitterkeit ergriffen. Zitternd schob er das Fell von seiner Brust, stöhnend und keuchend betrachtete er seine leblose Linke, wo die Finger des Todes Farbe angenommen hatten.
Der Schmerz war ein Brennen und die Flammen leckten an seiner Seele. Er war ein Gesandter, ein Quarandor, ein Phindorch. Als hätte man dem Krieger den Schwertarm genommen, wurde er, der Schreiber, seiner Federführung beraubt.
Sein Bart bebte, die Augen blitzten wütend auf, als er zornentbrannt schrie: »Warum, bei Timerus dem Mächtigen, hast du mir die Hand nicht abgeschlagen, als ich noch schlief, und mir dies erspart?«
»Kein Phindorch sollte seiner federführenden Hand beraubt sein, wenn er in die Ewige Halle eintritt.«
Sie saßen zu Tisch und schlürften die wässrige Suppe. Der Bärtige wiederholte gedanklich den Vorgang einer Amputation. Einst war er ein Krieger gewesen, ein Sohn der Göttin Helemâs, ein Handlanger machtgieriger Anführer. Nur schmerzlich erinnerte er sich an diese Zeit zurück, in der er als Krieger durch die Lande zog, Schlachten in den Straßen der Städte oder auf dem Felde schlug. Eines hatten beide Orte gemeinsam: das Grauen, den Schmerz, den Gestank der Verwesung. Der Tod war so gegenwärtig wie die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht. Er hatte schnell gelernt, einfache Wunden zu versorgen, Blutungen zu stillen und durfte schließlich auch Amputationen beiwohnen. Dabei war nicht das Abtrennen der erkrankten, kaputten Glieder das Schwierige, oder der Schmerz, sondern die Zeit danach. Die meisten Menschen starben an Verblutung oder an einem eiternden Stumpf. Er hatte gelernt, sauber zu arbeiten, sich und die Wunde zu waschen, wusste, welches Werkzeug einzusetzen war, doch er konnte nicht voraussagen, ob sein Freund die Qualen überleben würde. Zumal er hier, in seiner entlegenen Hütte, nicht das Werkzeug der Heiler aus den Städten hatte.
Nach dem kargen Mahl schürte der Bärtige das Feuer, breitete grobe Leinen auf dem Boden aus, die das Blut aufsaugen sollten, und nahm Säge und Schaufel von der Wand, die er dort aufgehängt hatte. Er schliff seinen Dolch und legte ihn zusammen mit dem Schleifstein neben ein paar Leinenschnüre auf den Boden, während der Phindorch noch am Tisch saß und von dem starken Wein trank, den der Bärtige in einem kleinen Fass aufbewahrte, um sich zu betäuben. Danach kochte er ein paar Leinentücher aus und legte sie für später bereit.
Schließlich holte der Bärtige von draußen einen Kübel und ein Stück Holz, das er sorgsam mit etwas Leder umwickelte.
Schweigend sahen sich die beiden Männer an. Sie wussten, für das Leben gab es keine Gewissheit, für das Leid hingegen schon.
Der Bärtige musste seinen Freund stützen, der vom vielen Wein bereits benommen war, als er ihn auf die Leinen auf dem Boden bettete und ihm das umwickelte Stück Holz zwischen dessen Zähnen klemmte, auf dass er sich nicht die Zunge abbeiße. Danach nahm er die Bänder und band damit an mehreren Stellen den Arm fest ab, auf dass das Blut nicht mehr fließe.
Zuletzt legte er die Schaufel in die Glut und nahm den Kessel mit geschmolzenem Schnee von der Feuerstelle, um sich darin gründlich die Hände zu waschen.
Angespannt atmete der Bärtige tief durch. Er warf dem Quarandor einen letzten Blick zu, der zitternd nickte, seine wunde Hand ein letztes Mal betrachtete, dann sich abwandte.