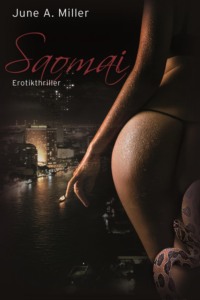Kitabı oku: «SAOMAI», sayfa 4
„Nein“, sagte sie, bemüht die Trauer abzuwehren, die Neills harmlose Frage in ihr weckte. „Meine Eltern sind beide tot.“
Er streichelte ihren Arm. „Das tut mir leid.“
Sie sah ihn an.
„Ist schon gut.“
Ist es nicht, dachte Neill, und bekam erstmals eine Ahnung, woher die Traurigkeit in Saomais Augen rührte. Doch offensichtlich wollte sie nicht mit ihm darüber sprechen.
„Wenn du von dieser Tempelanlage erzählst, kann ich mir wirklich vorstellen, wie es hier gewesen sein muss“, sagte er daher. „Und wie es wäre, wenn man das wieder aufbaute.“
„Ja, das ist mein großer Traum“, entgegnete Saomai mit einem tiefen Seufzer.
Sie fragte sich, ob Neill bewusst war, dass sie sich auf Bauland befanden, das er und Lamom bereits gekauft hatten. Auf jeden Fall konnte es nicht schaden, ihn weitere Ideen entwickeln zu lassen. Er legte ein überraschend feines Gespür für die Bewohner an den Tag.
Sie setzten ihren Weg fort und bogen nach wenigen Hundert Metern in eine belebtere Straße ein.
Fast ein Jahr lang hatte Saomai diese Ecke gemieden. Doch mit Neill ins Gespräch vertieft, hatten sie ihre Füße von ganz allein in die Nähe ihres Elternhauses geführt. Von allen Seiten wurden sie begrüßt, bis eine Traube von Menschen sie umringte. Alle plauderten fröhlich durcheinander. Neill verstand mit seinem wenigen Thailändisch doch immer wieder das eine Wort.
„Warum nennen sie dich Doktor?“, fragte er Saomai über die Köpfe der kleinen Thais hinweg.
„Das hat nichts zu bedeuten“, antwortete sie und war froh, dass jemand an ihrem Ärmel zupfte und auf die eiternde Wunde am Knie eines kleinen Jungen wies. Nachdem Saomai sie mit prüfendem Blick gemustert und der Frau in ihrer Landessprache geraten hatte, welche Kräuter sie besorgen und vermischen solle, wandte sie sich wieder Neill zu, der ehrfurchtsvoll beäugt wurde. Langsam und von tiefen Verbeugungen begleitet, bahnten sie sich ihren Weg durch die Menge, bis diese schließlich zurück blieb.
„Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass die Leute dich verehren“, sagte er und blickte sich noch einmal um. Dabei fielen ihm fünf Männer auf, die sich rüde durch die kleine Anhäufung von Menschen drängelten.
„Ach weißt du“, entgegnete Saomai, „ich habe eigentlich jedem hier schon mal geholfen. Rückenschmerzen gelindert, Medikamente besorgt und sowas. Die einfachen Leute denken dann gleich, man sei Arzt.“
Sie zuckte die Achseln und hoffte, dass das Thema für Neill damit erklärt sei.
Neill blickte noch einmal zurück. Die Männer waren verschwunden.
„Hmm“, murmelte er in Gedanken.
„Wußtest du, dass es in dieser Gegend noch richtigen Dschungel gibt?
„Wirklich?“ Neills Aufmerksamkeit galt nun wieder Saomai. „Mitten in Bangkok?“
„Ja wirklich. Noch bis vor etwa zehn, fünfzehn Jahren war die ganze Stadt davon durchzogen. Wurde ein Grundstück nicht mehr bewirtschaftet, weil die Leute alt waren oder es keine Erben gab, holte es sich der Dschungel zurück. So wie bei der Tempelanlage. Das ist wichtig für die wildlebenden Tiere.“
„Was denn für wildlebende Tiere?“, fragte Neill irritiert.
„Na, Warane, Schlangen, Affen…“
„Warane?“
„Ja. Hast du noch nie einen gesehen?“
Saomai konnte kaum glauben, dass Neill den Kopf schüttelte.
Dann lass uns zum Fluss runtergehen!“, schlug sie vor, „Da kann ich dir bestimmt welche zeigen!“
Sie übernahm die Führung und lotste Neill zielstrebig zwischen kleinen, auf Holzpfählen thronenden Häusern und Baracken entlang. Nach dreihundert Metern bog sie auf einen Plattenweg ab, der so von Dickicht überwuchert war, dass er Neill gar nicht aufgefallen wäre. Leichtfüßig sprang sie über Baumwurzeln, die die alte Pflasterung hier und da aufwarfen.
„Achtung, tritt nicht auf die Natter“, sagte sie und machte einen Ausfallschritt nach rechts.
„Eine Natter?“, rief Neill ungläubig und erstarrte, als er zwei Fußbreit vor sich ein leises Zischen vernahm. Der platte Kopf einer Schwarzschwanznatter reckte sich in die Höhe und erst jetzt sah er den zusammengerollten Schlangenkörper, der sich farblich kaum vom dunklen Untergrund abhob.
„Die tut nichts“, beruhigte ihn Saomai und ergriff seine Hand, um ihn um das Reptil herumzuführen.
Der Weg wurde nun abschüssig, die moosigen Steinplatten zu unebenen Treppenstufen. Neill achtete sorgsam auf jeden Schritt, den er tat. Noch eine Schlange wollte er nicht übersehen. Als Saomai unverhofft stehenblieb, lief er fast in sie hinein und gab einen überraschten Laut von sich.
„Pssst“, machte sie und legte den Zeigefinger an die Lippen. „Da ist einer, siehst du?“
„Was ist da?“, flüsterte Neill zurück.
„Na, ein Waran.“
„Nein, ich seh‘ keinen. Wo denn?“
Neill schmiegte die Wange an Saomais Haar. Sein Blick folgte der Hand, mit der sie ihm die Richtung wies. Sie duftete nach Lavendel.
„Da auf der untersten Steinplatte. Jetzt hebt er gerade den Kopf.“
Nun hatte auch Neill die Echse entdeckt.
„Die ist ja riesig“, rief er. „Bestimmt zwei Meter!“
„Naja, höchstens eineinhalb Meter“, lachte Saomai und wandte sich zu ihm um.
Seine unverhoffte körperliche Nähe ließ sie erschauern und den nächsten Satz nur stockend zu Ende bringen: „Kein Grund… zur Sorge. Warane sind scheu und… gleiten sofort ins Wasser, wenn man ihnen zu nah kommt.“
„Und was passiert, wenn man dir zu nahe komme?“, fragte Neill und hob Saomais Kinn, so dass sie ihn ansehen musste.
Saomai hielt seinem Blick nicht stand. Sie entzog ihm ihr Kinn und trat einen Schritt zurück. Ihre Gedanken fuhren Achterbahn. War Neill gerade dabei, ihr seine Gefühle zu offenbaren? Das konnte nicht sein! Und wenn doch, durfte sie das zulassen, wenn doch alles, was sie tat, pure Berechnung war? Nein, das wäre nicht richtig!
„Was ist mit dir?“, fragte Neill sanft.
Sie musste eine Entscheidung fällen! Ja, genau. Sie würde Neill sagen, warum sie ihn hierher gebracht hatte. Würde ihm sagen, dass sie über die Bebauungspläne Bescheid wusste und ihn umstimmen wollte. Sollte er entscheiden, wie es dann mit ihnen weiterging!
„Neill, ich muss dir etwas gestehen“, begann sie zaghaft. „Ich habe dich nicht einfach nur so hierher geführt. In dieses Viertel.“
Sie stockte und Neill nickte ihr aufmunternd zu, damit sie fortfuhr.
„Ich hatte gehofft, wenn du es kennenlernst, wenn du es mit meinen Augen sehen könntest, würdest du dich vielleicht darin verlieben.“
Unsicher sah Saomai zu ihm auf. Ein Tränenschleier nahm ihr die Sicht. Gleich würde ihr Traum zerplatzen. Doch statt sich gekränkt zurückzuziehen, trat Neill auf sie zu, legte zärtlich die Arme um ihre Schultern und lehnte seine Stirn gegen ihre.
„Das habe ich doch längst“, sagte er leise.
„Was denn?“, fragte Saomai verwirrt.
„Mich verliebt.“
Sie glaubte, sich verhört zu haben. Hatte Neill das wirklich gesagt? In ihrem Inneren jubilierte etwas und zugleich forderte ihr Gewissen die vollständige Aufklärung. Doch was konnte sie schon ausrichten gegen diese sinnlichen Lippen, die sich jetzt auf ihre legten. Gegen seine weiche Zunge, die die ihre suchte. Gegen ihr schwaches Fleisch, das nur allzu bereit war, sich diesem Mann hinzugeben?
Nichts, dachte sie und schloss die Augen.
Im nächsten Augenblick riss sie sie wieder auf. Im Niedersenken der Lider hatte sie gesehen, dass der Waran die Flucht ergriff. Instinktiv wandte sie den Kopf in die Richtung, aus der er eine Bedrohung gewittert haben musste. Keine zwei Meter von ihnen entfernt stand ein gedrungener Mann oberhalb der Böschung und grinste durch eine lückenhafte Zahnreihe auf sie herunter. In seiner rechten Hand blitzte ein Messer. Neill, dessen Lippen gerade Saomais Hals hinunter glitten, spürte, wie sie sich versteifte. Er hob den Kopf und folgte ihrem Blick. Im nächsten Augenblick spannte sich jeder Muskel seines Körpers. Beschützend schob er sich zwischen Saomai und den Fremden. Plötzlich schrie sie hinter ihm auf. Jemand hatte sie an den Haaren herumgerissen, ihre Tasche ergriffen und sie im Davonlaufen einige Schritte mit sich geschleift. Saomai strauchelte und landete unsanft im Dreck, während der Dieb durch das Dickicht die Böschung hinauf hechtete, und sich zu seinem Kumpan gesellte. Die beiden lachten in ihre Richtung und grinsten Neill herausfordernd an, bevor sie den schmalen Weg hinaufstürmten und zwischen den Hütten einer ungeteerten Stichstraße verschwanden. Neill blickte ihnen eine Sekunde lang nach. Dann war er bei Saomai und half ihr auf.
„Bist du in Ordnung?“, fragte er besorgt.
Er strich ihr über die Haare, die Arme, den Rücken, als müsste er sich überzeugen, dass sie nicht zerbrochen war.
„Ja, alles ok. Ist nur der Schreck“, sagte sie. Dann kam der Zorn. „Die Mistkerle haben meine Tasche geklaut!“
„Die hole ich mir“, schnaufte Neill. „Kann ich dich hier allein lassen?“
„Ja, nein“, antwortete Saomai perplex.
Bis sie begriff, was Neill vorhatte, setzte er bereits den Männern nach.
„Warte!“, rief Saomai und folgte ihm so schnell ihr rechter Fuß es zuließ.
Dann fiel ihr ein, dass sie Neill unbedingt warnen musste.
„Der eine hat ein Messer!“
Als sie keuchend den Sandweg erreichte, der sich zwischen Holzbaracken und verwahrlosten Häusern wand, hatte Neill bereits Boden wettgemacht. Doch Saomai stockte der Atem, als hinter ihm zwei weitere Gestalten auftauchten, die ihrerseits Neill verfolgten. Die Typen waren vom selben Schlag wie ihre Kumpel und Saomai begriff mit Entsetzen, dass Neill in einen Hinterhalt lief. Aus Leibeskräften schrie sie seinen Namen. Doch ihre Lungen kollabierten fast von der ungewohnten Anstrengung des Laufens. Ihre Stimme überschlug sich schrill. Neill hatte sie nicht gehört, er drehte sich nicht um.
Im Gebüsch neben ihr raschelte es. Alarmiert fuhr Saomai herum. Die Kontur eines korpulenten Inders löste sich aus dem tarnenden Dickicht und hielt torkelnd auf sie zu. Der Mann glotzte Saomai aus gelbunterlaufenen Augen an und grapschte nach ihr. Sein Atem stank nach Fäule und Alkohol. Angeekelt wich Saomai zurück. Die schwarze Pranke verfehlte nur knapp ihren Arm. Saomai sah sich gehetzt um. Es gab nur zwei Wege zur Flucht: links dem Sandweg folgen, auf dem Neill verschwunden war. Oder ein kleines Stück weiter rechts die Straße hinauf, die dort auf die belebtere Hauptstraße stieß. Weit würde sie es mit ihrem Fuß nicht schaffen, das war ihr klar. Deshalb entschied sie sich für letzteres. Betrunken, wie der Mann war, hatte sie eine kleine Chance, das kurze Stück die Straße hinauf zu entkommen. Auf der langen Gerade zwischen den Baracken würde er sie jedoch bald einholen und ob ihr dort jemand zu Hilfe kommen würde, war ungewiss. Der Inder hatte sie wieder ins Visier genommen und kam mit gierig ausgestreckter Hand auf sie zu. Dabei lallte er unverständliche Worte. Schaum troff ihm aus dem Mund, lief über sein schmuddeliges Shirt und spritzte auf Saomais Hand. Sie duckte sich unter ihm weg und ließ den Blick hin und her fliegen, um sich zu orientieren. Im Bruchteil einer Sekunde entschied sie sich, vollführte eine Drehung und drückte sich mit ihrem gesunden Fuß vom Boden ab. Das Manöver gelang und sie sprintete in die entgegengesetzte Richtung als ihr Angreifer erwartet hatte. Während er nach links torkelte, stob sie rechts an ihm vorbei. Doch schon nach wenigen Schritten bremste ein Stechen im Sprunggelenk ihren Lauf. Saomai fiel der Länge nach hin. Ihre Handballen platzten auf, als sie versuchte, den Sturz abzufangen. Vor Wut und Verzweiflung schrie sie auf. Auf allen Vieren vorwärts kriechend, wagte sie einen Blick zurück. Der Widerling hatte erst durch ihren Schrei bemerkt, dass sie zu entwischen drohte. Jetzt wankte er nach rechts. Dass sie am Boden lag, schien ihn zu beglücken, denn er lachte und leckte sich die wulstigen Lippen. Die Aussicht, von diesem Kerl begrapscht zu werden – oder Schlimmeres! – verlieh Saomai noch einmal Kraft. Sie wappnete sich gegen den Schmerz in ihrem Fuß, sagte sich, dass er nichts war im Vergleich zu dem, was ihr widerfahren würde, wenn sie liegen blieb. Als er sie fast erreicht hatte, stemmte sie sich hoch und schrie „Verschwinde!“
Von der Wut ihrer Stimme überrascht, blieb der Mann stehen. Er schwankte bedrohlich. Saomai überwand allen Ekel und gab dem Koloss einen kräftigen Stoß vor die Brust. Ohne das Ergebnis abzuwarten, fuhr sie herum und hechtete los. Den kaputten Fuß schleifte sie hinter sich her wie ein verwundetes Tier. Sie brachte vier oder fünf Meter zwischen sich und ihren Verfolger, bevor dieser grunzend auf die Beine kam. An seinem röchelnden Atem, in den sich unsägliche Geräusche mischten, erkannte Saomai, dass er aufholte. Die Verzweiflung trieb ihr Tränen in die Augen. Schweiß rann ihr über das Gesicht. Saomai konnte kaum noch den Weg erkennen. Wo blieb denn diese elende Straße, fragte sie sich panisch.
Wildes Hupen ließ sie wieder einen klaren Kopf bekommen. Vor ihr kam kreischend ein knallgelber Daihatsu zum Stehen. Saomai warf die Arme auf die Motorhaube, als wollte sie das Auto gefangen nehmen. Rettung, dachte sie erschöpft. Dann sah sie auf und erkannte hinter der Windschutzscheibe die schreckgeweiteten Augen von Tuk, der Krankenschwester aus dem Memorial Hospital. Außer ihrem Wagen konnte Saomai entlang der Straße niemanden erkennen. Das durfte nicht wahr sein! Was konnte die kleine Tuk schon ausrichten? Das herannahende Grunzen des Unholds holte Saomai aus der Schreckstarre. Er war nur noch wenige Meter entfernt und würde sie packen, wenn sie versuchte, die Beifahrertür zu öffnen. Also sprang Saomai nach rechts und brachte das Auto zwischen sich und den Inder. Im selben Augenblick schrie sie Tuk an: „Rutsch rüber!“ und riss die Fahrertür des Daihatsu auf. Noch ehe Tuk reagieren konnte, warf sich Saomai über die kleine Thailänderin und hieb die Verriegelung der Beifahrerseite nach unten. Keine Sekunde zu früh, denn ihr Angreifer packte eben den Türgriff und zerrte daran. Seine unterlaufenen Augen starrten dümmlich durch die Seitenscheibe.
„Rutsch!“, brüllte Saomai noch einmal aus Leibeskräften und schob sich gleichzeitig ins Wageninnere.
Endlich kam Bewegung in die nicht mehr ganz junge Frau und sie schlupfte auf den Nebensitz. Die Beine zog sie ungelenk über den Schalthebel. Mit dem Kopf stieß sie gegen die Scheibe, an die von außen das sabbernde Gesicht des Inders drückte.
Tuk schrie angewidert auf.
„Fahr! Fahr!“, rief nun sie in ihrer Panik.
„Ich kann nicht!“
Panik hatte auch Saomai ergriffen. Sie hatte den Wagen zweimal abgewürgt. Als er schließlich ansprang, brachte ihr geschundener Fuß nicht die Kraft auf, das Gaspedal zu bedienen.
„Mein Fuß“, stöhnte sie und schlug wütend auf das Lenkrad.
Mit einem höhnischen Lachen begann ihr Peiniger, den kleinen Wagen durchzuschütteln. Auch das noch! Doch nun übernahm Tuk geistesgegenwärtig die Führung. Sie quetschte sich am Schaltknüppel vorbei und landete auf Saomais Schoß.
„Füße weg!“, rief sie und legte den ersten Gang ein.
Mit einem Sprung ruckelte der Wagen einen guten Meter vorwärts, blieb den Bruchteil einer Sekunde stehen und schoss plötzlich nach vorn. Tuk, die mit dem Bauch am Lenkrad klebte, war nicht in der Lage, es zu bedienen. Deshalb griff Saomai um sie herum.
„Ich lenke, du gibst Gas“, sagte sie mit bebender Stimme und lenkte das Auto schlingernd in die Straße.
Noch einmal zuckten beide zusammen, als eine Faust auf das Autodach krachte, dann brausten sie in Richtung der Geschäfte davon. In Richtung Zivilisation, wie es Saomai erschien.
Als sie die erste Kreuzung passiert hatten, nahm Tuk den Fuß vom Gas und ließ den Wagen ausrollen.
„Dr. Saomai“, fragte sie atemlos, „was ist mit Ihnen? Wer war der Mann?“
Noch immer klemmte sie zwischen Saomai und dem Steuer, das Gesicht nur Zentimeter von der kleinen Windschutzscheibe entfernt. Leute blieben lachend vor dem Auto stehen und zeigten auf das ulkige Bild, das die beiden abgaben. Saomai fasste Tuk an der Hüfte und schob sich unter ihr hindurch auf den Beifahrersitz. Sie lehnte den Kopf gegen die Nackenstütze und rieb sich mit beiden Händen über die Augen.
Was ist mit Neill, fragte sie sich fieberhaft. Wohin hatten ihn die Angreifer getrieben? Und was mochten sie in diesem Moment mit ihm anstellen?
Saomai kämpfte die Panik nieder, die in ihr aufstieg und versuchte, sich den Verlauf der Straßen in dieser Gegend aufzurufen.
„Tuk, wohin führt die kleine Sandstraße, die unten am Fluß zwischen den Baracken verläuft?“
Tuk sah sie fragend an.
„Tuk, bitte“, flehte Saomai, packte die Schulter ihrer Kollegin und rüttelte daran. „Das ist wichtig!“
„Zum alten Tempel“, kam die überraschend klare Antwort.
Ja natürlich! Von dort war sie ja vorhin mit Neill in einer Parallelstraße gekommen. Kälte kroch in Saomai hoch, als ihr dämmerte, was vier muskelbepackte Raufbolde an diesem verlassenen Ort mit einem wehrlosen Mann anstellen würden.
„Wir müssen dahin“, sagte sie tonlos.
„Was?“
„Jemand ist in großer Gefahr, Tuk. Fahr los!“
Saomai kannte Tuk als hilfsbereite und gewissenhafte Krankenschwester, doch dass die kleine, rundliche Person nun ohne weiteres den Wagen startete und sich mit Vollgas in den Verkehr einfädelte, ließ ihr vor Verblüffung den Mund offen stehen. Und nicht nur das. Tuk war jetzt in ihrem Element.
„Auf dem Rücksitz liegt meine Tasche, darin ist mein Handy. Geben Sie es mir!“
Kaum hielt sie es in Händen, flogen ihre stummelkurzen Finger über die Tastatur, während sie den Wagen mit einer Hand um die Kurve manövrierte.
Sie bellte in ihr Telefon: „Komm zum alten Tempel. Und bring alle mit, die in der Nähe sind. Sofort!“
Als sie aufgelegt hatte, erschien ein Lächeln auf ihrem gutmütigen Thaigesicht.
„Meine Brüder“, sagte sie und warf Saomai einen zuversichtlichen Blick zu.
Lass sie rechtzeitig da sein, betete Saomai stumm und schloss die Augen.
Im nächsten Moment brachte Tuk den Daihatsu mit einer Vollbremsung zum Stehen. Sie hatten den Tempel erreicht und parkten mitten auf der Straße. Saomai sprang heraus und lief suchend auf das verwilderte Gelände zu. Dass sie ihren schmerzenden Fuß mehr mit sich zog, als dass er sie trug, bemerkte sie kaum. Zu groß war ihre Sorge um Neill. Wenn ihm etwas zugestoßen war, würde sie nicht mehr froh werden, das wusste sie. Wieso habe ich ihn nur hierher gebracht, fragte sie sich vorwurfsvoll. Er hat doch diesen Kerlen nichts entgegenzusetzen! Tränen rannen über ihre Wangen, als sie die Hände zu einem Trichter formte und seinen Namen schrie. Immer und immer wieder. „Neill, Neill. Bist du hier?“
Sie unterdrückte ein Schluchzen, um erneut nach ihm zu rufen.
Da sah sie ihn. Er kauerte auf der untersten Steintreppe des ehemaligen Tempels. Mit dem Rücken lehnte er gegen eine schrägstehende Säule, die zwischen eingestürzten Mauern klemmte. Seine Arme hingen schlaff herab, die Augen waren geschlossen. Saomais Atem stockte, da sie nicht erkennen konnte, ob er noch lebte. Eine kalte Hand griff nach ihrem Herzen, als sie noch einmal mit zittriger Stimme Neills Namen rief. Erst geschah nichts. Aus dieser Entfernung musste er sie doch gehört haben! Dann öffnete er die Augen, blinzelte und hob müde den Kopf.
Er lebt, dachte Saomai. Er lebt!
So schnell sie konnte, humpelte sie auf den Tempel zu. Beim Näherkommen entdeckte sie blutige Striemen in Neills Gesicht, seine Leinenhose war dunkel vor Dreck und rostbraune Blutflecken tränkten sein Shirt. Aber egal. Er lebte! Saomai schleppte sich die letzten Meter zu ihm und warf sich in Neills Schoß. Sie zitterte am ganzen Leib und brachte keinen Ton hervor. Sie hielt Neill umklammert und dankte den Göttern, dass sie ihn verschont hatten. Nach einer Weile hob sie den Kopf und sah unsicher zu ihm auf. Neill hatte sich kaum geregt und sagte nichts. Jetzt bemerkte sie, dass sein Blick ins Leere ging.
„Neill, ist alles in Ordnung?“, fragte Saomai ängstlich.
Vielleicht war er doch verletzt, hatte innere Blutungen. Die Ärztin in ihr erwachte und begann mit fahrigen Händen, seinen Brustkorb abzutasten.
„Tut das weh?“, fragte sie, als sie die Bauchdecke abklopfte.
„Nein.“
Neill nahm ihre Hände und hielt sie kraftlos in seinen.
„Ich bin ok“, sagte er mit schleppender Stimme. „Ist nicht so schlimm.“
Von seiner linken Hand troff Blut. Saomai drehte sie um. Ein tiefer Schnitt zog sich vom Zeigefinger bis zum Handgelenk. Erst jetzt bemerkte Saomai den großen feuchtschimmernden Fleck auf dem Steinquader neben ihm. Deshalb war er so lethagisch.
Ich muss den Blutfluss stoppen, dachte sie.
Verzweifelt sah sie an sich herunter, suchte etwas, das sich zum Abbinden der klaffenden Wunde eignete. Ihre verdreckte Shorts würde sich kaum zerreißen lassen. Also musste ihr T-Shirt herhalten. Sie sprang auf, um es sich über den Kopf zu ziehen, als Tuk mit fünf jungen Männern im Schlepptau auftauchte.
„Ist er verletzt?“, rief die Krankenschwester schon von weitem.
„Ja.“ Und als sie näher kamen: „Ich brauche einen Druckverband.“
Tuk wühlte in dem großen Lederbeutel, der an ihrer Schulter hing und zog Sekunden später eine Mullbinde hervor. Triumphierend hielt sie sie Saomai entgegen, griff erneut in ihre Handtasche und kramte eine weitere hervor.
„Taataa“, sagte sie stolz, „alles da für einen perfekten Druckverband!“
Sie lachte. Ein Lächeln machte sich auch in Saomais erschöpftem Gesicht breit. Dann fiel ihr etwas ein.
„Wo sind denn diese Typen eigentlich hin?“, fragte sie in die Runde.
Ein hübscher Kerl von etwa fünfundzwanzig Jahren trat hervor. Schüchtern sah er Saomai an. Tuk musste erzählt haben, dass sie Ärztin war, sonst hätte er vor seinen Freunden sicher ein anderes Auftreten an den Tag gelegt, das sah Saomai in seinen stolzen Augen.
„Wir kamen zufällig den Weg vom Fluß entlang und haben gesehen, wie ein Mann verfolgt wurde. Das war kurz bevor Tuk angerufen hat.“
Mit einem anerkennenden Blick auf Neill fuhr er fort: „Er hat sich ganz gut selbst verteidigt. Für einen aus dem Business District.“
Die Menschen hier sahen sofort, woher einer kam, das war Soamai klar. Neills Kleidung, seine Haltung, allein sein Haarschnitt verrieten jedem Thailänder, in welchem Viertel Bangkoks er lebte. Aber was hatte der Junge gesagt? Neill hatte sich selbst verteidigt? Ungläubig sah sie ihn an, während sie geschickt seine Hand verband. Neill schien das Geschehen nur noch benommen wahrzunehmen.
„Tuk“, fragte Saomai, als sie fertig war, „können wir ihn in deinem Auto zum Krankenhaus bringen?“
In Saomai nagte ein Verdacht. Kaum, dass Neill versorgt und in einen heilsamen Schlaf gefallen war, rief sie Tuk zu sich.
„Dr. Saomai, Sie müssen sich jetzt auch untersuchen lassen“, begann die Krankenschwester mit einem besorgten Blick auf Saomais Blessuren an Händen und Knien. „Besonders Ihren schlimmen Fuß!“, setzte sie nach.
Auf dem kurzen Weg vom Tempel zum Auto hatte sie Saomai gestützt, die bei jedem Schritt vor Schmerzen gestöhnt hatte.
„Später, Tuk“, sagte Saomai ungeduldig. „Vorher muss ich noch einmal mit deinen Brüdern sprechen.“
„Warum denn das?“, fragte die kleine Thai überrascht.
„Es hat mit diesen Männern zu tun. Ich möchte wissen, ob deinen Brüdern etwas an ihnen aufgefallen ist.“
„Gut, dann lasse ich sie herkommen. Aber in der Zwischenzeit gehen Sie zu Dr. Nadee!“, beharrte Tuk. „Er hat darauf bestanden, sie persönlich zu verarzten.“