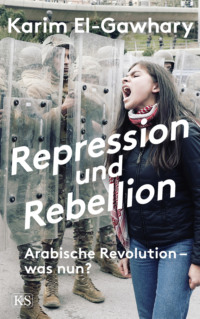Kitabı oku: «Repression und Rebellion», sayfa 2
Das Gegenbeispiel Tunesien
Auch aus den ersten Wahlen in Tunesien ging die islamistische Ennahda-Partei als der große Sieger hervor. In Europa und bei den Säkularen in der arabischen Welt ging die Angst um, dass nach Ägypten nun ein zweites arabisches Land infolge des Aufstandes in die Hände der Islamisten fällt. Demokratisch gewählt, war Ennahda jetzt zwar die größte, aber nicht die einzige Partei, die nun in der verfassunggebenden Versammlung am neuen Grundgesetz Tunesiens arbeiten konnte.
Dabei ließen die Tunesier erst einmal die Moschee im Dorf. Denn wenn die erste tunesische Wahl irgendetwas gezeigt hatte, dann, dass beide, die Islamisten in Form einer Partei und die Liberalen in Form von mehreren Parteien, zwei wichtige Strömungen in diesem Land darstellten, die einander nicht ignorieren konnten. Vorgezeichnet war aber dennoch ein ausgiebiger Streit über die Rolle von Religion und Staat in der Verfassung. Schließlich war es das erste Mal, dass sich beide gesellschaftlich relevanten Seiten in einer Demokratie offen mit dieser Frage auseinandersetzen mussten – ohne einen Diktator, der die Richtung vorgibt. Dabei waren die Islamisten der Ennahda-Partei keine Taliban, sondern eine relativ moderate islamistische Bewegung, die die Gesellschaft nicht mit militanten Mitteln, sondern über den Weg durch die Institutionen nach ihren konservativen Vorstellungen verändern wollten, und sie schlugen auch nach den Wahlen keine polarisierenden Töne an. Ihr Spielraum war ohnehin begrenzt. Die tunesischen Frauen waren und sind selbstbewusst und präsent genug, um sich ihre Rechte nicht einfach wieder wegnehmen zu lassen. Ausländische Investitionen und der Fremdenverkehr, von dem so viele Arbeitsplätze im Land abhängen, gaben den Islamisten nicht die Möglichkeit, selbst wenn sie gewollt hätten, einen islamistisch geprägten Staat in Tunesien zu gründen. Etwas, das übrigens langfristig auch für die Muslimbrüder in Ägypten gegolten hätte. Ennahda bildete 2011 zunächst eine Regierungskoalition mit zwei kleineren säkularen Parteien. Das reichte vorerst, um das Land nicht, wie Ägypten, entgleisen zu lassen.
Ägypten: Das Militär kehrt zurück an die Macht
Ägypten wurde indes durch die Polarisierung zwischen Muslimbrüdern auf der einen und Liberalen und Säkularen auf der anderen Seite immer unregierbarer. Nach einem Jahr Herrschaft der Muslimbrüder wurde immer deutlicher, dass das Land nicht von diesen alleine regiert werden kann, diese Lektion hatten die Ägypter gelernt. Doch die tunesische Lektion, dass das Land auch nicht ohne Islamisten regiert werden kann, die wollten sie nicht lernen. Beide Seiten standen einander unversöhnlich gegenüber. Der Ton wurde immer schärfer. Viele derjenigen, die gegen Mursi auf die Straße gingen, riefen dazu auf, die Muslimbrüder „fertigzumachen“. Und hier ging es nicht um ein paar Tausend Menschen: Millionen Ägypter sollten fertiggemacht werden.
Während sich auf den Straßen der Ärger über die Muslimbruderschaft in Massendemonstrationen entlud, in denen der Rücktritt von Präsident Mursi gefordert wurde, mobilisierten die Muslimbrüder wiederum ihre Anhänger unter dem Slogan der demokratischen Legitimität Mursis als ägyptisches Staatsoberhaupt. Und in all dieser Zeit plante das Militär im Hintergrund bereits die Machtübernahme. In ägyptischen Talkshows wurde bereits offen über ein Datum diskutiert, wann das der Fall sein könnte.
Am 30. Juni 2013 wurde dann das Ende Mursis eingeläutet. Es kam zu Massenprotesten gegen die Muslimbrüder, mit dem Tahrir-Platz als deren Zentrum. Dort hatten sich alle Gegner der Muslimbrüder versammelt. Es herrschte ein regelrechter Anti-Mursi-Rausch. Doch auch bei dieser ganz großen Anti-Muslimbruder-Koalition, die da auf dem Platz stand, waren die politischen Widersprüche der Post-Mursi-Zeit schon angelegt. Die Demonstranten einte einzig ihr Protest gegen die Muslimbruderschaft – über die Zukunft Ägyptens hingegen gingen ihre Vorstellungen weit auseinander.
Da standen zum einen jene auf dem Platz, die Mubarak Anfang 2011 gestürzt hatten, junge Tahrir-Aktivisten, Linke, Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie hatten beim Sturz Mubaraks den Blutzoll gezahlt. Neben ihnen war die „Sofa-Partei“ zahlreich auf dem Platz vertreten: jene Ägypter, die sich den arabischen Wandel bisher nur im Fernsehen angeschaut, sich aber nicht an ihm beteiligt hatten, und von denen nach einem Jahr Amtszeit Mursis immer wieder der Satz zu hören war: „Unter Mubarak war es doch besser.“
Und dann gab es da noch die alten Mubarak-Seilschaften zu sehen. Deren Vertreter hofften nun, durch die Hintertür wieder in das politische System zu kommen, nicht zu vergessen die Männer des Sicherheitsapparats, die sich nichts sehnlicher wünschten, als rehabilitiert zu werden, natürlich ohne ihren Unterdrückungsapparat reformieren zu müssen. Mit anderen Worten: Revolution und Konterrevolution feierten geeint in ihrer Ablehnung Muhammad Mursis und der Muslimbruderschaft. Und das eigentliche Zepter lag in den Händen des Militärs, das seine eigenen Interessen und Privilegien im Auge hatte.
Am 3. Juli 2013 verkündete Ägyptens Militärchef Abdel Fattah El-Sisi dann die Verhaftung Mursis und die Machtübernahme durch das Militär. Über Nacht hatte sich auch der Fokus der nationalen Debatte verändert. Statt über die Frage zu debattieren, wie viel Religion die Politik verträgt, stritt man nun wieder darüber, wie viel Neues und wie viele Reformen in dem Land am Nil durchgesetzt werden können. Das erinnerte ein wenig an den Ausgangspunkt der Revolution – alles begann von vorn, nur ohne die Muslimbrüder. Die gingen direkt ins Gefängnis, jedenfalls zunächst die Führungskader.
Die saßen nun zum Teil in den gleichen Gefängnissen wie die Vertreter des alten Regimes, allen voran Mubarak. Wie die ägyptische Justiz mit den neuen und den schon etwas länger Inhaftierten umging, war symptomatisch. Gegen die Vertreter des alten Regimes wurden oft Verfahren im Schongang geführt, an deren Ende sie meist freigelassen wurden – die korruptesten unter ihnen mit einer Ablasszahlung –, während die obersten Kader der Muslimbruderschaft von einem Verfahren zum nächsten getrieben wurden und in den Gefängnissen verrotteten.
Das ägyptische Tiananmen
Die Anhänger der Muslimbruderschaft bäumten sich noch ein letztes Mal auf. Sie richteten mehrere Protestlager ein. Das größte lag auf dem Rabaa-Al-Adawiya-Platz im Osten Kairos. Am 14. August 2013 begannen Militär und Polizei mit der blutigen Räumung des Platzes. Ich stand damals mit dem ORF-Team an einer der zum Rabaa-Platz benachbarten Kreuzungen. Wir diskutierten mit einem Team von Sky News, unter anderem mit dessen Kameramann Mick Deane, welche Straßen noch sicher seien, um zum Platz zu gelangen, und welche auch für Journalisten zu gefährlich. Wir blieben stehen, das Sky-News-Team zog weiter. Kurz darauf wurde Deane erschossen. Dessen Kollege Craig Summers stand direkt neben ihm, als das geschah. Deane sei mit Absicht ausgesucht und erschossen worden, ist dessen Überzeugung. „Ich weiß nicht, warum sie ihn erschossen haben, die einzigen Menschen um uns herum waren eine Gruppe von Frauen, die auf dem Boden saßen und den Koran lasen. Sonst war niemand in der Nähe“, erklärte er später bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung in Großbritannien. „Irgendjemand hat ihn mit seinem Scharfschützengewehr ins Visier genommen und geschossen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine anderen Schüsse um uns herum“, führte er weiter aus. Deane drehte sich noch zu ihm um und sagte, er sei getroffen worden. Dann sah man schon das Blut auf seiner linken Brust. Daniela Deane, seine Frau, schrieb später in der „Washington Post“: „Mein Mann war ein einfaches Ziel für einen der Scharfschützen des ägyptischen Militärs, der ihn vielleicht von einem weit entfernten Dach ins Visier genommen hatte. Er war groß und blond und mit seiner schweren Fernsehkamera auffällig zwischen den Demonstranten. Ich glaube, die Sicherheitskräfte hatten einfach genug davon, ihn dort filmen zu sehen und haben beschlossen, ihn zu töten.“
Wir harrten unterdessen weiter an der benachbarten Kreuzung aus. Noch war die Nachricht über den toten Kameramann, den wir gerade noch lebend verabschiedet hatten, nicht bis zu uns durchgedrungen. Wir warteten darauf, halbwegs sicher auf den Rabaa-Platz kommen zu können. Eine Frau kam vom Platz über die Straße gelaufen und schrie völlig aufgebracht: „Das sind Mörder, das sind Mörder“. Dann setzte sie sich auf den Mittelstreifen der Straße und hörte nicht mehr auf zu schluchzen. Vom Platz her waren zur gleichen Zeit fast im Minutentakt die Tränengasgranaten zu hören, die abgeschossen wurden. Immer wieder war auch das Peitschen von Gewehrschüssen auszumachen.
Die Straße, in der zuvor das Fernsehteam von Sky News verschwunden war, wurde inzwischen von einem gepanzerten Fahrzeug des Militärs abgesperrt. Der Soldat am Maschinengewehr, das dem Fahrzeug aufgepflanzt war, sah stoisch in eine kleine Menge von Demonstranten, die „Nieder mit der Militärherrschaft“ riefen. Bald flogen auch hier die ersten Tränengasgranaten. Die Menge wurde immer wieder zerstreut, um kurz darauf wieder zurückzukommen, als die ersten Verletzten aus dem Protestlager getragen wurden. Immer wieder kamen Krankenwagen, die von den Militärs durchgelassen wurden, und fuhren Richtung Rabaa-Platz. Von dort stiegen inzwischen schwarze Rauchwolken auf. Wir, die wir draußen vor dem Platz standen, wussten, dass dort etwas Schlimmes passiert sein musste, hatten aber noch keine Ahnung vom blutigen Ausmaß dessen, was da auf dem Rabaa-Platz geschehen war.
Kein anderes Ereignis in der neueren Geschichte hat die ägyptische Gesellschaft mehr gespalten. In anderen Teilen der Stadt jubelten manche Menschen, applaudierten und schwenkten ägyptische Fahnen. Später gratulierten der Innenminister und der Premier im Fernsehen der Armee und der Polizei für ihre ausgezeichnete Arbeit.
Zwei Jahre später zog die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein vernichtendes Fazit. „Es war weltweit in der neueren Geschichte einer der tödlichsten Einsätze gegen Demonstranten an einem einzigen Tag durch willkürliche und gezielte Gewalt von Sicherheitskräften“, schrieb sie in ihrem Untersuchungsbericht und nannte den blutigen Tag in Ägypten in einem Atemzug mit dem chinesischen Tiananmen-Massaker 1989, bei dem 400 bis 800 Demonstranten umgekommen sein sollen. Nach Zählung der Organisation sollen in Kairo am 14. August 2013 mindestens 817, wahrscheinlich aber über tausend Demonstranten innerhalb weniger Stunden erschossen worden sein.
Human Rights Watch kam nach der Befragung von 200 Augenzeugen und der Sichtung von Videomaterial zu dem Schluss, dass die Polizei auf die meist friedlichen Demonstranten mit scharfer Munition geschossen habe, dass aber auch Scharfschützen eingesetzt worden und Hunderte durch Kopf- und Brustschüsse umgekommen seien.
Die Unterstützer der El-Sisi-Regierung, der Armee und Polizei argumentierten, der Einsatz von Gewalt sei legitim gewesen, da die Polizei angegriffen worden sei. Auch die Menschenrechtsorganisation dokumentierte vereinzelt Fälle, in denen Demonstranten auf die Polizei geschossen hatten, „aber damit lässt sich niemals der unverhältnismäßige und vorsätzliche Einsatz von Gewalt gegen überwiegend friedliche Demonstranten rechtfertigen“, schlussfolgerte der Bericht. Selbst laut dem offiziellen Menschenrechtsrat, der im Auftrag der Regierung arbeitet, gab es unter den von ihm dokumentierten 624 Opfern nur acht tote Polizisten.
Auch das von Human Rights Watch untersuchte Videomaterial zeigte zahlreiche Szenen, in denen Sicherheitskräfte von Dächern und Polizeifahrzeugen aus schossen, ohne Deckung zu nehmen. „Ein ungewöhnliches Verhalten, wenn es eine signifikante Bedrohung durch Schusswaffen seitens der Demonstranten gegeben hätte“, stellte der Bericht der Menschenrechtsorganisation etwas lakonisch fest.
Der ägyptische Präsident El-Sisi und dessen Anhänger würden das Thema seitdem am liebsten unter den Tisch kehren. Für die Muslimbruderschaft ist der 14. August 2013 dagegen bis heute die wichtigste Referenz für die blutige Herrschaft des Militärs nach dem Sturz Muhammad Mursis.
Und in Tunesien?
Auch Tunesien drohte an der politischen und gesellschaftlichen Polarisierung des Landes zu scheitern. Die Angst der liberalen und säkularen Tunesier war groß, dass die islamistische Ennahda-Partei trotz ihres relativ moderaten Programms über die demokratische Tür doch versuchen würde, einen islamistisch geprägten Staat einzuführen. Als dann im Frühjahr 2013 zunächst der prominente linke Politiker und Ennahda-Kritiker Chokri Belaid von militanten Islamisten umgebracht wurde, kam es zu einem Generalstreik. Als wenige Monate später ein weiterer bekannter Linker, Muhammad Brahmi, ermordet wurde, folgten Massendemonstrationen, in denen auch dazu aufgerufen wurde, das von den Islamisten dominierte Parlament aufzulösen. Das Land stand vor seiner ersten großen Zerreißprobe seit dem Sturz des Diktators Ben Ali.
Dass es nicht so weit wie in Ägypten kam, ist im Wesentlichen der tunesischen Zivilgesellschaft zu verdanken, genauer gesagt dem „Quartett für den Nationalen Dialog“, das die Zügel in die Hand nahm, um Schlimmeres zu verhindern. Das Quartett bestand aus Vertretern des größten Gewerkschaftsverbandes (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail), dem Arbeitgeberverband (UTICA, Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), der tunesischen Menschenrechtsliga (LTDH, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme) sowie der einflussreichen Anwaltskammern (Ordre National des Avocats de Tunisie).
Das Quartett vertrat damit eine breite Palette von Interessen, einigte sich aber doch auf einen kleinen gemeinsamen Nenner, wie Tunesien aus der Krise geführt werden könne. Das Quartett fungierte als Vermittler zwischen den Parteien, forderte einen neuen Premierminister, ein neues Kabinett sowie ein neues Wahlgesetz und trieb die Diskussion um die überfällige Verfassung voran, die dann im Januar 2014 fast einstimmig verabschiedet wurde. Der nationale Dialog führte auch dazu, dass die von den Islamisten dominierte Regierung zurück- und an ihre Stelle ein Kabinett aus Technokraten trat.
Das ägyptische Szenario war damit für Tunesien abgewendet. Der Blick auf die Ereignisse im Nilland war sicherlich eine der wichtigsten Motivationen der Tunesier, sich zusammenzuraufen. Ganz besonders, da Ennahda das Schicksal ihrer islamistischen Kollegen in Ägypten, den Muslimbrüdern, genau verfolgt hatte und alle Tunesier vor Augen hatten, wohin eine weitere Polarisierung führen konnte.
Das Quartett erhielt für seine Arbeit verdienterweise 2015 den Friedensnobelpreis. Es habe entscheidend dazu beigetragen, eine pluralistische Demokratie in Tunesien aufzubauen und habe den Demokratisierungsprozess gerettet, als Tunesien am Rand eines Bürgerkrieges stand, hieß es in der Jurybegründung. Das Quartett habe seine Rolle als Vermittler und treibende Kraft bei der friedlichen demokratischen Entwicklung in Tunesien mit großer moralischer Autorität vorangetrieben, indem es die Grundlage für einen nationalen Dialog geschaffen habe, an dem am Ende 21 Parteien verschiedenster politischer Ausrichtung teilnahmen.
Aber es war nicht das letzte Mal, dass weise politische Entscheidungen nötig waren, um das Land zusammenzuhalten. Bei den Parlamentswahlen Ende 2014 schlug das Pendel diesmal in Richtung des säkularen Parteienbündnisses Nidaa Tounes aus, ein Parteienbündnis, das im Wesentlichen seine Gegnerschaft zu den Islamisten einte. Einen Monat später gewann deren Kandidat Beji Caid Essebsi die Präsidentschaftswahlen. Es sah so aus, als hätten die liberalen und säkularen Parteien nun die Islamisten an den Wahlurnen geschlagen und könnten mit ihrer Mehrheit den Kurs des Landes bestimmen.
Doch der neue Präsident Essebsi war ebenso um einen nationalen Ausgleich bemüht und nahm die islamistische Ennahda-Partei überraschend mit an Bord der Regierung. Das war ein weiterer Meilenstein in Tunesiens kurzer postrevolutionärer Geschichte. Bemerkenswert war hier die Zusammenarbeit zwischen Essebsi und dem Chef der Ennahda-Partei Rached Al-Ghannouchi, die die Zeichen auf Aussöhnung setzte. Essebsi war als Außenminister einst Mitglied des Regimes des Diktators Ben Ali gewesen, das Ghannouchi wegsperren und foltern ließ.
Doch auch in Tunesien war nicht alles rosig. Militante Islamisten trieben ihr Unwesen mit blutigen Anschlägen auf das Bardo-Museum in Tunis und auf eine Hotelanlage in Sousse. Ein tunesischer Student erschoss dort am 26. Juni 2015, während des Ramadan, am Strand des Imperial Marhaba Hotels 38 Touristen, die sich friedlich auf den Liegen gesonnt hatten.
Als ich am nächsten Tag dort ankam, herrschte am Hotelstrand eine Atmosphäre der totalen Fassungslosigkeit. Jemand hatte mitten in die am Tatort niedergelegten Blumen einen Zettel mit einer einfachen Frage gesteckt: „Warum“, stand darauf.
Der Attentäter, der 23-jährige Student Seifeddine Rezgui, war in keiner Weise auffällig geworden, bevor er mit einem Sturmgewehr am Strand auftauchte, um ein Blutbad anzurichten, das der IS später im Internet für sich reklamierte.
Drei Tage später traf ich dann Mayel Monsef, den stillen Helden des tunesischen Badeortes Sousse. Er brachte mich zu jenem Ort, an dem er drei Tage zuvor versucht hatte, den Strand-Attentäter zu stoppen. Die Polizei war nirgends zu sehen gewesen, da sei der Mann mit seinem Sturmgewehr diese Straße entlanggelaufen, erzählte er. Monsef führte mich auf das Dach eines dem Hotel benachbarten Hauses, in dem er am Tag des Anschlags gearbeitet hatte. Dort lag immer noch ein Stapel Badezimmerfliesen. Er führte mir vor, wie er ein paar dieser Fliesen genommen, diese mit den Worten „Du Hund!“ auf den Attentäter geschleudert und ihn dabei am Kopf getroffen hatte. Dieser sei dann noch ein paar hundert Meter weiter getaumelt und dann im hinteren Teil des Ortes von der Polizei erschossen worden. Er sei ein einfacher Mann, sagte der Fliesenleger. Er habe als Bürger und Muslim einfach nur seine Pflicht getan. „Der Attentäter ist kein wahrer Muslim. Der Islam hat noch nie gesagt ‚töte‘, und schon gar nicht an einem Freitag im heiligen Ramadan. Der Islam sagt, dass du den Menschen verzeihen und sie lieben sollst.“ Es ist dem tunesischen Fliesenleger und seinem beherzten Handeln zu verdanken, dass der Anschlag nicht noch mehr Menschenleben kostete.
Tunesien ging indes in sich. Am nächsten Tag fand vor dem Hotel in Sousse am Abend nach dem Fastenbrechen eine Demonstration statt. Von den Vertretern der säkularen Nidaa-Partei über deren Koalitionspartner, die moderate Ennahda-Partei, bis zur Opposition und zur Zivilgesellschaft waren alle gekommen. „Wir müssen in diesen Zeiten alle zusammenstehen“, erklärte mir dort der Arbeitsminister Zied Ladhari von der Ennahda-Partei. „Die Terroristen hassen unser Projekt, das einzig demokratische erfolgreiche in der arabischen Welt“, sagte er. Es habe nach der Revolution ein gewisses „religiöses Chaos“ gegeben, gab er zu. Und natürlich sei die Religionsfreiheit in der Verfassung garantiert. Aber die könne durchaus auch eingeschränkt werden, wenn es Menschen gebe, die mit ihrer Religionsinterpretation Gewalt legitimierten, sagte er.
Im ganzen Land wurden viele Fragen gestellt, nicht nur dazu, wie der Sicherheitsapparat besser aufgestellt werden könne, um auf solche Anschläge, die für die Tunesier neu waren, angemessen reagieren zu können. Im Zentrum der Debatte stand auch die Frage, wie ein bisher unauffälliger Student zu einer solchen Tat getrieben werden konnte und warum beim IS im benachbarten Libyen, aber auch in Syrien und im Irak, auffällig viele Tunesier aktiv waren. Wie konnte das Land seine Jugend von den Dschihadisten-Rattenfängern wieder zurückgewinnen?
Für Alaya Allani, einen ausgewiesenen tunesischen Experten für die militanten Islamisten, den ich später in der Hauptstadt Tunis traf, lag der Schlüssel in der wirtschaftlichen Misere des Landes. Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sei weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen. Bei den jungen Wählern sei es gar nur ein Viertel gewesen. „Das heißt, 75 Prozent der jungen Tunesier sind vom Arabischen Frühling und seinen Versprechungen enttäuscht worden. Sie bilden das Gros der Arbeitslosen. Damit ist es oft ein Leichtes für die Militanten, sie zu rekrutieren“, erklärte er.
Um dem nachzugehen, fuhr ich bei einer späteren Tunesien-Reise dorthin, wo die arabischen Aufstände ihren Anfang genommen hatten, in die südtunesische Kleinstadt Sidi Bouzid. Im Zentrum der Stadt steht eine Statue, die an den prominentesten Bürger des Ortes erinnern soll. Sie stellt einen überlebensgroßen Karren dar, wie er von Straßenverkäufern in Tunesien verwendet wird, und ist Muhammad Bouazizi gewidmet, jenem tunesischen Straßenhändler, der sich hier 2010 selbst angezündet hat, weil sein Karren und seine Waren von der Polizei des damaligen Diktators Ben Ali willkürlich konfisziert worden waren. Schnell wurde deutlich, dass in der Wiege des Arabischen Frühlings fünf Jahre danach Katerstimmung herrschte. Die Region ist eine der ärmsten Tunesiens, jeder Vierte hat hier keine Arbeit. Im Zentrum der Stadt, unweit der Statue, traf ich einen der besten Freunde des verstorbenen Bouazizi, der sich nur als Hamza vorstellte. Sein Fazit über die Errungenschaften nach dem Sturz Ben Alis war vernichtend. „Die Menschen hier sind enttäuscht von der Revolution. Es gibt noch weniger Arbeit als früher und viele Jugendliche versuchen von hier nach Europa zu kommen. Wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich auch gehen“, fasste er kurz und prägnant zusammen. Muhammad, ein anderer Freund Bouazizis, führte mich zu dem Haus, in dem die Familie des einstigen Straßenhändlers wohnte. Ein zweistöckiges, einfaches Haus, wie Hunderte andere im Ort. Die Familie war allerdings inzwischen nach Kanada ausgewandert. „Sie waren mehrfach bedroht worden und sind dann hier weggezogen“, erläuterte Muhammad. Ich dachte nur: Es ist kein gutes Zeichen, wenn die Familie des Revolutionshelden in den Nachwehen der Revolution flüchten muss.
Auch die Lage der Straßenhändler selbst hatte sich aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage noch verschlimmert. Etwa bei Marwan, der wie einst Bouazizi mit einem Karren am Straßenrand Obst und Gemüse verkaufte. Seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sei noch schwerer geworden, erzählte er. „Die Waren, die ich früher in zwei Tagen verkauft habe, werde ich heute kaum in einer Woche los“, beschrieb er den Niedergang. Und auch in einem Café in der Innenstadt hatten sie wenig gute Worte für das neue Tunesien übrig. „Du befindest dich hier in der offenen Wunde der Revolution“, beschrieb es Hafez, einer der dortigen Jugendlichen, anschaulich. Die Lage sei aussichtslos. Aus diesem Ort ziehe es mehr Jugendliche in ihrer Verzweiflung zu terroristischen Gruppen als nach Europa. „Was ist euch in Europa lieber?“, fragte er fünf Jahre nach dem tunesischen Aufstand.
Aber wenngleich viele Tunesier vor allem aus wirtschaftlichen Gründen an ihrer Revolution verzweifelten, zurück zu den autokratischen Zeiten wollte keiner, an der neugewonnenen Demokratie hielten sie fest. Anders als das ägyptische Militär, das eine jahrzehntelange Tradition hat, in der Politik mitzumischen, war das tunesische Militär immer eine Institution zur Landesverteidigung geblieben. Die Tunesier passten sich in den Zeiten nach dem Sturz Ben Alis immer wieder an die neue Lage an. Demokratische Werte und Transparenz waren ihnen zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden, die sie nicht mehr aufgeben wollten. Die Tunesier haben nie wieder über die Schulter zurückgeblickt.