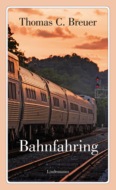Kitabı oku: «Tristans Tod»

Karin Hirn
Tristans Tod oder
Eine Reise nach Baden
Roman

Für meine Mutter
Karin Hirn M.A., geboren und aufgewachsen in Wiesloch / Heidelberg. Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Unterrichts- und Lehrtätigkeit an verschiedenen Bildungseinrichtungen und in der Erwachsenenbildung. Journalistische Tätigkeit. Arbeitet als Lehrerin in Heidelberg, lebt in Wiesloch. Erste Vorsitzende des „Kulturverein Johann Philipp Bronner“ in Wiesloch, Mitglied der „Gemeinschaft Christlicher Künstler“ Heidelberg und des „Kunstkreis Südliche Bergstraße“ in Wiesloch. Verschiedene Ausstellungsbeteiligungen und Einzelausstellung Fotografie im Rathaus Wiesloch. Seit 2008 im Denkmalschutz tätig. Fachpublikationen und Reportagen im Bereich Bildende Kunst und Industriegeschichte. 2011 erschien ihr erster Roman „Der Garten des Apothekers“ in Lindemanns Bibliothek.
Tristan
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
ist dem Tode schon anheimgegeben,
und wird für keinen Dienst auf Erden taugen,
und doch wird er vor dem Tode beben,
wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe,
denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen,
zu genügen einem solchen Triebe:
Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,
ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe!
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen,
jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen
und den Tod aus jeder Blume riechen:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
ach, er möchte wie ein Quell versiechen!
August Graf von Platen
(1796 – 1835)
Prolog 1
Ich hatte eine Liebe in Baden. Groß war sie und schön. Jetzt ruht auf ihr schwer die Erde. Braun ist die Erde in Baden, braun, feucht und fruchtbar. Es wächst viel auf dieser Erde – Blumen, Wiesen, Bäume und Wälder. Diese Wälder in Baden sind still und schweigsam. Ich kenne sie. Meine Liebe lebte darin. Ich denke an diese rotbraunen Buchenwälder, an die Mühle am Bach und an die Vögel im Wald. Noch heute höre ich das Hufegeklapper des kleinen Ponyfuhrwerks. Wenn ich dieser Liebe einen Namen geben sollte, dann trägt sie viele Namen und ganz besonders den Namen eines Mannes. Wenn ich die Vögel in den Wäldern benennen müsste, dann wäre es allein die Sprache meiner Liebe, die ihnen die richtigen Namen geben könnte. Seine Augen und seine Hände gaben den Dingen Gestalt und Kontur. Seine Augen schlichen sich in sie hinein, sie schwelgten darin und formten daraus neue, unsterbliche Eindrücke.
So war das damals mit meiner Liebe, kurz war die Zeit, die ihr blieb, und unsterblich tief war der Eindruck, den sie hinterließ.
Prolog 2
Wenn man liebt, so sagt man, vergesse man die ganze Welt. Er kann aber die Welt nicht vergessen, gerade diese Welt will er niemals aus den Augen lassen, solange er lebt. Daraus schlussfolgert er, dass er nicht lieben kann. Er vermöge nicht so zu lieben, denkt er, wie es in ausreichendem Maße notwendig wäre. Denn Welt bleibt bis zu seinem letzten Atemzug sein wichtigstes Gegenüber, das er zum Leben braucht, auf das er angewiesen ist wie die freie Luft zum Atmen, und ist sein bester Gesprächspartner.
Er kann nicht anders, er ist ja ein Künstler. Das erlöse ihn von der Sterblichkeit, so glaubt er. Dabei denkt er, dass die ursprünglichste aller Welten die Natur sei. Dieses Werden und Wachsen befriedigt ihn. Wozu braucht er da noch einen anderen Menschen?
Und doch – wenn er bereit wäre, seinen einsamen Beobachterposten zu verlassen, dann wäre wohl noch reicheres Leben möglich. Er würde sich dann an dies bis an sein Lebensende erinnern, so glaubt er.
Ja, tatsächlich, geade jetzt erinnert er sich an die unnachahmlich feine Linie eines leicht gebeugten Frauennackens, an die Einzigartigkeit unbeschreiblicher Anmut unverstellter Natürlichkeit eines Mädchens, dann erinnert er sich wieder an den dunklen Glanz zweier Augen und an die Bestimmtheit ihres Blicks. Nie vergessen wird er dieses Lächeln, einzigartig ist es doch.
Zwischen all seinen Erinnerungen tanzen die Lichtreflexe eines Sommernachmittags, leicht und luftig. Dieses Lächeln einfach zu vergessen, das wäre doch tatsächlich Verrat! An die reine Schönheit ihres Körpers nicht mehr denken zu wollen, wäre doch eine unverzeihliche Gedankenlosigkeit! Verrucht wäre es auch, sich nicht mehr an diese besondere Lust der Sinne erinnern zu wollen! So denkt er und fühlt sich zerissen in sich selbst. Er wolle doch, so behauptet er, von nichts und niemanden abgelenkt werden in seiner Suche nach Wiedergabe. Schon gar nicht von einer Liebe. Nach langem Überlegen muss er sich entscheiden: Die Lust, die ihm seine Kunst bringt, steht für ihn doch weitaus höher und ist doch weitaus mächtiger als alles andere. Das erhebe ihn über das Los der Menschen, so erwartet er.
„Wir wollen die Kraniche ziehen lassen, wenn es an ihrer Zeit ist“, bestätigt er.
Dies glaubt er und weiß doch nicht, dass auch er wie die Kraniche seiner Bestimmung folgen muss.
Seine Theorie geht nicht auf.
Und dann kommen die dunklen Gedanken.
Wenn er schmerzlos wäre, folgert er, dann wäre der Tod nur ein kleines Sterben.
Er weiß doch, dass er, wenn er malt, sein eigener unsterblicher Schöpfer ist. Es wäre wirklich der allergrößte Verrat, nicht mehr zu malen oder anderes wichtiger zu nehmen. Durch die Dinge über allen Dingen zu sein, das ist sein Wunsch. Der ist keinesfalls gering. Einen anderen will er aber nicht haben.
Und doch ist da dieser unaufhörliche Schmerz, der ohne Pause, bohrend, tagtäglich über ihn herfällt. Sein Plan geht nicht auf, er ist noch immer verletzbar. Da ist er wie jener Tristan, der unheilbar, ohne Aufschub, zwar sanft und doch unerbittlich, dem sicheren Ende zugleitet. Wie im Rausch treibt er dahin. Tristan liebt und Tristan malt.
Armer Tristan, dieser zweigeteilte, zerrissene Tristan. Für Tristan ist das Streben zum Unerreichbaren ein langsam wirkendes, tödliches Gift.
Tot zu sein ist, als würde man schlafen. Also, warum diese Furcht? Man würde tief träumen, ohne ein kommendes Erwachen, und für immer schmerzlos. Wenn Tristan schläft, dann schweigt für ihn die Welt, ihr Atem stockt für eine Weile, ihr Bewusstsein ist verhangen, der Schlag ihres Herzens wird von Minute zu Minute unhörbar.
Tristan, der Künstler, sagt, eine sterbende Liebe sei weitaus größer als eine lebende. Tristan kann sich nur im Tode der Liebe ergeben, ohne die Kunst zu verraten. Malend stirbt er. Oder er stirbt beim Malen. Jeder Pinselstrich ein wenig mehr. Das ist der Preis. Was schließlich übrig bleibt, ist einzig allein das Werk. Wenn dann im Werk die Liebe wohnt, erst dann hat sich das eine mit dem anderen versöhnt.
Kapitel 1
Am Mittag waren bei uns endlich die Gäste aus Baden angekommen. Unser ganzes Haus wogte in Aufregung. Das Zimmermädchen konnte mir und den jüngeren Schwestern heute nicht beim Ankleiden helfen. Heute musste uns das Schul-Fräulein zur Hand gehen. Wir beeilten uns, um pünktlich zu Tisch zu erscheinen. Helene und Lucille brannten vor Neugier, die fremden Verwandten in Augenschein nehmen zu können.
„Helene, Lucille, ihr wilden Mädchen, wollt ihr wohl stillhalten?“, empörte sich das Fräulein. Für sie waren wir wieder einmal eine wahre Tortur. Mich ließ sie in Ruhe, denn ich war alt genug, mir selbst zu helfen.
Der liebe Papa, der große und angesehene Justizrat Gontard, tätig am hiesigen Ministerium, und unsere schöne Maman, eine entfernte Verwandte unserer gerade angekommenen Gäste aus dem Großherzogtum Baden weit jenseits der Alpen, unterhielten sich im Salon bereits angeregt mit diesen deutschen Verwandten, von denen wir zwar einiges gehört, sie bisher aber nie zu Gesicht bekommen hatten. Höflich und mit Zurückhaltung – wir waren gut unterwiesen – betraten wir jetzt in Begleitung des Fräuleins das Gesellschaftszimmer. Während Lucille irgendetwas leise über „abstehende Ohren“ flüsterte, kicherte Helene in sich hinein. Das Fräulein empörte sich. Wie immer.
Dann standen wir schüchtern vor der freundlichen Tante Anna aus dem badischen Gau, knicksten wohlerzogen und küssten der Tante unter dem streng-wachsamen Blick des Fräuleins artig die Hand. Mir fiel gerade in diesem Moment ein, dass wir das vor einiger Zeit zum Spaß mit der Tatze unseres Teddybären in unserem Zimmer gemacht hatten. Jetzt hatten wir Übung!
Die Tante hatte ihren jüngsten Sohn Rudolf mitgebracht und der hatte sofort die Heiterkeit von Helene und Lucille erregt.
Rudolf sollte als neuer Hausgenosse für einige Monate unsere Gemeinschaft teilen, denn er sollte bei uns Französisch lernen. Hier bei uns in Lausanne am Nordufer des Genfer Sees kann man vortrefflich Französisch lernen.
Onkel Heinrich, der nicht nach Lausanne mitgekommen war, und Tante Anna machten sich nämlich allergrößte Hoffnungen auf Rudolfs Zukunft, sollte der doch in einigen Jahren die familieneigene Gerberei und später auch noch eine Schuhfabrik in Nachfolge Onkel Heinrichs leiten. Dazu brauchte er „Schliff“, wie Papa uns erklärt hatte. Lucille hatte dann gefragt, mit was Papa denn diesen Rudolf schleifen wolle, etwa mit Wasser wie einen Edelstein oder mit einem Bohrer wie einen Backenzahn? Papa hatte sie natürlich ausgelacht. Lucille ist einfach zu kindisch.
Jetzt war er also tatsächlich da, dieser „ungeschliffene Rohling“, wie er bei uns Kindern insgeheim genannt wurde. Und er hatte tatsächlich abstehende Ohren! Na, wenn alle Badener so aussahen! „Kein Wunder, dass sie alle Kriege verlieren!“, so dachte ich.
Tante Anna und Onkel Heinrich hatten eigentlich zwei Söhne, aber der ältere Sohn war kränklich – er müsse es wohl auf der Brust haben, wie Maman oft hinter vorgehaltener Hand zu sagen pflegte und sie zog dabei ihre Augenbrauen ganz weit nach oben – und konnte deshalb keinesfalls das Werk übernehmen. Es war also klar – Rudolf war der „Kronprinz“ der Familie.
Gott sei Dank war Onkel Heinrich nicht auf die Reise mitgekommen, denn er galt als äußerst grantig.
„Ein echter Wüterich aus unserer Montafoner Familienlinie“, hatte Papa gescherzt und auf eines unserer Familienwappen mit dem Steinbock gewiesen.
„Man erzählt ja allerlei Geschichten über ihn.“
Maman hatte ihn dann mit einer entschiedenen Geste und ihrem immer wiederkehrenden „Ne parlez pas devant les domestiques!“, schnell zum Schweigen gebracht.
Sie war ja so vornehm, unsere schöne Maman, und passte so wunderbar in unsere mondäne Lausanner Gesellschaft. Aber eigentlich, so dachte ich, war diese Gesellschaft doch recht langweilig, denn es war unfein, öffentlich zu sagen, was man dachte, oder zu tun, was man wollte. Man sprach immer nur um die Dinge herum.
„Umwege fahren“ nannte ich das so für mich. Papa war da ganz anders, denn er konnte es sich erlauben, die Dinge beim Namen zu nennen. Zumindest tat er das, wenn er zuhause bei uns war. Er fuhr nur gerade Wege und kam direkt zum Ziel.
Auch wenn Lausanne eine Stadt in der demokratischen Schweiz ist – und wir sind stolz auf unsere Eidgenossenschaft! –, so ist man hier doch recht aristokratisch. Zu aristokratisch, wie ich schon damals glaubte. Helene und Lucille dachten damals gar nichts, denn sie waren noch rechte Kinder und ein paar ernste Blicke des Fräuleins machten ihrem hastigen und albernen Gekichere sofort ein Ende. Ich, Philine Gontrard, dagegen ziehe es vor, mir selbst einen Reim auf die Dinge der Welt zu machen. Schließlich bin ich ja auch Papas „Älteste“ und weder albern noch kindisch. Nur noch etwas recht jung, aber das gab sich mit jedem neuen Tag.
Onkel Heinrich und auch Vetter Karl hatten uns also von ihrem Besuch verschont, nur Vetter Rudolf war jetzt da und dessen freche musternde Blicke trieben mir sofort ärgerliche Röte ins Gesicht. Sein rundes, dralles Bubengesicht ödete mich an. Es war wohl tatsächlich höchste Zeit, dass man ihm hier in Lausanne geschliffene Manieren beibrachte, dachte ich, Papa mit seiner Strenge würde hierfür schon Sorge tragen.
Kurz bevor die Gäste eingetroffen waren, hatte ich gerade meinen sechzehnten Geburtstag gefeiert, denn man schreibt das Jahr 1889. Im kommenden Winter planten die Eltern mich anlässlich einer Redoute in die feine Lausanner Gesellschaft einzuführen. Man hielt mich nämlich für so etwas wie eine kommende äußerst gute Partie. Die gesellschaftliche Position meines Vaters ist glänzend, unsere große weiße Stadtvilla nördlich des Sees wird von Maman hervorragend geführt und die vornehmen Lausanner waren oft bei uns zu Gast. Also stellte ich mir die kommende Zeit wie einen bunten, äußerst schmackhaften Kuchen vor, von dem ich einfach ein Stückchen abbeißen brauchte, um glücklich zu werden.
Der erste Missklang stellte sich mit Vetter Rudolf ein, den ich insgeheim bereits jetzt einen „deutschen Kraut- und Rübenjunker“ nannte. Ich fragte mich, wie der sich wohl neben mir in unserer Gesellschaft benehmen würde. Peinliche Bilder zogen mir durch den Kopf. Na ja, mit etwas Geduld würde ich sie ja bald am eigenen Leib erfahren und ertragen müssen, diese Peinlichkeit, die Rudolf mit Sicherheit überall wie ein aufdringliches Parfum hinterlassen würde. Wie plump, wie selbstgefällig und ungebildet er wirkte!
Jedenfalls nahmen meine Eltern diese badischen Verwandten mit ausgesuchter Höflichkeit in ihren Kreis auf. Die Tante lobte die Geschäfte der heimatlichen Gerberei und Fabrik ohne Unterlass. Unermüdlich würde der Onkel das Werk nähren und vergrößern, um im Deutschen Kaiserreich profitabel zu sein und mit Gewinn produzieren zu können. Sein Kompagnon, ein älterer Onkel namens Greiff, zeige viel technisches Geschick. Lobeshymne über Lobeshymne.
Leder kannte ich nur in Form netter kleiner Damenstiefel oder höchstens als angenehm geformten Reitsitz. Leder gerben, das duftete sicherlich nach totem Tier und anderem Gestank. Nichts für mich, entschied ich mich. Mir waren die Parfums lieber.
Jetzt lenkte Papa das Gespräch auf Vetter Rudolf und dieser fing auch sogleich mit dem Prahlen an. Er tat angeberisch kund, dass er oft zweispännig daheim durch den Ort donnere. Überhaupt schien er sich mehr für Pferde, Geschwindigkeit und allerlei Mutproben zu interessieren als für das Kalkulieren und Rechnen im Kontor. Während Rudolf so sprach, blickte ich in sein vollkommen glattes, bereits zur Rundlichkeit neigendes Gesicht, stellte mir vor, wie er mit seiner Kutsche durch sein verschlafenes Amtsstädtchen ratterte und dadurch zumindest etwas Wind wehen ließ. Der Kot der Schafe und Kühe musste meterweit aufspritzen. Aber Rudolf würde dieser Gestank kaum stören.
„Flegeljahre sind Herrenjahre“, nahm ihn Tante Anna auch schon liebevoll in Schutz. Was mein Vater dachte, konnte ich mir denken. Der hatte für solche Extravaganzen nicht das geringste Verständnis. Er würde diesen Rudolf erst einmal unter sein strenges Kuratel stellen und ich war mir sicher, dass die Tante insgeheim gerade darauf hoffte. Sie sah immer so besorgt aus.
Nicht nur Rudolf ließ sich schwer lenken, auch sein drei Jahre älterer Bruder Karl ließ die arme Frau anscheinend durch seine dauerhafte Kränklichkeit nicht zur Ruhe kommen. Da taten der Tante diese wenigen Ferientage hier bei uns am See sicher wohl. Ich mochte Tante Anna vom ersten Augenblick an wirklich gerne. Aber der Rest dieser Familie war schrecklich.
Als man die Tante nach Onkel Heinrich fragte, wir wollten ja der Höflichkeit Genüge tun, antwortete blitzschnell Rudolf für sie. Wie aus der Pistole geschossen warf er launig in die Runde: „Der sitzt jede Nacht auf Sauen!“
Peinlichstes Schweigen füllte den Raum. Helene kicherte, Maman räusperte sich und Papa fragte: „Was meinst du, Rudolf?“
Natürlich kam ihm wieder sogleich die Tante zur Hilfe: „Der Bub meint, dass Heinrich sich mit Leidenschaft der Jagd hingibt. Auf ‚Sauen ansitzen‘ heißt bei uns im Badner Land auf Treibjagd sein.“
Ich glaube nicht, dass uns diese Erklärung zufriedengestellt hatte, zumal Rudolfs Gesichtsfarbe sich in ein tiefes Dunkelrot verändert hatte. Hatte die Tante ihm nicht auch verhohlen und kurz an das Knie geklopft? Immerhin hatte er mit seinem Einwurf für Neugierde gesorgt. Was trieb bloß dieser Onkel in den Nächten drunten im badischen Land? „Auf Sauen sitzen“ klang für mich schrecklich gewöhnlich. Wir sitzen schließlich in Sesseln.
Nach dem großzügigen Souper gingen wir noch ein wenig im Garten spazieren. Das Fräulein reichte mir meinen Schal und nahm die beiden Schwestern mit auf deren Zimmer. Für kleine Mädchen war es allerhöchste Zeit, zu Bett zu gehen. Mir dagegen reichte Rudolf auf einen Wink Tante Annas galant seinen Arm, indem er dabei übertrieben militärisch seine Hacken zusammenschlug.
„So ist es recht, du Krautjunker!“, dachte ich im Stillen und nahm seine Höflichkeit mit majestätischer Großmut an.
Immerhin beherrschte er diese eine Manier fast perfekt. Als er neben mir lief, merkte ich, wie er kritisch mein Profil musterte und ich errötete von Neuem. Herrgott, musste der immer wieder starren und glotzen? Dieses Angestarre war wirklich penetrant und von äußerst schlechter Lebensart.
Wir schlenderten langsam hinter unseren Eltern her, die den mit Fackeln beleuchteten Kiesweg vorausflaniert waren. Der Garten war still und wie im Zauber, aber der öde Rudolf sprach nur von seinen Pferden, erzählte von der Jagd und vom Schießen und flüsterte, indem er mir immer näher kam, dass er schon wisse, wohin ihn sein Lebensweg führen würde. Ich wich zurück.
Zu den Soldaten wolle er, fuhr er fort, zu den großherzoglich-badischen Dragonern zu Karlsruhe und keinesfalls in ein blödes Kontor in einer verstaubten Amtsstadt. „Verstaubte Amtsstadt“ hatte er gesagt, immerhin, ganz so blöde und tumb schien der Junge gar nicht zu sein.
„Du wirst schon sehen, ich setze mich durch!“, wisperte er mir zu. Von diesem Geständnis war ich heftig erschrocken und mir tat die arme Tante leid, setzte sie doch so große Hoffnung in Rudolf. Schließlich hatte sie schon Karl enttäuscht. Ängstlich, ob die Tante schon von unserem Gespräch etwas gehört haben könnte, hielt ich nach den anderen im Dunkeln Ausschau. Wir hatten Glück, die Eltern schienen lebhaft in ein Gespräch mit Tante Anna vertieft zu sein und hatten Rudolfs Flüstern nicht bemerkt.
Am nächsten Tag lunchten wir alle im Hotel „Baur-du-Lac“ und begleiteten Tante Anna auf einer Einkaufstour durch Lausanne. Hin und wieder kam ein ratterndes, neumodisches Maschinenvehikel, ein Automobil, die Straße entlang gerollt, was alle Pferde scheu machte. Rudolf freute sich sehr über diesen Anblick, denn im Badischen gab es so etwas nicht. Da fuhr man wohl noch weitesgehend mit Ochsenkarren.
Die Tante war bester Dinge und kaufte mir einen sündhaft teuren rosa Sonnenschirm und die passenden Handschuhe dazu. Auch Maman war fröhlicher Laune. Sie spielte die Fremdenführerin und zeigte unseren Gästen die Stadt. Helene und Lucille waren zuhause geblieben, denn sie mussten beim Fräulein Stunden absolvieren.
Wie gut, dass meine Bildung bereits abgeschlossen war. Man hatte mir alles beigebracht, was eine höhere Tochter so können muss: ich malte nicht ohne Begabung – Maman verwies dabei immer auf die Familienlinie, die bisher etliche Baumeister und Maler hervorgebracht hatte – ich stickte zierlich, wusste einiges über Haushaltsführung, spielte leidlich Klavier, konnte in drei Sprachen mich an der Konversation beteiligen, hatte nahezu alle Modetänze erlernt und hatte den Unterricht im Höheren Töchterheim der Madame Gaultier hier in Lausanne besucht. Dazu hatte mir Maman noch lang und ausführlich erklärt, welche Themen ich innerhalb einer Konversation in der Gesellschaft anschneiden durfte und worüber zu schweigen war.
Also – ich war auf dem neuesten Stand!
Papa war allerdings der Meinung, dass eine modernes Mädchen aus dem höheren Bürgertum nicht nur fraulich wirken, sondern auch Elementares aus Wissenschaft und Bildung kennen müsse. Deshalb erteilte er mir Unterricht in der Mathematik und in Chemie. Unter uns gesagt, hatte Papa Recht und ich weiß, dass meine Fremdsprachenkenntnisse, besonders im Deutschen, lückenhaft sind. Aber damals träumte ich nur von einem, nämlich davon, dass möglicherweise schon am kommenden Tag das pralle Leben einer erwachsenen Frau sozusagen direkt vor meiner Türe stehen würde und dass es dann nur an mir liegen würde, ob ich es eintreten ließe oder nicht. Natürlich würde ich dieser Zukunft weit die Türe öffnen. Welcher Art dieses zukünftige Leben sei, das wusste ich damals noch nicht. Aber lockend war die Vorstellung davon und ich war neugierig und gespannt darauf, was die Zukunft mir bringen möge. Ich kam mir damals vor, wie einer, der unmittelbar vor dem Anbruch einer weiten, fernen Reise stand. Auf dieser Reise würde ich nur Gutes und Schönes erleben, das glaubte ich voll Überzeugung.
Wie einfach dagegen war das Leben meiner jüngeren Schwestern. Sie waren mit dem, was sie im Moment waren und hatten, völlig zufrieden. Sie wollten keine Veränderung und richteten sich in ihrer Kindheit ruhig ein. Ich wollte aber hinaus und wünschte mir sehnlichst auf meinem Lebensweg weiter und weiter zu kommen. Weiter und weiter, immer weiter bis zum fernen Horizont.
Kapitel 2
Er wurde am 15. Mai 1869 in der Amtsstadt Wiesloch im Großherzogtum Baden geboren und auf den Namen Karl Philipp getauft. Hineingeboren wurde er in das unaufhörliche Rauschen eines munteren Baches, in das rhythmische Hämmern von Fabrikmaschinen und in den immerwährenden Geruch faulender Tierhäute und gärender Eichenlohe. Täglich holperten die blutigen Fuhren am Haus mit dem Portal vorbei. Drinnen im Elternhaus, dieses weiträumige Haus mit den verwinkelten Zimmerfluchten, ging es stolz und hürgerlich zu, dort drinnen regierten die Mutter, Anna war ihr Name, und das Hauspersonal. Draußen auf dem Gerberplatz und im Wald regierte allein der Vater, Heinrich, dessen herrische Stimme sogar dem Wasser befahl, bergauf zu fließen. Dort draußen, inmitten der leblosen, schlaffen und ausgespannten Tierhäute herrschte dieser Vater als Fürst und König, unerbittlich regierte er und ohne jeden Kompromiss. Wenn er sein Reich, das aus Lohgruben und aus den gebeugten Rücken der Gerberknechte bestand, einmal verließ, dann verließ er diesen Ort des Todes, um mit seinem Gewehr im Walde weiter dem Tod Bahn zu schaffen. Er setzte jeden Schuss mit der langen Jagdflinte präzise und genau, er tötete das Wild mit einer einzigen Krümmung des Fingers am Abzug. Der Schuss krachte, das Tier stürzte nieder, der Tod hatte es augenblicklich ergriffen. Karls Vater war ein Meister des Todes, was diesen mehr als zufrieden machte.
Die Mutter, Anna, schloss gerade das Fenster, denn sie erlaubt dem Todesgeruch niemals ins Haus zu kommen. Sie weiß, was sie will, ist sie doch die Tochter des Posthalters am Ort und kommt so aus gutem Haus, dessen Torbogen ein goldenes Wappen ziert.
Posthalter sind auch die Großeltern gewesen, man sagt, Napoleon sei auf seiner Durchreise einst in der Posthalterei mit dem runden Torbogen abgestiegen. Vom Kaiser der Franzosen sind in der badischen Amtsstadt nur ein Stuhl und ein Fingerring übrig geblieben, auf dem Stuhl soll er einst gesessen haben. Und auch die vielleicht erfundene Geschichte darüber. Ein leerer Thron, ohne Anspruch auf Wahrheit, ein Stuhl, ohne das sitzende Hinterteil des Kaisers der Franzosen darauf, eine Reliquie ohne Inhalt. Das war damals gewesen. Jetzt sitzt auf diesem Stuhl, der in der guten Stube steht, stets mit Bedacht Heinrich, ihr Gatte. Der ist auch ein Kaiser, zumindest hält er sich für einen solchen. Dass Anna ihn geheiratet hat, ist kein Wunder. Annas Vater gerbte festes haltbares Leder, nachdem er die auf die Zahl Zwei angewachsene Posthaltereien hier in der Amtsstadt aus Gründen des Profits aufgegeben hatte. Das Gerben und Verarbeiten von Juchtenleder war recht einträglich geworden. Kein Erstaunen, dass Anna dem Sohn des Bürgermeisters und Lohgerbers das Jawort gab, so war doch nun der hoffnungsvolle Fortgang der Geschäfte für beide Familien gesichert. Die Liebe würde sich dann schon einstellen. Immerhin kamen zwei Söhne zur Welt und dadurch der Optimismus, dass die Geschäfte auch in der folgenden Generation fortgeführt würden. Nun lagen die größten Gerbereien der Stadt vereint in einer Hand und auf den Söhnen drückt jetzt das Erbe.
Annas Augen ruhen jetzt auf den zwei schmalen Jünglingsköpfen. Der ältere, Karl, ein Blondgelockter, sitzt am Tisch und beugt sich tief über ein Papier.
Wie schön er malt und zeichnet, denkt Anna.
Der jüngere, Rudolf, sieht ungeduldig zum Fnster hinaus. Sie sieht, wie ihm die Füße zucken.
„Den hält es nicht länger hier in der Stube!“, stellt sie betrübt fest.
Sein dunkler Haarschopf sitzt auf einem kräftigen Hals und seine Joppe spannt sich bereits über der Brust. Wenn er könnte, würde er gleich zum Vater hinüberlaufen und sich zwischen den Gerbern bei den Lohgruben herumtreiben.
„Der muss bald fort von hier, sonst wird er seinem Vater zu ähnlich.“
Anna weiß, dass er eine bessere Bildung als Gerberei und Pferdestall braucht. Sie seufzt bekümmert.
Karl, der Schmächtige und der, welcher stundenlang beim Zeichnen am Tisch sitzt, führt auf dem weißen Blatt geade eine feine Schaffur aus. Jeder Strich hat seinen überlegten Platz.
„Wie schmal er ist.“ Anna sorgt sich um ihn. Dann geht sie hinaus in den kleinen Garten am Bach mit den Blumenbosketten und der Fontäne. Der Gestank aus der nahegelegenden Gerberei hüllt sie wie in einen alten, modrigen Mantel, doch sie bemerkt den Geruch schon gar nicht mehr.
Karl sieht der Mutter nach und tritt ans andere Fenster. Nicht an das, vor dem der Bruder gerade sitzt. Er muss natürlich ans andere Fenster. Jetzt öffnet er den Fensterflügel und streckt den Kopf hinaus. Dort drüben läuft gerade die Mutter zwischen Lilien und Vergissmeinnicht den Kiesweg entlang. Karl zieht die Atemluft in sich hinein und prüft, was ihm da in die Nüstern kommt. Es ist nicht der verlockende Geruch der weißen und blauen Frühlingsblumen, sondern der stinkende Dunst von Fäulnis und Tod der schwitzenden Tierhäute. Nie wird er sich an diesen Geruch gewöhnen, so scheint es ihm. Dieser Modergeruch zieht von Westen den Bach entlang und umweht das ganze Haus.
Dort drüben ist ja die Gerberei. Für Karl ist sie ein Ort des Ekels und der Verwesung. Manchmal ist die Farbe des Bachs rot, dann haben sie dort wieder die Tierhäute im Bachlauf gespült.
Ein Bach voll Blut, denkt er, jeder Blutstropfen ist der Angstschweiß eines sterbenden Tieres gewesen.
Seit Generationen geht das nun schon so. Ein Sohn übernimmt das Gewerbe vom Vater und gibt es als Erbe an den nächsten Sohn weiter.
„Ich will dieses Erbe nicht. Es ist mir zu blutig. Ich will die Kreatur lebendig betrachten. Verschönern will ich sie auch – aber nicht so, nicht als trockene, braune Bälge, sondern so richtig nach dem Leben in allen Farben der Natur!“, so sinniert Karl zum Fenster hinaus.
„Der Gestank der Gerberei bringt mich um. Tag für Tag ein wenig mehr“, stellt er erbittert fest und lauscht unwillig auf das Gehämmere und Getöse der Dampfmaschinen aus der benachbarten Fabrik. Die Vögel hat der Lärm sowieso übertönt. Dieses Pauken und Röhren nimmt ihm alle Ruhe. Und mitten in all diesem Ungemach an Düften und Tönen steht der Vater, der ihm zur verlorenen Atemluft und zur gestohlenen Ruhe auch noch die Freiheit nimmt. Karl glaubt, dass er hier an diesem Ort sich selbst auflösen werde, bis er selbst schließlich nur noch grauer Staub ist.
„Zu einem stinkenden grauen Balg werde ich werden. Nein!“, so überlegt er, während er weiter in den Garten schaut. „Nein, ich muss fort von hier. Ich will nicht als grauer Schatten im Kontor der Fabrik verenden. Weg von hier, um wieder frei atmen zu können! Am besten in die Residenzstadt!“
Er weiß, dass dieses Vorhaben schwer zu verwirklichen sein wird, ja, dass es unmöglich sein wird, dass es scheitern müsse, dieses Vorhaben. Es ist doch auserwählt durch das Stigma dem Vater auf dem Thron im Kontor folgen zu müssen, er ist doch der älteste Sohn. Jetzt sitzt dort drüben im Bureau noch der alte Onkel, aber bald, sehr bald wird auch der Vater dort sitzen und dieser wird ihn, Karl, unerbittlich zu sich rufen.
„Fort, ach, fort von hier!“, wünscht Karl sich den nächsten Schritt herbei. Es wird aber nicht der folgende Schritt für ihn werden, höchstens der übernächste.
Einstweilen geht er Tag für Tag hinaus in den Wald, nicht in der Dämmerung, nein, dann ist ja der Vater mit der Flinte im Buchenholz, nein, am Tage geht er, im strahlend hellen Licht der Sommersonne. Dort findet Karl die milde Ruhe, die er sucht, und die gute freie Luft zum Atmen, die er braucht. Dort betrachtet er die Pflanzen und die Tiere. Er fängt sie nicht, er tötet sie nicht wie der Vater, sondern er bemüht sich, ihnen nochmals ihr Leben zu geben, indem er sie malt und zeichnet. Nicht das Kontorjournal interessiert ihn, sondern der Skizzenblock.
„Du taugst nicht!“, urteilt der Vater immer wieder über ihn und übergießt ihn mit seiner Verachtung, ihn, seinen Sohn, seinen Ältesten. Dabei scheint es Karl, dass die Statur des Vaters an Größe zunimmt. Mit jedem Tadel an ihn wächst er an Größe. Der Vater hat ja die Auswahl zwischen seinen beiden Söhnen. Er klopft Rudolf, dem jüngeren, anerkennend auf die Schulter, wenn dieser ein Wild mit einem Schuss nierdergestreckt hat. Karl klopft niemand auf die Schulter, wenn er einen Hirsch mit dem Rötelstift richtig getroffen hat. Rudolf, nur ganze vier Jahre jünger als er selbst, reckt sich immer wieder unter dem Lob des Vaters wie unter einer wärmenden Sonne. Es sieht ihn, Karl, dann herausfordernd an und schiebt trotzig die Unterlippe vor. Und dann steht Rudolf noch größer und noch aufrechter vor ihm unter dieser lobenden Berührung des geliebten und bewunderten Vaters. Karl dagegen, der den Vater auch bewundert und fürchtet, glaubt, dass er selbst wieder ein Stück an eigener Größe verloren habe unter der Verachtung des Vaters. Und dabei liebt er ihn doch auch.