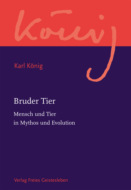Kitabı oku: «Die zwölf Sinne des Menschen», sayfa 2
Das Sinneswesen als Ich-Leib
Zur Sinneslehre von Karl König
Prof. Dr. Peter F. Matthiessen
Rudolf Steiner hat in seinem erkenntniswissenschaftlichen Hauptwerk Die Philosophie der Freiheit1 die (Sinnes-)Wahrnehmung und das Denken als die beiden letzt-begründenden Quellen aller Wirklichkeitserkenntnis aufgezeigt. Damit ist zugleich der Boden dafür bereitet worden, neben dem Denken auch die Sinnes-Wahrnehmung als unabdingbare Erkenntnisquelle anzuerkennen.
Im Gegensatz zum Denken, das wir tätig hervorbringen müssen, kennzeichnet sich die Wahrnehmung dadurch, dass sie uns ohne unser Zutun «gegeben» ist. So gehört das Phänomen der Letzt Gegebenheit zu den essenziellen Eigenschaften der Sinneswahrnehmung.
Meist sprechen wir von der Sinneswahrnehmung im Singular, obwohl sich die Sinneswahrnehmung in ganz unterschiedliche Sinnesbereiche bzw. Modalbezirke untergliedern lässt. Hier unterscheiden wir die fünf klassischen Sinne, nämlich Tastsinn, Geruch, Geschmack, Sehsinn und Hörsinn. Der Grund dafür, traditionellerweise fünf Sinne aufzuzählen, dürfte darin bestehen, dass bei diesen Sinnen die dazugehörigen Sinnesorgane unschwer aufzufinden sind. Es trägt die Kenntnis der organologischen Grundlage der Sinnesorgane jedoch nichts zu deren phänomenal inhaltlicher Erhellung bei: Als Alltagsmenschen und in den empirischen Wissenschaften gebrauchen wir unsere Sinne unhinterfragt.
Weiterführend für die Grenzziehung zwischen unterschiedlichen Sinnesmodalitäten und für die Verfolgung der Frage, wie viele Sinne des Menschen sich berechtigterweise darstellen lassen, hat sich ein phänomenologischer Ansatz erwiesen. «Dieser Begriff wird in sehr unterschiedlicher Weise gebraucht, vor allem auch im Sinne einer naiven Beschreibung der gewöhnlichen Lebenswelt. Was dagegen im Folgenden als Phänomenologie bezeichnet wird, ist eine erst durch Übung schrittweise zu erlangende Fähigkeit, von der Selbstverborgenheit der Sinneswahrnehmung und ihrer naiv-objektivistischen Handhabung zu einer Thematisierung des Sinnlichen selbst zu gelangen.»2 «Beim phänomenologischen Ansatz haben wir es nicht mit einer natürlichen, sondern mit einer durch eine mit freiem Willensentschluss herbeigeführten künstlichen Einstellung zu tun. Ihr Leitmotiv ist das Postulat der theoretischen Voraussetzungslosigkeit oder der konsequenten Urteilsenthaltung, der methodischen Ausklammerung aller Setzungen, Deutungen und Wertungen, insbesondere der Frage nach Wahrheit oder Falschheit, Wirklichkeit oder Unwirklichkeit, Objektivität oder Subjektivität. Was sich dieser Einstellung darbietet, ist das unmittelbar Gegebene.
Die Wahrnehmung selbst aber tritt originär auf. Sie bedarf keiner anderen Inhalte oder Erkenntnisse, auch keines physiologischen oder physikalischen Wissens, um gegeben zu sein.»3
Den Weg einer methodisch stringenten Selbstbeobachtung und einer konsequenten Erlebnisanalyse hat Rudolf Steiner als Erster aufgezeigt, indem er spätestens im Zusammenhang mit seiner erstmaligen Darstellung der Sinne des Menschen 1909 in dem Vortragszyklus «Anthroposophie» auf diese Vorgehensweise hingewiesen hat.4 Unsere begrifflich geleitete Intention löst dabei die Objekte der Außenwelt in ihre qualitativen «Eigenschaften» auf, die beim gewöhnlichen Wahrnehmen den Dingen gewissermaßen fest anhaften und richtet sich auf die Qualitäten als solche. Die sogenannte analytische Reduktion ist somit nur hinsichtlich der Auflösung der Dinglichkeit analytisch, während sie bei der Herausarbeitung des Qualitativen synthetisch vorgeht: Im Erfassen der Sinnesqualitäten als selbstständiger, auch durch eigene Begriffe repräsentierter Wesenheiten lösen wir uns aus der Verhaftung an die konkreten Gegenständlichkeiten der naiven Lebenswelt und vollziehen eine freie Synthese dessen, was über die Sinneswelt in Einzelerscheinungen verstreut ist. Die Grundsätze, nach denen in der modernen Sinneslehre die analytische Reduktion der Sinnesmannigfaltigkeit erfolgt, sind die Ähnlichkeit (Unähnlichkeit) und die Abhängigkeit (Unabhängigkeit) der verschiedenen Qualitätsbereiche.
«Führt man die analytische Reduktion der Sinnesmannigfaltigkeit konsequent weiter, so gelangt man schließlich zu Elementen, die begrifflich nicht weiter analysierbar sind, also rein phänomenalen Charakter besitzen. Es sind dies die sogenannten einstelligen Elemente der Sinneserlebnisse, z. B. das Erlebnis Rot. Die Sinnesphysiologie als experimentelle Wissenschaft unterscheidet sich nun von der Phänomenologie vor allem dadurch, dass sie diese phänomenalen Grundgegenstände nicht nur begrifflich aus der Sinnesmannigfaltigkeit extrahiert, sondern sie mittels entsprechender Versuchsanordnungen auch experimentell möglichst rein darstellt und die Bedingungen ihres Auftretens untersucht. In den ‹künstlich› erzeugten, rein phänomenalen Objekten der allgemeinen Sinnesphysiologie haben wir also einen Fall vor uns, in welchem der erkenntnistheoretische Grenzbegriff der reinen Wahrnehmung praktisch realisiert wird.»5
Ein Ergebnis dieser phänomenologischen Vorgehensweise ist die Auflösung, das Verschwinden der gegenständlichen Welt, und das Erstehen neuer Welten: einer Welt der Tasterlebnisse – und nur der Tasterlebnisse; einer Welt der Gerüche – und nur der Gerüche; einer Welt der Geschmackserlebnisse – und nur der Geschmackserlebnisse; einer Welt der Farben sowie von Licht und Dunkelheit – und nur der Farben sowie des Lichts und der Dunkelheit; und einer Welt der Töne – und nur der Töne.
Ein Vorgehen, bei dem methodisch dasjenige thematisiert wird, was die einzelnen Sinnesbereiche an spezifisch qualitativem Erlebniswert zeigen, ist von Erwin Straus als «Ästhesiologie» bezeichnet worden.6 Auf ihrem Boden ergibt sich für die moderne, erkenntniskritisch ausgerichtete Sinnesphysiologie (u.a. Hensel, Reenpää, Husserl, Steiner, König u. a. m.) die Möglichkeit, die einzelnen Sinne als Modalbezirke zu begreifen: «Die Modalität ist eine mehrstellige Eigenschaft, die eine ganze Gruppe von Sinneserlebnissen zu einem Modalbezirk verbindet. Dabei können wir aufgrund von Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsbeziehungen verschiedene Modalbezirke abgrenzen: die Sehmodalität, die Hörmodalität, die Bewegungsmodalität, die Tastmodalität, die Geruchsmodalität, die Geschmacksmodalität – um nur eine Auswahl zu nennen. […] Was die Modalbezirke voneinander sondert, ist ihre phänomenale Verschiedenheit. Wir sind uns ohne Weiteres darüber klar, ob ein Sinneserlebnis zum Bereich des Gesichts gehört oder zum Bereich des Gehörs. Ferner ist es evident, dass die verschiedenen Elemente eines Modalbezirks eine gewisse Ähnlichkeit besitzen, welche sie zu einer Teilmannigfaltigkeit – eben der betreffenden Modalität – verbindet. Eine gesehene Farbe und eine gesehene Räumlichkeit sind sich darin ähnlich, dass beide zum Modalbezirk des Gesichts gehören und nicht zu einem anderen Sinnesbereich. […] Man kann daher sagen, dass es in erster Linie die Qualitäten sind, welche die verschiedenen Modalbezirke konstituieren und ihnen das spezifische Gepräge geben.»7
Die Sinneserlebnisse haben unverwechselbare und spezifische Qualitäten, die in ihrer Gesamtheit die Sinnesmannigfaltigkeit darstellen. Diese phänomenale Struktur lässt sich aufgrund ihrer qualitativen Wesensinhalte beschreiben, in ihren gegenseitigen Verhältnissen untersuchen und begrifflich darstellen, ohne den Bereich des sinnlich Gegebenen zu überschreiten. Dies sei am Beispiel der Farben verdeutlicht: die Farbqualitäten lassen sich rein phänomenal nach ihren Wesenseigenschaften beschreiben und nach ihren unmittelbar erlebten Verwandtschafts- und Komplementaritätsverhältnissen in eine bestimmte Ordnung bringen, z. B. den Goethe’schen Farbenkreis, die Runge’sche Farbenkugel oder neuere Systeme des Farbendreiecks und Farbenkörpers. Gegenüber der Objektivität oder Subjektivität der Farben ist diese Farbenordnung völlig invariant; sie gilt unabhängig davon, ob es sich um Körperfarben, Lichtfarben oder Nachbilder handelt. Es liegt in unserer freien Entscheidung, dass wir die Wahrnehmungsdimension nicht nur – wie im natürlichen Alltag zumeist – auf die Dinge und die an ihnen als Eigenschaften auftretenden Sinnesqualitäten richten können, sondern, unter Abstraktion von den Dingen, auf die Qualitäten selbst.
«Wir können darüber hinaus im sinnesphysiologischen Experiment diese Qualitäten in reiner Form zum Erlebnis bringen. Hier zeigt sich eine spezifisch menschliche Fähigkeit des Wahrnehmens, die über die naturgegebenen Lebenszusammenhänge hinausreicht. Auf diesem Wege gelangen wir schließlich zu elementaren, nicht weiter analysierbaren Erlebnissen. Es sind dies die sogenannten einstelligen Elemente der Sinnesmannigfaltigkeit, z. B. das Erlebnis der Farbe Rot. Was Rot ist, kann man nicht definieren und deshalb auch nicht mit Worten sagen; man kann es nur erleben, und wer diese Erlebnisfähigkeit nicht besitzt, etwa weil er farbenblind ist, dem ist auch mit Definitionen nicht zu helfen.»8
Wie viele Sinne besitzt der Mensch?
Je nachdem wie sorgfältig man die auf Ähnlichkeitserlebnissen beruhenden Modalbereiche fasst oder phänomenologisch untersucht, wird man zu einer verschiedenen Anzahl von Sinnen gelangen. Die Sinneslehre von Aristoteles umfasst fünf Sinne, die neuere konventionelle, ästhesiologische Sinnenphysiologie unterscheidet acht bis zehn Sinne, Rudolf Steiner hat bei seiner ersten Auseinandersetzung (1909) zehn Sinne beschrieben, um später, ab 1916, zwölf Sinne zu beschreiben.9 Die Zahl zwölf ist auch für die von Karl König verfolgte Sinneslehre maßgebend. Da Karl König im Zuge seiner genialischen Schaffenskraft der von ihm vertretenen Sinneserkenntnis zwar eine durch seine Persönlichkeit eigenständig geprägte Auffassung zum zwölfgliedrigen Sinnesorganismus vertrat, andererseits aber sich ausdrücklich als ein Geistesschüler Rudolf Steiners empfand, auch bei seinen den Sinnen gewidmeten Vorträgen ausdrücklich Rudolf Steiner als Kronzeugen nennt, sei zunächst der Ansatz Rudolf Steiners zur Sinnesauffassung dargelegt.
Er, Rudolf Steiner, hat in seinen frühen erkenntnistheoretischen Schriften nicht nur die prinzipielle Unhintergehbarkeit dessen aufgezeigt, was uns die Sinne zeigen. In vier Vorträgen unter der Rubrik «Anthroposophie» (1909) hat Rudolf Steiner zudem das Spektrum der klar voneinander abgrenzbaren Sinne deutlich erweitert, indem er folgende Erlebnisbezirke als Sinne benennt und skizziert, welchen Sinnesbereich sie erschließen:
An Sinnen, die uns das eigene Leibeserlebnis vermitteln, werden als «untere» Sinne genannt:
Lebenssinn
Eigenbewegungssinn
Gleichgewichtssinn
An umweltbezogenen «mittleren» Sinnen führt Steiner folgende Sinne an:
Geruchssinn
Geschmackssinn
Gesichtssinn
Wärmesinn
Interessanterweise grenzt Steiner den Hörsinn hiervon ab und rechnet ihn zu den «oberen» Sinnen. An weiteren, an den Hörsinn angrenzend, zeigt Steiner noch folgende Sinne auf, die zuvor nicht als Sinne erkannt worden waren:
Hörsinn
Wortsinn
Gedankensinn
Diese Auflistung bedarf einer kurzen Kommentierung. Was die auf das Erleben der eigenen Leiblichkeit bezogenen Sinne betrifft, so handelt es sich im Rahmen des 1909 gehaltenen Vortrags sowohl um eine Neu- als auch um eine Erstbeschreibung. Dazu Steiner: «Was ist der Lebenssinn? Er ist etwas im Menschen, was er eigentlich, wenn alles in Ordnung ist, nicht fühlt, sondern nur dann fühlt, wenn etwas in ihm nicht in Ordnung ist. Der Mensch fühlt Mattigkeit, die er wahrnimmt, als ein inneres Erlebnis, wie er eine Farbe wahrnimmt. Und das, was im Hunger- oder Durstgefühl zum Ausdruck kommt oder was man ein besonderes Kraftgefühl nennen kann, das müssen Sie auch innerlich wahrnehmen wie eine Farbe oder einen Ton. Man nimmt dies in der Regel nur wahr, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Die erste menschliche Eigenwahrnehmung wird durch den Lebenssinn gegeben, durch den der Mensch als ein Ganzes sich seiner Körperlichkeit nach bewusst wird […] Niemand kann Sinne verstehen, der nicht weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, sich als Ganzes innerlich zu fühlen, sich als einer innerlich geschlossenen körperlichen Gesamtheit bewusst zu werden.»10
Diese Ausführungen weisen darauf hin, dass der Erfahrungsbereich des Lebenssinns einen Teil desjenigen ausmacht, was wir als unser Befinden bezeichnen. Hinzu kommt hier, dass die durch den Lebenssinn erfahrenen Qualitäten – wie bei allen leibbezogenen Sinnen auch – von Steiner nicht etwa als subjektive Erlebnisse, sondern als objektive Erfahrungen begriffen werden. So führt Steiner in einem anderen Zusammenhang aus: «Nehmen Sie den Menschen in Bezug auf das, was durch diese letzten vier Sinne (Gleichgewichts-, Bewegungs-, Lebens-und Tastsinn; d. Verf.) wahrgenommen wird; es sind, trotzdem wir die Dinge wahrnehmen – unsere eigene Bewegung, unser eigenes Gleichgewicht –, es sind, trotzdem wir das, was wir wahrnehmen, auf entschieden subjektive Weise nach innen hin wahrnehmen, dennoch aber Vorgänge, die ganz objektiv sind. Das ist das Interessante an der Sache. Wir nehmen diese Dinge nach innen hin wahr, aber was wir da wahrnehmen, sind ganz objektive Dinge, denn es ist im Grunde genommen physikalisch gleichgültig, ob, sagen wir, ein Holzklotz sich bewegt oder ein Mensch, ob ein Holzklotz im Gleichgewicht ist oder ein Mensch. Für die äußere physische Welt in ihrer Bewegung ist der sich bewegende Mensch ganz genau ebenso zu betrachten wie ein Holzklotz; ebenso mit Bezug auf das Gleichgewicht. Und wenn Sie den Lebenssinn nehmen, so ist es so, dass das, was unser Lebenssinn übermittelt, ganz objektive Vorgänge sind. Stellen Sie sich vor einen Vorgang in einer Retorte: er verläuft nach gewissen Gesetzen, kann objektiv beschrieben werden. Das, was der Lebenssinn wahrnimmt, ist ein solcher Vorgang, der nach innen gelegen ist. Ist er in Ordnung, dieser Vorgang, ganz als objektiver Vorgang, so übermittelt Ihnen dieses der Lebenssinn, oder ist er nicht in Ordnung, so überliefert Ihnen der Lebenssinn auch das. Wenn auch der Vorgang in Ihrer Haut eingeschlossen ist, der Lebenssinn übermittelt es.»11
Dieser Aspekt findet sich neuerdings auch durch empirische Untersuchungen bestätigt. Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil handelt es sich bei vielen Formen des Sich-krank-Fühlens keineswegs nur um subjektive Erlebnisweisen, denen in der Patient-Arzt-Beziehung ein Erkenntniswert nicht zugebilligt werden kann. Sie gehören vielmehr zu der auf den eigenen Leib bezogenen Sinnesmodalität, die auch als Coenästhesie12, als Allästhesie13 oder als Lebenssinn14 bezeichnet werden.
Subsumierend finden sich in diesem Modalbereich sogenannte Komfort- und Diskomfortempfindungen, die jeweils auf eine aktuelle, konkrete und objektivierbare eigenleibliche physiologische Situation hinweisen. So ist von Cabanac, Beste, Hensel, Hildebrandt und anderen nachgewiesen worden,15 dass die Komfort- bzw. Behagensempfindungen bei Wärmeapplikation auf die Hand von der integralen Hauttemperatur, also vom Gesamtwärmezustand abhängen. Bei relativ erhöhter Körperwärme wird eine kühlere Temperatur an der Hand (unter 30°C) als angenehm, eine höhere (über 37°C) dagegen als unangenehm empfunden. Umgekehrt gilt für die Komfortempfindungen bei niedriger Körpertemperatur, dass Erwärmung der Hand als angenehm, Kühlung aber als unangenehm erlebt wird. Die Korrelation der Behagensempfindung an die gemessene Temperatur ist dabei so eng, dass für eine willkürliche Deutung des Behagens kein Spielraum bleibt. «Die Lebensempfindungen sind vielmehr ein exakter Gradmesser für den ausgeglichenen integralen Wärmezustand.»16
Entsprechende Korrelationen zwischen den Empfindungen «angenehm» und «unangenehm» im Hinblick auf den Süßgeschmack in Abhängigkeit von der Höhe des Blutzuckers sind gleichermaßen nachgewiesen worden.17
Im Gegensatz zu den landläufigen Vorstellungen von subjektiven Wärmeerlebnissen, die einer res cogitans zugerechnet werden, und einer vermeintlich objektiven, einer res extensa zugerechneten Körpertemperatur, handelt es sich hier um die zwei Seiten ein und derselben Münze!18
Auch wenn im Hinblick auf den hier behandelten Modalbezirk der Coenästhesie bzw. des Lebenssinns ein Mangel an phänomenologischer bzw. empirisch-experimenteller Beforschung besteht, so muss in diesem Zusammenhang doch darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um einen Modalbereich handelt, der für die Medizin und die Medizinanthropologie von zentraler Bedeutung ist. Denn was zu ihm gehört, ist eben nicht nur die Schmerzempfindung als Hinweis auf eine aktuelle Schädigung bzw. ein krankhaftes Geschehen. Zu ihm gehören neben Schmerz und Lust, Hunger und Sättigung, Durst und Labung, Ermattung und Erquickung, Ermüdung und Erfrischung u.a.m. alle lokalen und nicht lokalen Missempfindungen bei krankhaften Organ- und Allgemeinerkrankungen. Ohne ihn, diesen Sinn, wäre eine lebenserhaltende autonome Lebenspraxis gar nicht denkbar. Ohne Dursterleben als Hinweis auf einen aktuellen Flüssigkeitsmangel bzw. eine drohende Elektrolytverschiebung, ohne Hunger als ein innerleiblich empfundenes Signal eines anstehenden Nahrungsmangels und ohne das Erleben der Müdigkeit bzw. der Ermattung als innerleiblichem Hinweis auf das Erfordernis von Schlaf und Erholung würde bereits nach wenigen Tagen der Tod eintreten.
Was uns die Gesamtheit der auf den eigenen Leib bezogenen Sinne an Wahrnehmung vermittelt, ist nicht etwas nur Subjektives, es ist viel mehr der «Innenaspekt» erlebter Leiblichkeit. Wir sind in der ärztlichen Praxis oft nicht in der Lage, die Phänomene des Befindens bzw. Missbefindens als feine Indikatoren für im Entstehen begriffene Krankheiten diagnostisch und therapeutisch verwerten zu können. So ist es eine geläufige Erfahrung, dass der befundmäßig objektivierbaren Parkinson’schen Krankheit über Jahre hinweg «innere» Erlebnisse vorausgehen können in dem Sinne, dass charakteristische eigenleibliche Wahrnehmungen, die in der Regel mit «objektiv» greifbaren Symptomen dieser Erkrankung verbunden sind, bereits bei (noch) völlig «unauffälligem» neurologischen Befund vorhanden sein können, bis der pathische Aspekt «inneren Vibrierens» sich schließlich um den des äußeren Tremorphänomens erweitert.19
Was den Eigenbewegungssinn betrifft, so ist dieser der konventionellen Physiologie bekannt und wird dort als Kinästhesie bezeichnet. Dieser Sinn wird in der Physiologie auch als Propriozeption bezeichnet, also als eine Modalität, die das Körperselbst bzw. die eigenleibliche Selbstwahrnehmung vermittelt. Folgt man aber Rudolf Steiner und Karl König, so ist es das Gesamt der auf den eigenen Leib bezogenen Sinne, also Lebenssinn, Eigenbewegungssinn und Gleichgewichtssinn, mit deren Hilfe wir uns als leibliches Wesen selbst wahrnehmen.
Auch der Gleichgewichtssinn erweist sich als ein zwar auf die eigene Leiblichkeit bezogener, aber dennoch objektiver Sinn, in dem durch ihn – vor aller Urteilsbildung, als sinnenfällige Gegebenheit – die leibliche Orientierung in den drei Raumesrichtungen, nämlich oben – unten, vorne – hinten sowie rechts – links bewusst werden sowie die entsprechenden Abweichungen des eigenen Leibes von den vorgenannten Qualitäten, die sich bei einer qualitativen Raumauffassung auch als objektive Eigenschaften des Raumes erweisen.
Was den Tastsinn betrifft, so wird von Steiner bei der Erstvorstellung seiner Konzeption der menschlichen Sinne 1909 noch darauf verwiesen, dass diese «gewöhnlich zusammengeworfen» wird «mit dem Wärmesinn»: «Zunächst hat der Tastsinn freilich nur als Wärmesinn Bedeutung. Als solcher Sinn ist sozusagen im Groben zu bezeichnen die ganze Haut. Diese ist auch in gewisser Weise für den Tastsinn da. Doch ist, richtig betrachtet, nicht nur das ein Tasten, was wir tun, wenn wir einen Gegenstand anrühren, seine Oberfläche abfühlen; Tasten ist es auch, wenn wir mit den Augen etwas suchen. Auch Geruchssinn und Geschmackssinn können tasten. Wenn wir schnüffeln, so tasten wir mit dem Geruchssinn. Bis herauf zum Wärmesinn ist das Tasten eine gemeinschaftliche Eigenschaft der Sinne vier bis sieben. Von diesen Sinnen können wir also sprechen als von Sinnen des Tastens. […] Nur unsere grobklotzige Betrachtungsweise der Physiologie kann einem Sinn etwas zuschreiben, was einer ganzen Reihe von Sinnen zukommt, dem Geruchssinn, Geschmackssinn, Gesichtssinn und Wärmesinn. Beim Gehörsinn hört die Möglichkeit auf, ihn als Tastsinn zu bezeichnen; noch weniger ist das beim Sprachsinn und wiederum weniger beim Begriffssinn möglich. Während wir beim Tastsinn etwas haben, was an der Oberfläche bleibt, was nicht in die Dinge hineindringen kann, so dringen wir beim Wärmesinn zunächst in die Dinge ein und dann immer tiefer und tiefer. Diese oberen Sinne liefern uns das Verstehen und Begreifen der Dinge in ihrem Innern, und sie werden daher als Sinne des Begreifens bezeichnet.»20
Was die umweltbezogenen Sinne betrifft, nämlich Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn und Wärmesinn, so sind diese aus der konventionellen Physiologie bekannt, erhalten zwar im Rahmen einer anthroposophischen Sinneslehre eine spirituell erweiterte Deutung, werden aber in phänomenologischer Hinsicht nicht abweichend behandelt, weshalb sich eine detailhafte Darstellung hier erübrigt.