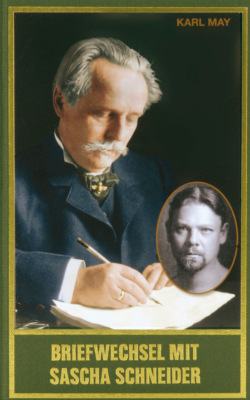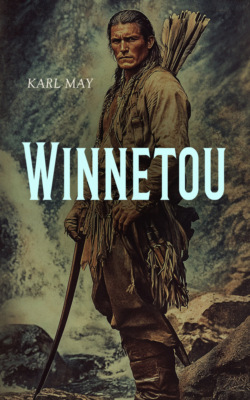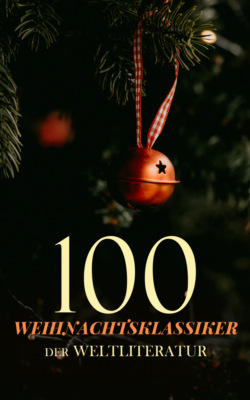Kitabı oku: «Waldröschen VII. Die Abenteuer des schwarzen Gerard 2», sayfa 18
30. Kapitel
Der Lord hatte den Roten seine Boote zur Verfügung gestellt, um nach dem linken Ufer überzusetzen. Sie benutzten sie aber in einer anderen Weise. Eine Anzahl von ihnen ritt nämlich, trotz der Breite des Stromes, auf schwimmenden Pferden über denselben hinüber, um am jenseitigen Ufer forschend aufwärts zu reiten, während andere diesseits dasselbe taten. Eine dritte Abteilung hatte sich in die Boote verteilt und suchte, den Fluß hinabfahrend, die beiden Ufer desselben von der Wasserseite ab. Das Resultat dieser sorgfältigen Untersuchung mußte abgewartet werden.
Unterdessen hatte der Lord sich mit Juarez nach der Kajüte begeben, während Sternau mit Mariano und Amy auf dem Deck zurückgeblieben waren, um die beiden Erwähnten in ihren wichtigen, diplomatischen Verhandlungen nicht zu stören; denn Lindsay brachte nicht bloß Unterstützung an Geld und Waffen, sondern er hatte mit dem Präsidenten auch wichtige Abmachungen vorzunehmen, die sich auf Englands Verhalten zu dem ferneren Verweilen der Franzosen in dem Staat Mexiko bezogen.
Amy erzählte den beiden Männern von den Lieben in der Heimat. Es gab da so vieles zu fragen, zu berichten und zu erklären, daß die Zeit verschwand, ohne daß es ihnen beikam, einen Maßstab an die Minuten zu legen.
Da erschaute ein heller Ruf vom Ufer herüber.
»Ein Indianer«, sagte Mariano. »Was mag er wollen?«
Sternau trat an Bord und fragte hinüber.
»Mein weißer Bruder mag kommen«, antwortete der Mann. – »Warum? Was gibt es?« – »Eine Spur.« – »Von wem?« – »Weiß nicht. Selbst sehen. Bin Bote von den anderen.«
Da die Boote alle fort waren, machte Sternau die kleine, einruderige Gig, die für den persönlichen Gebrauch des Lords bestimmt war, los und ruderte sich an das Ufer, wo der Mann auf ihn wartete.
»Mitkommen«, sagte dieser einfach, indem er sich wieder stromabwärts wandte, von woher er gekommen war.
Sternaus Pferd stand noch da, wo er von demselben abgestiegen war. Er band es los, setzte sich auf und folgte dem Wilden im Galopp. Der Ritt war kein kurzer. Er währte lange, und der Indianer hielt erst an, als sie wohl eine Wegstunde zurückgelegt hatten. Dort hielten sämtliche Reiter, die am rechten Ufer gesucht hatten, und auch die Boote lagen am Land. Man sah es jedoch der Aufstellung dieser Leute an, daß sie einen Platz zwischen sich hatten, von dem sie ihre Pferde zurückhielten.
Dort saß ein Indianer an der Erde. Die Rabenfeder, die er im Schopf trug, deutete an, daß er unter den übrigen eine Art von Rang einnahm. Er mochte die Suche geleitet haben, und er erhob sich, als er Sternau sah.
»Der Fürst des Felsens mag zu mir kommen«, sagte er.
Sternau stieg ab, übergab die Zügel seines Pferdes einem anderen und trat zu dem Mann, der gesprochen hatte. Dieser deutete zur Erde.
»Mein weißer Bruder sehe.«
Sternau blickte zu Boden, wurde aufmerksam und bückte sich hinab.
»Ah, die Spur eines Reiters«, sagte er. – »Bemerkt mein Bruder die Anzahl seiner Pferde?« – »Ja. Eins hat er geritten, und das andere geführt. Er hatte zwei Tiere bei sich gehabt.« – »Mein Bruder gehe weiter.«
Der Indianer deutet dabei mit der Hand nach dem Ufer hin. Sternau folgte dieser Richtung, indem er dabei die Spur im Auge behielt.
»Er ist in den Fluß geritten«, sagte er, »vorher aber abgestiegen, um Schilf abzuschneiden. Er hat also über den Fluß gewollt und einige Schilfbündel gemacht, die seinem Pferd die Last erleichtern sollten, indem sie als Schwimmgürtel dienten.« – »Mein Bruder hat das Richtige geraten. Wer mag der Mann gewesen sein?« – »Vielleicht der Jäger, der uns heute begegnete. Seine Richtung ging ungefähr auf diese Stelle zu. Man müßte nach Anzeichen forschen.« – »Die roten Männer haben dies bereits getan.« – »Haben sie etwas gefunden?« – »Ja. Der Fürst des Felsens mag hier herübertreten und die Fährte betrachten.«
Der Indianer zeigte einen Ort, der von Pferdehufen ziemlich zerstampft war. Hier klug zu werden, war jedenfalls ein Meisterstück der Spürkunst, dennoch aber sagte Sternau bereits nach einigen Sekunden:
»Hier haben die Pferde geweidet, während er das Schilf abschnitt; sie sind dabei in einen kleinen Streit geraten. Es steht anzunehmen, daß sie sich gebissen haben. Vielleicht sind dabei Haare verlorengegangen. Man müßte suchen, ob welche zu finden sind.« – »Die roten Männer haben bereits gesucht. Mein Bruder betrachte dieses Haar aus dem Schwanz eines Pferdes.«
Der Indianer reichte Sternau ein Pferdehaar hin, das allerdings so lang war, daß es nur vom Schwanz stammen konnte.
»Ein schwarzes Pferd«, sagte Sternau. – »Und dieses Büschel?«
Der Rote zeigte in der anderen Hand eine Anzahl zusammengefilzter Haare, die von keiner großen Länge waren. Sternau betrachtete sie genau und erwiderte:
»Rotbraun! Dieses Büschel besteht aus unteren Kammhaaren. Das eine Pferd ist also schwarz und das andere rotbraun gewesen. Der Jäger, der uns heute begegnete, ist‘s, kein anderer. Er hatte zwei solche Pferde.« – »Uff! Die roten Männer sind noch sorgfältiger gewesen.«
Bei diesen Worten zeigte der Indianer nach dem Wald zurück, aus dem soeben zwei Apachen auf schaumbedeckten Pferden hervorkamen.
»Wo sind sie gewesen?« fragte Sternau. – »Mein Bruder spreche mit ihnen selbst.«
Als die Apachen herbeigekommen waren, fragte Sternau sie.
»Meine Brüder haben wohl die Fährte rückwärts verfolgt?« – »Der Fürst des Felsens hat es erraten«, antwortete der eine. – »Wohin führt die Fährte?« – »Genau in der Richtung der Ortes, wo wir dem Jäger begegneten.« – »So ist er es also gewesen?« – »Er war es.«
Sternau konnte sich denken, daß man ihm noch nicht alles gesagt hatte.
»Aber warum widmen meine roten Brüder diesem Jäger eine solche Aufmerksamkeit?« fragte er den Anführer. »Haben sie noch mehr entdeckt?« – »Ja. Der Fürst des Felsens denkt, der Jäger ist über den Fluß geritten?« – »Allem Anschein nach hat er es getan.« – »Die Krieger der Apachen haben es auch gedacht, aber als sie weiter abwärts ritten, haben sie seine Fährte wiedergefunden.« – »Er ist also hier in den Fluß geritten und hat ihn weiter unten wieder verlassen?« – »Ja.« – »Das ist schwer zu begreifen. Um die Tiere zu tränken, braucht man nicht in das Wasser zu reiten, und um den Fluß so bald wieder zu verlassen, wären doch die Schilfgürtel nicht notwendig gewesen. Es bleibt also nur die Ansicht, daß er übersetzen wollte, aber durch etwas abgehalten wurde.« – »Der Fürst des Felsens hat sehr scharfe Gedanken.« – »Ah! Meine roten Brüder haben etwas gefunden?« – »Ja. Mein Bruder folge mir.«
Der Indianer drängte sich in das Schilf hinein, und Sternau folgte ihm. Es war hier ein schweres Fortkommen, aber die Mühe und Anstrengung wurde auch sehr bald belohnt. Denn als sie ungefähr hundert Schritt getan hatten und der Indianer am Rand des Wassers stehenblieb, erblickte Sternau ein Floß, das aus Schilfbündeln und Baumzweigen zusammengesetzt war. Es war von einer solchen Länge und Breite, daß sich ein Mann damit recht gut über Wasser halten konnte, so lange er sich in der Balance erhielt.
»Sieht mein weißer Bruder dieses Floß?« fragte der Indianer. – »Ja. Hat mein roter Bruder ein Zeichen gefunden, woraus sich schließen läßt, wer es benutzt hat?« – »Ein sehr deutliches Zeichen. Hier!«
Der Indianer griff abermals in den Gürtel und brachte ein buntes Taschentuch hervor, das zusammengelegt und an den beiden Zipfeln durch einen Knoten verbunden war. Es hatte ganz den Anschein, als sei es von einem Menschen benutzt worden, der unter Kopf- oder Zahnschmerzen litt. Aber als Sternau das Tuch genauer untersucht hatte, sagte er:
»Hier klebt Blut im Innern. Das Tuch ist um verwundete Augen getragen worden. Wo fand man es?« – »Es hing an einem Zweig des Floßes.« – »Welche Unvorsichtigkeit von diesem Cortejo! Denn er ist es gewesen.«
Dabei betrachtete er den Boden. Er fand mehrere Fährten.
»Haben die Söhne der Apachen weiter gesucht?« fragte er.
Der Indianer nickte.
»Was haben sie gefunden?« – »Mein Bruder folge mir!«
Es war hier durch das dichte Schilf eine ziemlich gangbare Bahn gebrochen. Die beiden folgten ihr und gelangten bald an eine Stelle, an der vom Wasser herauf eine doppelte Pferdespur kam.
»Ah, da ist der Jäger wieder aus dem Wasser gekommen«, sagte Sternau. – »Und dorthin ist er geritten«, fügte der Indianer hinzu, nach rechts deutend.
Sie folgten dieser neuen Fährte bis an eine kleine Lichtung im Schilf, deren Boden ganz und gar zerstampft war.
»Haben meine Brüder hier etwas gefunden?« fragte Sternau. – »Hier hat Cortejo gelegen«, antwortete der Apache, »und da ist der weiße Jäger zu ihm gekommen.« – »Wohin führt nun die Spur?« – »Sie führt wieder in den Wald hinein.« – »Ist sie verfolgt worden?« – »Nein.« – »Warum nicht?« – »Der Fürst des Felsens sollte erst gefragt werden.« – »Gut. Mein Bruder denkt, daß der Jäger Cortejo mitgenommen hat?« – »Ja. Er hat ihn auf das andere Pferd gesetzt.« – »So mag mein Bruder mit noch einigen Männern aufbrechen und der Spur folgen, um zu sehen, ob dieselbe nach der Gegend von Candela, Naria und Saltillo führt.« – »Dazu wird man mehrere Tage brauchen.« – »Allerdings, wenn man bis Saltillo reiten wollte. Es wird aber genügen, der Spur bis morgen zu folgen, wenn die Sonne am höchsten steht. Dann weiß man bereits, in welcher Richtung sie weiterführt. Die Söhne der Apachen können mir dann Nachricht bringen?« – »Wohin?« – »Nach Coahuila.« – »Ugh!«
Der Indianer sagte dieses eine Wort und begab sich zu den Seinigen zurück. Ein Wink von ihm genügte, so saßen fünf seiner Gefährten mit ihm auf und folgten ihm, als er auf der Fährte des Jägers davonritt.
Sternau gab jetzt den Befehl, die Nachforschungen einzustellen und die Boote wieder an die Schiffe zu bringen, bestieg sein Pferd wieder und ritt zurück. Als er auf der Gig wieder am Dampfer anlangte, hatte man ihn dort bereits mit großer Ungeduld erwartet.
»Gefunden?« rief ihm Juarez schon von weitem entgegen. – »Ja«, antwortete er. – »Ihn selbst?« – »Nein, sondern leider nur seine Spur.« – »O weh! So lebt er noch?« – »Jedenfalls. Hier dieses Tuch hat er um die Augen gebunden gehabt.«
Bei diesen Worten schwang Sternau sich an Bord und zeigte das Tuch.
»Was wissen Sie nun von ihm?« fragte der Lord. – »Erstens, daß er sicher an den Augen verletzt ist. Zweitens, daß er auf einem kleinen Floß stromab geschwommen ist.« – »So mag das richtig sein, was mein Steuermann vermutete, nämlich, daß seine eigenen Leute sich seiner entledigt haben.« – »Dann wird er einige sehr böse Stunden erlebt haben. Es ist kein Spaß, blind auf einem Floß schwimmen zu müssen.« – »Sie nehmen also an, daß er wirklich erblindet ist?« – Jetzt wenigstens, ja. Hätte er nur ganz wenig zu sehen vermocht, so wäre es ihm gar nicht eingefallen, das Tuch zurückzulassen. Es ist ihm auf irgendeine Weise vom Kopf geglitten, und er konnte es nicht finden.« – »Aber was dann?« – »Sein kleines, aus Schilf erbautes Floß wurde an das Ufer getrieben. Er fühlte Boden und schlich an das Land, wo er im Schilf gefunden wurde.« – »Von wem?« – »Von dem Jäger, der uns heute begegnete, Señor Juarez.« – »Ah, von diesem! Da sind unsere Apachen leider zu spät gekommen.« – »Ja, leider; denn dieser Jäger ist mit ihm, wie es scheint, in südlicher Richtung davongeritten.« – »Das ist ja immer noch vorteilhaft. Er ist ja im Land geblieben. Wäre er aber an das andere Ufer, also nach Texas gegangen, so hätten wir die Macht über ihn verloren. Haben Sie eine Ahnung, wohin er gegangen ist?« – »Ja«, antwortete Sternau. »Nach der Hacienda del Erina.« – »Warum dorthin?« – »Weil seine Tochter dort ist. Er befindet sich als Erblindeter in einem sehr hilflosen Zustand und muß nun vor allen Dingen darauf bedacht sein, zu Leuten zu gelangen, denen er Vertrauen schenken kann. Da steht seine Tochter natürlich obenan.« – »Sie glauben, daß dieser Jäger ihn nach der Hazienda bringt?« – »Ja.« – »Was sollte derselbe für ein Interesse dabei haben?« – »Cortejo wird ihm eine hohe Belohnung versprochen haben.« – »Das ist wahrscheinlich. Möglich ist es aber auch, daß die beiden sich bereits kennen.«
Da machte Sternau eine Gebärde der Überraschung.
»Diese Ansicht bringt mich auf einen plötzlichen Gedanken«, sagte er. »Können Sie sich besinnen, Señor Juarez, welche Antwort der Jäger gab, als wir ihn nach seinem Namen fragten?« – »Ja. Er sagte, er heiße Grandeprise.« – »Und ein Grandeprise ist der Verbündete von Cortejo.« – »Sie meinen den schwarzen Kapitän?« fragte der Lord. – »Ja. Er heißt ja wohl ursprünglich Grandeprise. Sein Piratenschiff war der ›Lion‹. Jetzt nennt er sich Henrico Landola.« – »Sie meinen, daß er mit diesem Jäger verwandt sei?« – »Es ist dies immerhin möglich. Der Name Grandeprise kommt nicht so häufig vor.« – »So müßte man sich beeilen, die beiden in die Hände zu bekommen. Was für Maßregeln haben Sie getroffen?« – »Ich habe einige Apachen auf ihre Spur geschickt. Diese Leute sollen sich überzeugen, ob diese Fährte nach der Richtung von Saltillo führt, und mir dann Nachricht nach Coahuila bringen.« – »Wäre es nicht besser gewesen, anstatt dieser bloßen Kundschafter den beiden Kerlen eine Schar Verfolger nachzusenden?« – »Warum halten Sie dies für besser?« – »Weil wir dann Cortejo schnell in unsere Hände bekommen hätten.« – »Sie irren sich. Zunächst müßte die Verfolgung mit Anbruch der Nacht eingestellt werden. Grandeprise aber wird die Nacht benutzen, um einen möglichst großen Vorsprung zu bekommen.« – »Waren seine Pferde so gut?« – »Er reitet die ganze Nacht hindurch und nimmt sich von der ersten besten Herde neue Pferde. Die Verfolger würden ihn nicht erreichen.« – »Aber wollen wir Cortejo entkommen lassen?« – »Nein. Allerdings ist es nur auf der Hazienda möglich, ihn festzuhalten. Das können wir nun freilich ohne die Hilfe Señors Juarez nicht.« – »Was wünschen Sie?« fragte der Präsident. – »Aus dem aufgefangenen Brief von Cortejos Tochter geht hervor, daß sich in der Hazienda eine große Zahl von Cortejos Anhängern festgesetzt hat. Wir brauchten also Mannschaften, Señor.« – »Wieviel?« – »Wer weiß das. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Besatzung der Hazienda ist.« – »So lassen Sie uns sehen, wie viele Leute ich entbehren kann. Ich werde mein Möglichstes tun. Die Hazienda ist ein wichtiger Punkt, da sie in der Nähe des großen Verkehrsweges zwischen Süden und Norden liegt. Sie und Cortejo in meine Gewalt zu bringen, bin ich also zu jeder Anstrengung bereit. Ich denke, es wird gut sein, möglichst bald hier aufzubrechen, damit wir schnell wieder nach Coahuila kommen.« – »Wir müssen leider die Boote erwarten.« – »Wann können dieselben zurück sein?« – »In frühestens einer Stunde.« – »Wir holen diese Zeitversäumnis schnell nach, indem wir die Dampfer schneller arbeiten lassen.«
Sternau hatte recht gehabt. Die Apachen brachten die Boote erst nach Ablauf einer Stunde zurück. Die beiden Dampfer waren geheizt und zum Aufbruch bereit. Sie setzten sich in Bewegung, nachdem die Roten die Weisung erhalten hatten, auf dem heute zurückgelegten Weg wieder in das Lager zu gehen.
Während der beginnenden Fahrt hatte Juarez Zeit, sich mit dem Lord genau zu besprechen. Ihre gegenseitigen Abmachungen wurden zu Papier gebracht und von beiden unterzeichnet. Napoleon ahnte nicht, daß heute mitten in den Wildnissen des Rio Grande del Norte ein Vertrag geschlossen wurde, der ihn in der Folge zwang, Mexiko Juarez zu überlassen und seine Truppen aus diesem Land zu entfernen.
Mariano und Amy genossen unterdessen alle Seligkeiten des Wiedersehens und gaben einander das Versprechen, sich nie wieder zu trennen.
Sternau stimmte ihnen bei.
»Noch sind wir nicht in dem Hafen der Ruhe angelangt«, sagte er. »Wir wissen nicht, was uns noch widerfahren kann. Darum ist es geraten, eng zusammenzuhalten, damit wir uns nicht wieder verlieren.« – »Juarez wird uns beschützen«, sagte Amy. – »Er bedarf selbst noch der Unterstützung«, antwortete Sternau. – »Ich denke, seine Macht steigt von Tag zu Tag?« – »Das tut sie auch, aber jetzt ist sie noch so gering, daß ich mir vorhin gar nicht getraut habe, eine Bitte auszusprechen, die doch sehr nötig war.« – »Welche?« – »Ich hätte gewünscht, die Hazienda eher zu erreichen als Cortejo.« – »Ah! Das wäre allerdings sehr gut«, meinte Mariano. – »Da man aber die Stärke der dortigen Besatzung nicht kennt, so wären immerhin tausend Mann zu diesem Unternehmen erforderlich; aber eine solche Zahl kann Juarez noch nicht entbehren.« – »So nehmen wir weniger!« rief Mariano. – »Du bist mutig, mein Freund«, entgegnete Sternau. – »Oh, warum sollte man die Hazienda nicht mit weniger Leuten nehmen können? Nicht die Zahl, sondern die Tapferkeit tut es.« – »Du hast recht. Man könnte die Hazienda auch durch List nehmen; aber die Strecke zwischen ihr und Coahuila befindet sich noch in den Händen der Franzosen, die vorher zu verdrängen sind.« – »So wird Cortejo uns entkommen.« – »Ich hoffe das Gegenteil.« – »Er wird die Hazienda viel früher als wir erreichen.« – »Du vergißt, daß er bedeutende Umwege machen muß.« – »Weshalb?« – »Weil er sich von den Franzosen ebensowenig als vor uns sehen lassen darf.« – »Das ist wahr. Wenn Juarez sich beeilt und wir einen Parforceritt unternehmen, so kommen wir Cortejo vielleicht doch noch zuvor.« – »Ich hoffe. Es ist zu berücksichtigen, daß er blind ist, das heißt hilflos, obgleich er einen Begleiter hat. Die Augen schmerzen ihm jedenfalls. Er hat sicher Wundfieber. Das vermindert die Schnelligkeit seines Rittes außerordentlich. Ich möchte nicht an seiner Stelle sein.«
Sternaus Vermutung war eine ganz richtige.
31. Kapitel
Wie wir bereits gesehen haben, hatten die Mexikaner, als sie am Abend die Schiffe sozusagen belagerten, sich vorgenommen, sich ihres Anführers zu entledigen. Dies sollte mit Hilfe eines Floßes geschehen, und Cortejo kam ihnen, ohne es zu ahnen, darin entgegen, indem er sich vornahm, sich bei dem Angriff mit zu beteiligen und sich auf einem Floß in die Nähe des Schiffes bringen lassen wollte.
Die Mexikaner hieben mit ihren Macheten Schilf und Zweige ab, um sich Bündel zu machen, die das Schwimmen erleichtern sollten; für Cortejo aber wurde ein kleines Floß gebaut.
»Wie groß ist es?« fragte er, als man ihm meldete, daß es fertig sei. – »Acht Fuß lang und sechs Fuß breit.« – »Das ist zu klein«, sagte er. – »Oh, Señor, das ist groß genug«, sagte der, den man hinter Cortejos Rücken zum Anführer gewählt hatte. – »Das ist kaum für einen Mann hinreichend.« – »Es ist ja auch nur für einen Mann.« – »Und die, welche mich rudern sollen, wo bleiben die?« – »Die schwimmen nebenher und geben dadurch dem Floß die geeignete Richtung. Ein größeres würde zu auffällig sein und von den Schiffen zu leicht bemerkt werden. Sie kämen dadurch in eine Gefahr, der wir Sie doch unmöglich aussetzen dürfen, Señor.«
Das klang so fürsorglich und leuchtete Cortejo ein.
»Gut denn«, sagte er, »so mag es bei dem Flößchen bleiben. Es gilt nur noch unsere Arrangements zu treffen. Das Nötige wißt ihr bereits. Ich habe euch nur zu wiederholen, daß ihr den Inhalt der Dampfer und Kähne nicht anzurühren habt.« – »Warum nicht?« fragte der Sprecher. – »Die Fracht gehört mir.« – »Könnten nicht auch wir einen Teil davon beanspruchen, Señor?« – »Nein. Ihr wißt ja, wozu alles verwendet werden soll.« – »Aber bedenken Sie, Señor, daß das alles doch nicht Ihr Eigentum ist. Sie nehmen es weg, und wir helfen Ihnen dabei. Das ist ganz dasselbe, als wenn zum Beispiel ein Kriegsschiff ein feindliches Schiff wegnimmt. Da setzt es auch Prisengelder.« – »Die werdet ihr auch erhalten.« – »Wie hoch? Wieviel?« – »Das kommt auf den Wert der Prise an. Ich werde den zehnten Teil des Wertes unter euch verteilen lassen.« – »Ist das nicht zu wenig, Señor?« – »Schweigt! Es befinden sich Millionen auf den Schiffen, das gibt also von einer jeden Million hunderttausend für euch. Nun rechnet aus, welche Summe da auf den Kopf kommt.« – »Ah, so haben wir uns diese Sache noch nicht betrachtet. Jetzt sieht sie sich bedeutend anders an, und ich erkläre, daß wir einverstanden sind.« – »Das denke ich auch.«
Hätte Cortejo die Mienen der Mexikaner sehen können und die Blicke, die sie sich einander zuwarfen, so wäre er ganz anderer Meinung gewesen.
»Löscht das Feuer aus!« gebot er. »Es ist Zeit, zu beginnen.«
Diesem Befehl wurde sofort Folge geleistet.
Die Mexikaner waren vom Gelingen ihres Planes vollständig überzeugt; an ein Mißlingen dachten sie nicht. Sie zitterten vor Begierde, diese Schätze in ihre Hände zu bekommen.
Die Schußwaffen, die im Wasser gelitten hatten, wurden abgelegt, und zwar so, daß jeder die seinigen leicht wiederfinden konnte. Dann griffen sie nach ihren Bündeln und gingen ins Wasser, in solchen Abteilungen, wie es ihnen anbefohlen worden war. Cortejo aber wurde auf das Floß geleitet, das von zwei guten Schwimmern dirigiert werden sollte. – »Vorwärts!« befahl er.
Infolge dieses halblauten Kommandowortes begann die Schwimmpartie.
Mit Hilfe der Schilfbündel wurde den Leuten das Schwimmen leicht, und sie hatten wohl die Hälfte der Entfernung zurückgelegt, als die Raketen vom ersten Dampfer emporstiegen. Sie erschraken, denn die ganze Szene war fast taghell erleuchtet, und sie sahen, daß die Bemannung auf ihrem Posten war.
»Feuer!« ertönte da des Lords Stimme.
Die Geschütze krachten, und einen Augenblick lang schien das Wasser des Flusses sich in Wallung zu befinden. Es spritzte unter der Gewalt der einschlagenden Kartätschen hoch auf. Unterdrückte Schreie und Flüche wurden ringsum doch noch hörbar, und die Köpfe vieler der Schwimmenden verschwanden von der Oberfläche des Flusses.
Eine Kugel hatte auch einen der beiden getroffen, die das Floß Cortejos lenkten.
»Santa Madonna, hilf!« rief er. – »Was ist‘s?« fragte Cortejo. – »Ich bin in den Arm getroffen. Ich kann nicht mehr!«
Damit ließ der Verwundete das Floß fahren, und als in diesem Augenblick die Raketen abermals stiegen, sah sein Gefährte ihn untersinken.
»Halte dich mit dem unverletzten Arm fest«, rief Cortejo. – »Es ist bereits zu spät, Señor«, antwortete der andere. »Der arme Teufel ist bereits untergegangen. Er ist jedenfalls nicht in den Arm allein getroffen worden.« – »So bleibe du nur fest am Platz. Wie sieht es aus? Ich habe nichts gesehen.« – »Man hat vom Schiff Raketen steigen lassen.« – »Donnerwetter! Und mit Kanonen geschossen? Hat es getroffen?« – »Ja, Señor.« – »So mag man sich beeilen, an Bord zu kommen.« – »Oh, damit ist nichts! Sie fliehen alle bereits dem Ufer zu, nämlich alle, die noch übrig sind.« – »Hölle und Teufel! Alle? So ist der Angriff mißlungen?« – »Vollständig, Señor!« – »Oh, daß ich nicht sehen kann! Es würde ganz anders gegangen sein!« – »Es würde nicht anders sein. Das Augenlicht schützt nicht vor Kartätschen.« – »Rudere auch mich an das Ufer!« – »Fällt mir gar nicht ein«, antwortete der Mann, auf einmal in einen ganz anderen Ton übergehend. – »Wie? Was meinst du?« fragte Cortejo erstaunt – »Daß ich Sie nicht mehr rudere.« – »Ah! Warum?« – »Weil es mir verboten ist, Sie wieder an das Ufer zu bringen.«
Cortejo war starr. Es ging ihm plötzlich eine Ahnung auf, in welcher Gefahr er sich infolge seiner Blindheit befand. Es war dies eine Gefahr, an die er bisher noch gar nicht gedacht hatte.
»Wer hat es dir verboten?« fragte er atemlos. – »Die Kameraden«, antwortete der Mann, indem er sich eine andere, dem Ufer zustrebende Richtung gab. – »Also Empörung? Meuterei?« – »Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich könnte Sie schon verlassen haben; aber so lange mir das Floß noch Dienste leistet, will ich Ihnen Rede stehen.« – »Donnerwetter! Warum will man mir nicht mehr gehorchen?« – »Weil man Sie nicht mehr gebrauchen kann.« – »Weil ich blind bin? Ich habe euch doch zu der Beute verholfen.« – »Wir haben sie ja noch gar nicht.« – »Wir werden sie erhalten. Wir werden den Angriff wiederholen.« – »Das geht ohne Sie besser. Sie hindern uns nur, Señor.« – »Denke an die Prisengelder!« – »Die mögen wir nicht. Das Ganze ist uns lieber.« – »Ah! Ist es darauf abgesehen? Mann, sage mir die Wahrheit. Soll ich wirklich verlassen werden?« – »Ja.«
Eine entsetzliche Angst begann sich Cortejos zu bemächtigen.
»Was will man mit mir tun?« fragte er bebend. – »Erst wollte man Sie töten …« – »Heilige Madonna! Das ist doch ganz unmöglich!« – »Dann aber hat man beschlossen, Sie auf diesem Floß dem Strom zu übergeben. Das Weitere wird sich von selbst finden.« – »Mensch, und das wolltest du tun?« – »Ja; ich muß.« – »Daran werde ich dich denn doch verhindern.«
Cortejo hatte sich auf das Floß hingestreckt. Sein Kopf befand sich ganz in der Nähe der Stelle, wo der Schwimmer das Floß gefaßt hatte.
»Wie wollten Sie dies anfangen?« fragte der Mann. – »In dieser Weise!« entgegnete Cortejo und griff, obgleich er nichts sehen konnte, zu, um die Hand des Mannes fest zu umfassen. – »Ah«, sagte dieser, »Sie wollen mich festhalten? Das bringen Sie nicht fertig.« – »Ich werde es darauf ankommen lassen.« – »Sie werden sehen, wie leicht es ist, sich eines Blinden zu erwehren.« – »Gott, ist so etwas möglich? Was habe ich euch getan?« – »Nichts, Señor.« – »So darfst du mich auch nicht verlassen.« – »Ich muß.« – »Ich gebe dir doppeltes Prisengeld.« – »Ich werde mehr bekommen. Wir teilen die Ladung unter uns.« – »Dreifaches Prisengeld.« – »Hilft nichts, Señor.« – »Fünffaches.« – »Ist noch zu wenig. Ich lasse mich überhaupt nicht kaufen. Ich darf Sie gar nicht wieder zurückbringen.« – »So rette mich wenigstens.« – »Auf welche Weise?« – »Bringe mich an das Ufer und besorge heimlich zwei Pferde. Wenn du mich glücklich nach der Hazienda zurückbringst, werde ich es dir lohnen.« – »Dabei verliere ich meinen Anteil an der Prise.« – »Ich ersetze ihn dir.« – »Das ist ungewiß, Señor, höchst ungewiß.« – »Ich gebe dir mein Ehrenwort und versichere es dir und beschwöre es bei allen Heiligen.« – »An Ihr Ehrenwort glaube ich nicht, und an die Heiligen glauben Sie nicht.« – »Halunke.« – »Sie schimpfen?«
Cortejo sah ein, daß es unmöglich sei, hier durch Grobheiten etwas auszurichten.
»Ich bitte dich, handle nicht so unmenschlich an mir!« bat er wiederum. – »Gibt es nicht Menschen, an denen Sie noch schlechter gehandelt haben?« – »Nein.« – »Sie lügen! Ich weiß, was man sich von Ihnen erzählt.« – »Es ist die Unwahrheit. Höre, wenn du mich nach der Hacienda del Erina bringst, sollst du Eigentümer der ganzen Hazienda sein!«– »Sie können sie nicht verschenken, sie gehört ja gar nicht Ihnen.« – »Ich bin jetzt der Besitzer.« – »Wie lange? Man wird Sie dort verlassen wie hier.« – »Ich gebe dir zwanzigtausend Pesetas.« – »Pah! Viel zu wenig!« – »Fünfzigtausend.« – »Noch zu wenig!« – »Hunderttausend!« – »Woher wollen Sie diese Summe nehmen?« – »Ich bin reich.« – »Sie sind arm. Sie sind geächtet und aus dem Land verwiesen. Wenn man Sie ergreift, so werden Sie einfach aufgehängt.« – »Ich habe mir große Summen weggesteckt!« – »Ehe wir dahin kommen, wo Sie dieses Geld haben, können wir beide ergriffen und getötet worden sein. Nein, Señor, ich tue nicht mit. Lebt wohl!« – »Bleibe! Ich biete dir noch mehr!« bat er angstvoll. – »Sie haben nichts zu bieten, denn Sie besitzen selbst nichts mehr!« – »Ich biete dir mehr, als du ahnst! Kennst du meine Tochter?« – »Señorita Josefa? Ja!« – »Bist du verheiratet?« – »Nein.« – »Nun, so biete ich sie dir zur Frau an!«
Da stieß der Mexikaner ein halblautes, heiseres Hohnlachen aus.
»Sind Sie verrückt, Señor Cortejo?« fragte er. – »Verrückt? Inwiefern?« – »Ein solches Anerbieten kann nur ein Verrückter machen!« – »Du gibst also zu, daß es Wahnsinn ist, einem Vaquero, der jetzt so ziemlich ein Räuber ist, die Tochter eines Hidalgo anzubieten?«
Hidalgo ist eigentlich ein Edelmann; so aber wird in Mexiko jeder genannt, der reich ist oder in einem ansehnlicheren Rang steht
»Hidalgo?« fragte der Mann. »Sie wollen doch nicht sagen, daß Sie ein Hidalgo sind? Sie sind immer nur das gewesen, was Sie von mir sagen: ein Räuber, ein Betrüger. Und Ihre Tochter? Die Vogelscheuche! Ich sage Ihnen: Wenn ich schon an der Leiter des Galgens stände und könnte mich dadurch retten, daß ich Ihre Tochter zur Frau nähme, ich würde mich lieber hängen lassen. Sie sind verrückt. Lassen Sie mich los!«
Sie waren jetzt mit dem Roß dem Ufer nahe gekommen.
»Nein, ich lasse dich nicht los!«
Mit diesen Worten klammerte Cortejo seine Finger mit doppelter Kraft um das Handgelenk des Mexikaners.
»Nun, so brauche ich Gewalt!« rief dieser.
Dabei zog er mit der anderen Hand seine Machete aus dem Gürtel und legte die Schneide des haarscharfen Messers auf die Hand Cortejos. Als dieser den Stahl fühlte, rief er erschreckt:
»Du willst mich verletzten?« – »Ich ersuche Sie, loszulassen, sonst haue ich Ihnen die Hand ab!«
Bei dieser Antwort zog Cortejo rasch seine Hand zurück.
»So!« sagte jetzt der andere. »Schwimmt wohin Ihr wollt!«
Dann gab er dem Floß einen kräftigen Stoß, so daß dasselbe wieder der Mitte des Stromes zutrieb, und schwamm an das Ufer.
Cortejo fühlte den Stoß.
»Bist du fort?« fragte er.
Keine Antwort ertönte.
»Antworte! Ich bitte dich um Gottes willen, antworte!«
Aber so sehr er auch lauschte, es ließ sich nichts hören.
»Allein! Allein! Blind und verlassen! Bei lebendigem Leibe dem sicheren Tode übergeben! Was tue ich? Wie rette ich mich?«
Cortejo besaß Tatkraft genug, um die Partie noch nicht aufzugeben.
»Ah!« sagte er. »Wer hindert mich, selbst an das Ufer zu rudern? Dann werde ich zu ihnen treten und ein strenges Gericht halten. Es wird noch viele unter ihnen geben, die zu mir halten. Vorwärts also!«
Er glitt vom Floß herab, hielt sich an demselben fest und arbeitete, wie er meinte, dem Ufer entgegen. Aber er konnte nicht sehen. Das Floß hatte sich gedreht und drehte sich noch immerfort; er merkte dies daran, daß er abwechselnd die Strömung mit sich und gegen sich hatte. Es war ihm unmöglich, die Richtung einzuhalten.
»Es geht nicht!« jammerte er, als er sich fast außer Atem gearbeitet hatte. »Ich bin verloren; es gibt keine Rettung für mich. Selbst wenn ich um Hilfe rufe, habe ich nichts zu hoffen. Dieser englische Lord wird mich hören und eins seiner Boote nach mir senden; ich falle dann in seine Hände. Nur ein günstiger Zufall kann mich retten. Ich muß abwarten, ob die Strömung mich vielleicht an das Ufer treibt.«