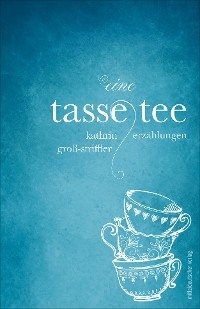Kitabı oku: «Eine Tasse Tee», sayfa 2
avernakø
Er ist auf der Insel angepflockt wie eine Ziege am Pfosten. Die Insel ist nur sechs Quadratkilometer groß. Und auf der hat er immer gelebt. Er will nicht fort, und er kann nicht fort. Er akzeptiert das Seil, das ihn festhält, es besingt es und verdammt es, er zerrt daran und lässt sich halten. Segen ist sie, die Insel, und Fluch zugleich.
Er geht in das Stück Garten, das er für die Hühner abgegrenzt hat. Eins hat einen nackten Arsch, keine Ahnung, warum. Sie scharen sich flatternd und gackernd um ihn, weil er einen Eimer mit Getreide dabeihat. Er fasst mit der Hand hinein und spürt die kühlen Körner, die einen leicht modrigen Duft verströmen. In diesem Jahr steht der Weizen hoch, aber es kann ihm egal sein. Er ist kein Bauer mehr. Seine Scheune ist vor sechs Jahren abgebrannt und hat seine gesamte Ernte vernichtet. Da hat er aufgegeben und sein Land verpachtet. Sein Nachbar, der neue Pächter, hat ihm auf die Schulter geklopft. Vielleicht kann ich jetzt überleben, hat er gesagt. Kriegst ja kaum was für das Getreide. Er hat sorgenvoll den Kopf geschüttelt. Und wie geht’s jetzt bei dir weiter? Niels hat die Achseln gezuckt. Ich mach’ mich nützlich, hat er gesagt. Viel brauchen wir ja nicht, meine Mutter und ich.
Er langt in die Nester und sammelt die noch warmen Eier ein. Am Nachmittag muss er ein paar öffentliche Rasenflächen mähen und den Lieferwagen für den nächsten Tag fertigmachen. Montags und donnerstags holt er frische Lebensmittel von Fünen herüber, für den kleinen Kaufladen. Die Fahrzeit auf der Fähre beträgt eine Stunde. Eine Stunde, die ihnen allen hier Stille garantiert und Gleichmaß. Man könnte auch sagen, Langeweile und Einsamkeit. Hundert Einwohner sind sie auf Avernakø. Touristen verirren sich nicht zu ihnen. Was sollen sie hier auch machen. Im Meer baden, gut, einmal um die Insel radeln. Viele der ehemaligen Bauern arbeiten in Fåborg in den Fabriken. Also ist es tagsüber noch stiller als still. Nur der Wind fährt durch die Pappeln. Vereinzelt hört man eine Kettensäge oder eine Fräse oder einen Hund oder das Maunzen einer Möwe. Er seufzt. Er hat das Gefühl, dass seine Haut an ihm herabhängt wie ein zu großer Mantel. Seine Schritte hallen im dunklen Flur. Er stößt die Tür zur Küche auf und stellt den Korb mit den Eiern auf den Tisch. Mach die Tür zu, es zieht, sagt seine Mutter. Sie schnuffelt. Du weißt doch, dass mir Zug nicht bekommt. Wortlos schließt er die Tür. Das Fenster ist beschlagen vom Dampf, der aus einem der Töpfe aufsteigt. Er geht hinters Haus und jätet das Unkraut im Kartoffelacker. Zahme Feldhasen sehen ihm dabei zu.
Seine Mutter sagt beim Mittagessen: Bring morgen Fisch mit, und er nickt. Wässrige rotgeränderte Augen schauen aus einem von Falten völlig zerknitterten Gesicht. Er denkt: Wenn sie tot ist, bin ich ganz allein. Diesen Gedanken hat er in der letzten Zeit öfter, weil sie langsam vor seinen Augen verlischt. Als er in Fåborg auf die Hauptschule ging, hat er immer mal wieder ein Mädchen gehabt. Was, du bist von Avernakø? Das war das Ende. Meine Güte, wie lange das her ist. Sein Vater war in dem Alter, in dem er jetzt ist – achtundfünfzig – schon tot. Selbst durch das geschlossene Fenster hört man das unwirsche Rufen eines Fasans. Seine Mutter ist ihr gesamtes Leben nie übergesetzt, sie wird auf dem kleinen Friedhof neben ihrem Mann liegen, wenn es soweit ist. Dem Friedhof, dessen Kieswege er harkt. Mädchen für alles ist er, es ist ein Jammer, aber immer noch besser als Fabrik. Er sieht doch, was die Fabrik aus den anderen macht. Kettenraucher und Trinker, Männer und Frauen, die auf der Fähre schon die Bierdosen in der Hand haben, die den Rauch so gierig inhalieren, als hinge ihr Leben davon ab. Oder das, was davon übrig ist, und das ist nicht viel.
Am nächsten Morgen nimmt er mit ihnen die erste Fähre früh um sieben. Die meisten legen ihre Arme auf die Tische und den Kopf darauf und schlafen noch ein Stündchen. Er hat sein Buch dabei, das er in der Bücherei in Fåborg ausgeliehen hat und zurückbringen muss, einen historischen Roman über Karl den Großen. Er glaubt, er ist der Einzige, der auf Avernakø Bücher liest. Er wäre gern weiter zur Schule gegangen, aber er wurde auf dem Hof gebraucht. Das Buch riecht nach Staub, die Seiten sind vergilbt. Er lauscht dem Brummen des Schiffsmotors, bevor er zu lesen anfängt, fühlt das leichte Schaukeln, der Wind hat noch zugelegt über Nacht, die Sonne scheint hell und weiß. In der Nacht hat eine Kuh des Nachbarn gekalbt, er ist von ihrem Schreien aufgewacht und hat lange nicht mehr einschlafen können. Auf der Insel gibt es nur kleine Herden, er selber hatte fünf Kühe, die den Sommer lang auf der Weide grasten. Vorbei, alles vorbei.
In Fåborg besorgt er frische Lebensmittel und Fisch und lädt alles in den Lieferwagen. Als er langsam durch die Straßen läuft und Paare sieht und Kinder, verwünscht er die Tatsache, dass er auch noch dankbar sein muss für diesen Job. Er geht dicht an einer Schaufensterscheibe vorbei. Ja, das ist er, dieser kleine gedrungene Mann mit den schlohweißen Locken, die er selber schneidet, den zu kurzen Cordhosen, den abgetretenen Schuhen. Die Hose ist zu weit hochgezogen. Auf der Insel ist ihm das egal. Aber hier … Hier ist es, als wäre ein Vergrößerungsglas auf ihn und sein dummes Leben gerichtet. Das geht so weit, dass er stottert, als er sich später in einer kleinen Kneipe ein Bier bestellt. Er sieht auf die Uhr. Die Fähre geht in einer halben Stunde, gottlob, der Tag wird bald vorüber sein.
Er hat seinen Lieferwagen im Schiffsbauch geparkt, die Handbremse fest angezogen, ist nach oben aufs Deck. Die Sonne scheint immer noch, nur ist ihr Licht jetzt wärmer, beinah honigfarben, bescheint die vielen kleinen Inseln, die unbewohnt sind, der Sand leuchtet golden auf. Die Arbeiter sitzen in einer Gruppe zusammen um einen Tisch, sie trinken und rauchen, und er grüßt sie freundlich. Unten wird die Rampe hochgefahren, die Fähre legt ab, nimmt Fahrt auf, er schaut über das türkisgrüne Wasser, vom Wind zu kleinen Kämmen geriffelt, langsam, aber stetig entfernen sie sich von der Stadt, von dem Lärm, von den Menschen, von dem Gefühl des Scheiterns, von den Hirngespinsten, was hätte sein können oder hätte sein sollen, jetzt ist wieder alles so, wie es eben ist. Er kehrt heim. Er lehnt sich zurück, spürt die Sonne auf Kopf, Nacken und Schultern, da öffnet sich die Tür, und eine Frau tritt blinzelnd auf das Deck. Er hat sie noch nie gesehen, sie gehört nicht auf die Insel. Ihre kurzen dunklen Haare sind mit grauen Strähnen durchsetzt, sie muss in seinem Alter sein. Sie trägt Jeans und eine weit fallende, dunkelblaue Bluse. Ihr Blick geht über das Grüppchen der Arbeiter, fällt dann auf ihn, schweift weiter, kehrt zurück, sie schaut, fragend erst und dann nicht mehr fragend, eher so, als ob sie ihn kennte, ihre Mundwinkel heben sich zu einem schwachen Lächeln, und sie zittern, die Mundwinkel, und meine Güte, was ist er verwirrt. Verwirrt und gleichzeitig ganz ruhig. Er schaut zurück, und auch er lächelt. Einen Augenblick lang, grade den Moment zwischen dem Schlag der Wimpern, steht die Welt still, verrinnt keine Zeit. Dann wendet sie sich ab, geht zur Reling, legt ihre Arme darauf. Er nimmt die Biegung ihres Rückens wahr, an dem nichts Abweisendes ist, es müsste schön sein, mit der Fingerkuppe über die einzelnen Wirbel zu fahren. Er schließt die Augen und öffnet sie wieder. Nein, er hat nicht geträumt, sie ist noch da. Was will sie auf der Insel? Will sie dort Urlaub machen, hat sie sich ein Zimmer gemietet? Er wüsste niemanden, der Gäste aufnimmt. Auf jeden Fall bleibt sie über Nacht, sie sind auf der letzten Fähre. Sie wendet sich um, wieder treffen sich ihre Blicke, wieder lächeln beide. Steh auf, du Depp, sagt er sich, geh hin, sprich sie an. Doch er hat Angst, den Zauber zu zerstören. Auch er glaubt, dass er sie kennt, von vor ganz langer Zeit. Es gibt keine Fremdheit zwischen ihnen. Sie hat sich mittlerweile wieder abgewendet, läuft langsam über das Deck, schaut hierhin und dorthin, dann drückt sie auf den Knopf, der die Tür zum Innern des Schiffes öffnet, und verschwindet, vielleicht holt sie sich einen Kaffee, und immer noch sitzt er da und rührt sich nicht. Er hat das Gefühl, ganz viel Zeit zu haben. Er wird ihr die Insel zeigen, den feinen Sandstrand am Ende, die Stelle, wo sie so schmal wird, dass das Meer von beiden Seiten bis an die Straße heranreicht, er wird sagen: Nicht tief einatmen, hier stinkt das Wasser; er wird sagen: Wir haben nichts hier außer Stille, Wasser und Wind; und sie wird nicken und ihn verstehen. Er hat gar nicht gemerkt, dass die Überfahrt ihrem Ende zugeht, und fährt zusammen, als eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher die Passagiere auffordert, zu ihren Autos zurückzukehren. Unten im Schiffsbauch steht sie neben ihrem Fahrrad, da, wo die Rampe heruntergefahren werden wird, und er, der der Erste in Fåborg war, wird nun der Letzte sein, der die Fähre verlässt, aber er kann nicht hin zu ihr und sagen: Warten Sie, oder: Wohin fahren Sie?, oder: Bleiben Sie, er kann einfach nicht, er ist wie gelähmt. Er hat zu viel Angst, dass die Luftblase aus Glück zerplatzt, dass er sich geirrt hat, dass alles Einbildung war, so etwas gibt es doch nicht, dass sich zwei Menschen kennen, die sich noch nie gesehen haben, also muss er zusehen, wie sie sich auf ihr Fahrrad schwingt und davonradelt, fest in die Pedale tritt, und diesmal drückt ihr Rücken etwas anderes aus. Enttäuschung. Ungeduldig wartet er, bis ein Wagen nach dem anderen an Land gefahren ist, aber als er dann endlich die schmale Straße zum Kaufladen hinter zockelt, ist sie verschwunden. Lars hilft ihm beim Ausladen, eine Zigarette zwischen den Lippen. Niels fragt: Gibt es seit neuestem jemanden auf der Insel, der Zimmer vermietet?, lässt seine Stimme beiläufig klingen. Na, die Madsens, soweit ich weiß, sagt Lars. Den Lieferwagen lässt Niels stehen, er gehört dem Laden. Er könnte jetzt heimgehen, sein Fahrrad holen, zu jenem Haus fahren, unauffällig mit den Madsens ins Gespräch kommen, sie ein bisschen ausfragen über die Frau, woher sie kommt, warum ausgerechnet Avernakø, und dann tut er es doch nicht, er verschiebt es auf den nächsten Tag, wo er den Müll einsammeln muss, er wird da zwangsläufig an jenem Haus vorbeikommen, ja, gut, er ist ein Feigling, aber es steht zu viel auf dem Spiel, im Grunde steht alles auf dem Spiel, also setzt er sich zu seiner Mutter an den Küchentisch, wartet, bis der Fisch fertig gebraten ist, ihr fällt es nicht auf, wenn er nichts sagt, sie reden nie viel. Danach holt er sich einen Stuhl und hockt sich in den Garten und weiß sie ganz in der Nähe, sie, die Fremde, sie schaut wie er den Mond an, der langsam über dem Meer aufgeht, hört wie er die Fasane rufen; und als dann die ersten Fledermäuse durch die Luft schwirren, ist er wieder froh. Wer verbietet ihm, am nächsten Morgen mit jenem Haus anzufangen, die Tour verkehrtherum zu machen? Er ist ja schließlich ein freier Mann! Er legt sich ins Bett und wagt kaum, sich zu sehnen, wagt sich kaum einzugestehen, dass seine Sehnsucht nun ein Gesicht hat, dass all die einsamen Nächte zu dieser Nacht geführt und somit einen Sinn bekommen haben. Der Schlaf will nicht kommen, aber wer braucht schon Schlaf!
Das Haus der Madsens liegt an der hinteren Spitze der Insel, direkt am Meer und an drei Seiten von Wald umgeben. Ein Schotterweg führt hin. Er hat seinen Anhänger an den Traktor gekoppelt und holpert auf das Haus zu, das von hier aus nicht zu sehen ist. Sein Herz rumpelt in seiner Brust. In der Regel bringen die Bewohner ihre zugebundenen Müllsäcke bis vor an Straße oder Weg, aber heute liegt noch kein Sack da, wahrscheinlich rechnen sie erst später mit ihm. Er lässt den Motor laufen und steigt ab, froh über das laute Rattern, das ihm Schützenhilfe gibt. Er klappt das Brett des Anhängers herunter, legt sich die Worte zurecht, wenn sie lächelt, wird alles ein Leichtes sein, wenn nicht, wird er sich lächerlich machen mit seinem Gestammel, wie auch immer, es muss sein, er gibt sich einen Ruck und dreht sich um. Und dann geht alles so schnell, wie es auf der Fähre langsam gegangen ist, wo er noch glaubte, Zeit zu haben, wo er noch glaubte, auch für ihn könne es so etwas wie Glück geben, einen zaghaften, herrlichen Augenblick lang, der sich für immer in sein Herz eingegraben hat, von dem er wird zehren müssen, sollte er jemals in der Lage sein, ihr das zu vergeben, was sie ihm jetzt antut: sie kommt auf ihn zu, ein hochgewachsener Mann ist an ihrer Seite, ein Wagen mit deutschem Kennzeichen steht vor dem Haus, sie stockt, sieht ihn, sieht den Anhänger mit den paar Müllsäcken, die er auf dem Weg hierher eingesammelt hat, schiebt demonstrativ ihren Arm unter den des Mannes und lächelt Niels an. Es ist ein anderes Lächeln als auf dem Schiff. Es ist von oben herab, und es macht ihn kleiner, als er ohnehin ist, es ist fremd, grausam und demütigend. Es misst ihn, es urteilt ihn ab. Mit einem fröhlichen Hi! gehen beide an ihm vorüber. Und wieder ist es ihr Rücken, auf den er starrt, den er hassen würde, wenn er nur könnte, allein die Selbstachtung gebietet es schon, aber vernichtet, wie er ist, ist er nicht fähig zu Hass, auch deswegen, weil er noch etwas anderes in ihrem Gesicht erkannt hat, in ihren grauen Augen, die er zum ersten Mal aus der Nähe gesehen hat, die einen kleinen goldenen Stern in der Mitte haben, die weit aufgerissen waren, Augen, die der Spiegel der Seele sind, wie man sagt, und die seine kurz trafen: Angst.
meine mutter und ich
Meine Mutter und ich, wir sind die letzten unserer Art. Wenn sie tot ist, wenn ich tot bin, kommt keiner mehr.
Im Haus meiner Mutter gibt es keine weichen Teppiche. Dafür ein paar verschlissene Läufer, mit Fransen. Unter den hohen Stuckdecken, in den dunklen Winkeln, lastet das Schweigen. Das Haus ist vollgestopft bis unters Dach, vollgestopft mit all dem, was sie nicht wegwerfen kann. Vasen. Krüge. Möbel, die seit dem Tod meines Vaters nicht mehr gebraucht werden. Seine Wäsche, seine Mäntel. Seine Bücher. Sein Schreibtisch. Das kalte Licht der Lampen leuchtet jeden Winkel aus. Sammeltassen stapeln sich, alte Schuhe, sauber in die Kartons verpackt, in denen sie gekauft wurden. Meine Mutter hortet. Warum hast du den Putzlumpen weggeworfen, Margarete, sagt sie anklagend, er war doch noch gut. Nein, sage ich, er war dünn und verschlissen, und er hatte Löcher. Du schmeißt alles weg, sagt sie im Ton des Vorwurfs. Ich sage, wir kaufen einen neuen. Sie sagt, kommt nicht in Frage. Dafür gebe ich mein Geld nicht aus. Schau, dass du ihn wiederfindest. Die Müllabfuhr war noch nicht da.
Im Haus meiner Mutter weht kein frischer Wind. Nie öffnet sie die Fenster. Das Schweigen und die abgestandene Luft und der Staub hängen in den Räumen. Bei einem meiner letzten Besuche habe ich gesagt, Mutter, es riecht seltsam. Da hat sie schnell den Kopf geschüttelt. Das ist die Waschlauge, hat sie gesagt. Ich habe heute Morgen Kleider eingeweicht. Warum benutzt du nicht die Waschmaschine?, frage ich. Strom ist teuer, sagt sie.
Draußen ist es dunkel, und der Zug, der mich zu meiner Mutter bringt, gleitet fast geräuschlos durch die Nacht. Hin und wieder blitzen Lichter auf, Städte, Dörfer, Menschen sehe ich an Fenstern sitzen, ganz kurz nur, dann saugt die Bahn das Licht in sich auf, gleitet weiter durch Felder und Hügel, die schwarz liegen wie das Meer bei Nacht. Sie, meine Mutter, ist im Krankenhaus. Auf allen Vieren ist sie aus dem Garten die Treppe hoch zum Telefon gekrochen, hat mich angerufen mit einer Stimme, die mich ins Mark erschreckt hat, so von weit her klang sie, als hätte meine Mutter schon den Tod gesehen. Sie ist einundneunzig, meine Mutter. Sie hat die Fliesen der großen Terrasse hinter ihrem Haus tagelang mit einer Wurzelbürste bearbeitet. Sie hat Eimer mit Tonfarbe gekauft und ins Haus geschleppt, mit der sie die Fliesen streichen wollte. Und ist zusammengebrochen. Ich habe veranlasst, dass ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus bringt. Vor kurzer Zeit noch hätte ich das Flugzeug nehmen müssen, um zu ihr zu gelangen. Habe ich doch immer weit weg gelebt. Amerika. Japan. Doch jetzt bin ich zurück. Ich habe keine Geschwister. Und keine Kinder. Mein Vater ist seit langem tot. Wir müssen das nun zu Ende bringen, sie und ich.
Im Gepäck habe ich Plastikdosen. Jede Menge Plastikdosen. Denn sie gibt mir jedes Mal, wenn ich sie besuche, Eingewecktes mit: Apfelkompott, eingelegte Tomaten, Erdbeerkonfitüre. Manchmal auch Fleisch, das sie als Sonderangebot erstanden und für mich vorgekocht und eingefroren hat. Oder rohe Milch. Unmengen von Milch. Sie behauptet, nur in ihrem Dorf gebe es gute gesunde Milch. Wie oft schon sind mir die Kannen im Auto umgefallen, und es hat nach Käse gestunken, wochenlang. Daheim koche ich die Milch ab und fülle sie in Flaschen. Die Kannen und Dosen spüle ich sorgsam aus. Sie zählt sie, wenn ich abreise, und sie zählt sie, wenn ich zurückkomme. Sie wird im Krankenhaus danach fragen. Ich kenne meine Mutter. Meine Mutter ist in meinem Organismus. Ihr Blut läuft durch meine Adern, ihre Gedanken sind in meinem Kopf. Ich sehe nach draußen, und mein Spiegelbild bleckt mir die Zähne. Ich sehe ihr ähnlich. Ich sehe viel älter aus, als ich bin. Ich habe dieselben grauen wirren Locken, dieselbe gerade Nase, dieselben großen Zähne, dieselbe harte steile Falte über der Nasenwurzel. Aber einen Unterschied gibt es: sie ist zäher als ich. Sie ist nicht totzukriegen. Sie wird jahrelang sterben. Sie bezieht ihre Kraft aus meiner Substanz. Saugt mich aus wie ein Blutegel. Ich habe Rückenprobleme; sie nicht. Sie steht kerzengerade; ich stehe gebückt. Sie lässt sich mein Rückenmark auf der Zunge zergehen.
Dann, vor ein paar Wochen, habe ich die Klinke zu ihrem Schlafzimmer heruntergedrückt. Meine Mutter war im Keller. Es stank nach Urin. Sie muss inkontinent sein. Ich habe Berge von Wäsche ins Badezimmer gebracht. Ich habe zehn Ladungen gewaschen. Mit der Maschine. Aus der Maschine kommt ein Schlauch, den man über den Rand der Badewanne hängen muss. Dazu muss man die Maschine bewegen, weil der Schlauch zu kurz ist, und sie ist sehr schwer. Deswegen also wäscht sie mit der Hand. Nicht nur wegen dem hohen Strompreis. Offenbar schämt sie sich. Meine Mutter schämt sich vor mir. Das ist neu. Aber ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Klobrille gibt es auch keine mehr. Ich sage, wir kaufen eine neue. Sie sagt, es geht auch ohne. Auf dem Klorand sind Urinflecken, gelblich, einzelne Haare hängen darin.
Die Abteiltür wird aufgeschoben. Eine junge Mutter und ein kleines Mädchen kommen herein. Ist hier noch frei?, fragt die Mutter, und ich nicke höflich. Sie verstauen ihr Gepäck im Netz und setzen sich hin, mir gegenüber. Das Kind legt seinen Kopf an die Schulter der Mutter und schließt die Augen. Ich sehe es an. Es schläft. Die Mutter sitzt still, ganz still. Ich merke, dass ich mit den Zähnen knirsche. Nachts tue ich das auch, im Schlaf. Und ich werfe meinen Kopf hin und her. Ranschen nannte das meine Mutter. Junge Katzen treten gegen die Brust ihrer Mutter, dass Milch kommt. Ich ransche mit dem Kopf.
Ich bin höflich. Immer wieder sagt man, wie höflich Margarete ist. Höflich und korrekt. Ich bin mit meiner Mutter in der Straßenbahn, und sie schreit den Fahrer an. Dass er zu ruckartig fahre. Aller Augen sehen nach vom. Ich möchte im Boden versinken. Sie ruft, da zahlt man einen so hohen Fahrpreis und dann das. Ohne Rücksicht auf Verluste. So ist die heutige Jugend. Warten Sie mal, bis Sie älter sind. Der Fahrer schüttelt den Kopf.
Der Tag besteht aus Pflichten. Aufgaben, die man abarbeiten muss. Teppiche klopfen. Wäsche waschen. Bett beziehen. Einkaufen gehen. Aber nur das Nötigste. Sonderangebote. Obst und Gemüse liefert ihr Garten. Abends: Strümpfe stopfen. Sie kneift die Augen zu Schlitzen zusammen, und ich sage, du verdirbst dir die Augen. Da sitzt sie unter der lächerlichen Stehlampe und stopft mit zusammengebissenen Zähnen. Das Deckenlicht ist aus. Sie sitzt in dem matten runden Lichtkegel und führt mit zitternden Fingern den Faden durch das Nadelöhr.
Einmal im Schlafzimmer, habe ich alle Türen des mächtigen Einbauschranks aufgemacht. Meine Eltern haben ihn nach ihrer Hochzeit angeschafft. Möbel kauft man fürs Leben. Ich finde Unterwäsche. Ausgeleierte, unsäglich formlose Schlüpfer, die muffig riechen. Handtücher, die dünn und hart sind wie Sperrholz. Verblichene Bettwäsche mit Karomuster. Sauber, Kante auf Kante, geordnet. Mottenkugeln fallen mir entgegen. Daneben hängen ihre Kittelschürzen auf Kleiderbügeln. Und ihre zwei Faltenröcke. Einer dunkelblau, für gewöhnliche Anlässe. Einer schwarz, für besondere. Ein paar vergilbte Blusen. Ich öffne eine weitere Tür: alte Schurwollbettdecken mit gelbbraunen Flecken. All das werde ich ausmisten müssen, wenn sie tot ist. Wochen werde ich brauchen. Mein Mann wird sagen: Lass einen Container kommen und wirf alles rein.
Meinen Mann mag sie nicht. Sie hat gesagt: Er ist nur angeheiratet, er gehört nicht zur Familie. Sie redet nicht mit ihm. Tut, als sei er nicht da. Dabei ist er groß und nicht zu übersehen. Er ist Chemiker. Sehr erfolgreich. Er sagt, warum rennst du immer hin zu ihr, sie hat es nicht verdient. Ich sage: Aber sie ist meine Mutter. Ich weine. Er sagt: Ich finde es falsch, dass du dich so reinstresst. Bleib bei mir, da gehörst du hin. Mein Mann ist keiner von den Zärtlichen. Das liegt ihm nicht. Er hat vor dreißig Jahren gesagt: Du und ich, wir bauen was auf. Dazu steht er. Er steht zu allem, was er einmal beschlossen hat. Da wird nichts mehr in Frage gestellt. Mir kann’s recht sein. Auch ich bin keine von den Zärtlichen. Das ist mir nicht wichtig. Wir passen zusammen. Nur Söhne hätte er gern gehabt.
Wie meine Mutter mich früh geweckt hat, als ich noch klein war: Kam ins Zimmer, zog ratsch, rasselnd und mit einem Ruck den Rollladen hoch. Ich saß aufrecht und erschrocken im Bett. Blinzelte ins Tageslicht, das kalt war und hell. Ich fror. Auch im Sommer fror ich. In der Küche gab es blutfarbenen Tee. Und Haferflocken, schnell, schnell, du musst in die Schule. Die Mutter war schon bei der Arbeit. Stand in ihrer Kittelschürze am Herd, schnitt Kohl aus dem Garten. Wie ich Kohlsuppe verabscheute. Aber was auf den Teller kam, wurde gegessen. Wenn die Zucchinis reif waren, aßen wir wochenlang nichts anderes.
Das kleine Mädchen ist weich gegen die Mutter gesunken, und sie legt seinen Kopf auf ihren Schoß. Das kleine Mädchen murmelt im Schlaf, und die Mutter lächelt. Der Zug bremst, und es riecht nach verbranntem Gummi. Das wäre was: ein Zugunglück. Die Tochter stirbt vor der Mutter. Da hätte sie niemanden mehr, den sie herumkommandieren kann. Sie hat im Dorf keine Bekannten. Sie lebt ganz für sich, in ihrem großen Haus. Mein Mann sagt: Sie hat sich nie um Kontakte gekümmert, und jetzt hängt alles an dir. Sie hätte dafür sorgen sollen, dass sie im Alter nicht allein ist. Hätte sie, sage ich, hat sie aber nicht. Und nun? Soll ich sie allein lassen? Mein Mann sagt: Tu sie in ein Pflegeheim. Sie weigert sich, sage ich ruhig. Wenn du nicht mehr hinrennst, sagt mein Mann, wird ihr nichts anderes übrigbleiben. Das kann ich nicht, sage ich und weine. Verstehst du das nicht? Nein, sagt mein Mann. Das verstehe ich nicht. Und er sagt: Bleib bloß nicht zu lange dort. Du hast eine Ehe zu führen.
Mein Vater war groß und schweigsam. Er starb, als ich vier war. Hat sich davongemacht. Er hat mich mit ihr allein gelassen. Einmal saß ich auf seinem Schoß, hatte Buntstifte in der Hand, und malte. Malte große schwarze runde Augen. Immer nur Augen. Mal einen Mund hin, der lächelt, hat er gesagt. Aber ich wollte nicht. Mach du’s, habe ich gesagt. Er hat meine Hand mit dem Stift in seine Hand genommen und gesagt: Punkt, Punkt, Komma, Strich, und fertig ist das Mondgesicht. Aber auch dieser Mund hat nicht gelächelt. Da haben wir es aufgegeben. Er hat mich auf den Boden gestellt und: Geh spielen, gesagt. Kurz darauf ist er gestorben. Magenkrebs. Er hat zu viel in sich hineingefressen, nehme ich an.
Man hat ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Sie wird die Schwestern herumscheuchen. Und ich kann es dann wieder gradbiegen, kann Trinkgelder verteilen, beruhigende Worte finden. Meine Mutter ist krank. Meine Mutter war ihr Leben lang nie krank. Das wird sie uns spüren lassen. Ich überlege kurz, wähle die Nummer ihres Zimmers. Ich werde leise sprechen, dass das kleine Mädchen nicht aufwacht. Eine Schwester nimmt ab. Wie geht es ihr, frage ich, ich bin die Tochter. Die Schwester seufzt. Sie darf nicht aufs Klo. Aber sie weigert sich, die Bettpfanne zu benutzen. Und nun?, frage ich. Wir warten, bis sie platzt, sagt die Schwester. Nehmen Sie mir’s nicht übel. So eine hatten wir noch nie. Eine harte Nuss. Eine wirklich harte Nuss. Ich weiß, sage ich besänftigend. Ich weiß, wiederhole ich. Was soll ich auch sagen? Sie schimpft wie ein Rohrspatz, sagt die Schwester. Als wäre es unsere Schuld. Wir haben sie fixieren müssen, sagt die Schwester. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Habe ich, sage ich eilfertig. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Ich bin in ein paar Stunden da, ich sitze im Zug. Was sagt der Arzt? Sie wird nicht mehr die, die sie mal war, sagt die Schwester. Soviel ist klar. Das denke ich auch, sage ich. Ich danke Ihnen. Und lege auf.
Sie wird nicht mehr die, die sie mal war. Ich habe Magenschmerzen. Immer wenn es schlimm wird, schlägt es mir auf den Magen. Das habe ich von meinem Vater. Ich zwinge mich, ruhig zu denken. Ins Pflegeheim will sie nicht. Nachhause gehen kann sie nicht. Bleibt nur eine Möglichkeit: Sie muss zu uns. Nein, hat mein Mann gesagt, das kommt nicht in Frage. Sie oder ich. Wenn du sie holst, bin ich weg. Ich weiß, dass er es ernst meint. Also was? Wenn ich eine Pflegerin organisiere, die täglich ins Haus kommt? Keine wird lange bleiben. Keine wird es bei ihr aushalten.
Und immer sagt sie, die anderen haben Schuld. Sie ist bitter. Sie ist eine zu kurz Gekommene. Sie war ein uneheliches Kind von einem belgischen Kriegsgefangenen, den sie nie gesehen hat. Die Grippe-Epidemie wütete. Das war 1918, und sie war ein Baby. Auch sie erkrankte und schlief vier Wochen lang. Hinterher sagte man: Ach, wärst du nur gestorben. Ihre Mutter bekam noch ein Kind, ein eheliches diesmal. Sie selber lernte Hauswirtschaft und ging in Stellung. Als sie den ersten Lohn bekam, erschien ihr Bruder. Deine Leute brauchen das Geld für die Sau, die krank ist. Die Opernsängerin, bei der sie arbeitete, hat gesagt: Aber neue Schuhe könntest du dir anschaffen. Es wird bald kalt. Doch das Geld war weg. Für die Sau. So war das, Margarete, sagt sie bitter. Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Ich schlucke und fühle mich schuldig.
Das kleine Mädchen wacht auf und schaut mit großen Augen um sich. Es fragt, ob es die kleine Leuchte über dem Sitz anmachen darf, und die Mutter nickt. Sie lächelt mich an. Ganz weich und ohne Arg. Das Mädchen krabbelt auf ihren Schoß, und sie legt die Arme um den kleinen Körper. Geborgen schmiegt es sich an die Brust der Mutter. Ich kann meinen Blick kaum von beiden wenden. So etwas gibt es also, denke ich. Für mich ist das eine Offenbarung, nichts mehr und nichts weniger. Ich habe das seltsame Gefühl, dass sich meine Konturen auflösen. Dass ich zu Luft werde. Gottseidank nur kurz, einen schwebenden Augenblick lang. Jetzt bin ich wieder ich selber, und ich schaue aus dem Fenster, bemühe mich, nicht das Spiegelbild der beiden zu sehen, sondern die dunkle Landschaft draußen, über der nun die schmale Sichel des Mondes hängt. Ich versuche, an etwas zu denken, das meiner Mutter Freude gemacht hat. Der Himmel, fällt mir ein. Sie hat gern den Himmel angesehen. Die tintigen Wolken vor einem Gewitter, das endlose Blau an einem Sommertag. Das besonders. Sie hat den Kopf in den Nacken gelegt. Das ist schön, hat sie gesagt. Man denkt, man kann fliegen. Doch sie war schnell wieder auf dem Boden. Hat gesagt, der Garten ist voller Unkraut, ich muss mich ans Werk machen.
Ich sehe auf die Uhr. Da läutet das Telefon. Meine Mutter weint. Hol mich hier raus, flüstert sie. Ich sage: Du musst durchhalten, Mutter. Es wird dir bald besser gehen, und dann kannst du wieder nach Hause. Ich muss in den Garten, sagt sie. Keiner macht die Arbeit, wenn ich weg bin! Daran darfst du jetzt nicht denken, sage ich. Aber natürlich hört sie mir nicht zu. Nie kommt die Schwester, wenn man sie ruft, sagt sie anklagend. Ich klingle dauernd, und meinst du, sie halten es für nötig und kommen? Sie sitzen sicher in der Küche und trinken Tee. Und ich muss auf die Toilette. Du musst die Bettpfanne benutzen, sage ich. Niemals!, ruft sie. Ich kann aufs Klo! Nun fall du mir auch noch in den Rücken! Der Arzt sagt, du darfst noch nicht aufstehen, sage ich besänftigend. Immer höflich, immer verständnisvoll. Papperlapapp!, sagt sie. Ich frage mich, ob ich jemals gegen sie aufbegehrt habe. In der Pubertät? Nein. Ich habe immer nach Kompromissen gesucht. Mein Mann sagt, du lässt dir auf dem Kopf rumtrampeln. Ich bin bald bei dir, sage ich tröstend. Meine Mutter schweigt. Mutter? Ich habe nie Mama gesagt. Das fand sie primitiv. Und sie sagte nie Gretl. Oder Grete. Auch mein Mann sagt immer Margarete. Hat mein Schätzchen Hunger?, sagt die Mutter zu dem kleinen Mädchen. Es schaut mich auf eine Art an, dass ich wegsehen muss. So unverwandt, so tief in meine Seele hinein. Schau da nicht hin, denke ich. Da ist nichts. Meine Mutter hat aufgelegt.
Die Frau hat zwei Brötchen ausgepackt, und die beiden essen. Nachhause kann meine Mutter nicht. Ins Pflegeheim will sie nicht. Im Krankenhaus bleiben für immer wird sie nicht. Sie muss zu uns. In meinem Kopf dreht sich ein Mühlstein. Sie muss zu uns nachhause. Aber das will mein Mann nicht. Sie oder ich, sagt er. Ich sehe auf die Uhr. Noch zehn Minuten. Das kleine Mädchen kaut. Draußen blitzen Lichter, und es werden immer mehr. Nachhause kann sie nicht. Ins Pflegeheim will sie nicht. Zu uns darf sie nicht. Mein Mann hat recht. Hat mein Mann recht? Sie wird nicht wieder gesund. Schnell sterben wird sie nicht. Ich kenne sie. Sie ist zäh. Da fällt mir ein: Sie hat vergessen, nach meiner Katze zu fragen. Es scheint ihr wirklich schlecht zu gehen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.