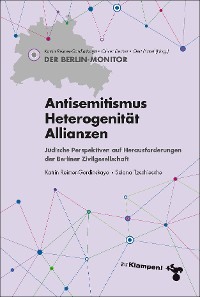Kitabı oku: «Antisemitismus – Heterogenität – Allianzen»
Katrin Reimer-Gordinskaya • Oliver Decker • Gert Pickel (Hrsg.)
DER BERLIN-MONITOR
Antisemitismus Heterogenität Allianzen
Jüdische Perspektiven auf Herausforderungen der Berliner Zivilgesellschaft
Katrin Reimer-Gordinskaya • Selana Tzschiesche

Der Berlin-Monitor ist ein seit 2019 von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung gefördertes Forschungsprojekt durchgeführt in Kooperation der Universität Leipzig und der Hochschule Magdeburg-Stendal.
© 2021 zu Klampen Verlag, Röse 21, 31832 Springe, zuklampen.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Autor*innen: Katrin Reimer-Gordinskaya, Selana Tzschiesche
(Hochschule Magdeburg-Stendal)
Herausgeber*innen: Prof. Dr. Katrin Reimer-Gordinskaya (Hochschule Magdeburg-Stendal), Prof. Dr. Oliver Decker (Universität Leipzig), Prof. Dr. Gert Pickel (Universität Leipzig)
Unter Mitarbeit von: Julia Schuler, Charlotte Höcker, Henriette Rodemerk, Nabila Essongri, Dorothea Föcking (Universität Leipzig)
Lektorat: Tilman Meckel
Gestaltung und Satz: Uta-Beate Mutz, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-86674-902-3
gefördert durch:

Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorwort und Einleitung
I. Antisemitismus in Berlin: Erfahrungen, Folgen und Umgangsweisen
Einleitung
a) Kontinuitäten von Antisemitismus in Berlin und ihre aktuellen Bedeutungen
b) Begegnungen in der postnationalsozialistischen Gegenwart Berlins
c) Orte und Praktiken der Besonderung einer Minderheit
d) Jüdische Berliner*innen im ‚Israel-Blick‘ der Mehrheitsgesellschaft
e) Aggressionen: Quellen, Qualitäten und Lebensbereiche
f) Bedrohungspotenzial und widerständige Normalität im Alltag
g) Bedeutungen für Betroffene und Reaktionen Dritter in unterschiedlichen Kontexten
h) Einschränkung der Möglichkeitsräume jüdischen Alltagslebens
i) Wahrnehmung, Bewertung und Kommunikation von Antisemitismuserfahrungen
j) Individuelle Umgangsweisen: Ausweichen und Konfrontation zwischen Fremd- und Selbstbestimmung
k) Kollektiv-informelle Umgangsweisen: Zuhörer*innen und mobilisierungs(un)fähige Netzwerke
l) Kollektiv-professionelle Strukturen: Beratung, Monitoring, Empowerment, Advocacy
Zusammenfassung: Antisemitismus in Berlin – Erfahrungen, Folgen, Umgangsweisen
II. Plurale (jüdische) Zugehörigkeiten: Diskriminierung, Inklusion, Heterogenität
Einleitung
a) Plurale Zugehörigkeiten, Einengung und ‚Intersektionalität'
b) Verschiedene und verknüpfte Diskriminierung und plurale Zugehörigkeiten im Alltag
c) Verschiedene/verknüpfte Diskriminierung in der Beratungslandschaft und im Antidiskriminierungsrecht
d) Konvergenzen und Divergenzen: Aktuelle Bedeutungen von Migrationsgeschichten
e) Aufbruch und Ankunft. Kontingentflüchtlinge im hierarchischen Migrationsregime
f) Integrationsregime und Leben in der Zone der Exklusion
g) Bildungswege wider institutionelle Hürden
h) Altersarmut und Wiedergutmachungsinszenierung
i) Immer noch ‚arm, aber sexy‘? Berlin aus jüdisch-migrantischen Perspektiven – 2000 – 2020
j) Feministisch-Jüdisch-Queer: Inklusion, Abwehr – Solidarität?
k) Ostdeutsch-jüdische Erfahrungswelten: Neue Blicke auf Geschichte und ihre Gegenwart
Zusammenfassung: Plurale (jüdische) Zugehörigkeiten – Diskriminierung, Inklusion, Heterogenität
III. Gemeinsam gegen Antisemitismus, für Vielfalt und Demokratie?
Einleitung
a) Von 1989 bis zu den 2000er Jahren – Einwanderung und kultureller Wandel (in) der Stadt
b) Die 1990er: ReKonstruktion, ReVitalisierung und Pluralisierung jüdischer Lebenswelten
c) Hin zum Selbstverständnis einer ‚Migrationsgesellschaft‘ – und auf dem Weg ins Postmigrantische
d) Die 1990er und 2000er Jahre: Awareness für aktuellen Antisemitismus – langer Atem und erste Erfolge
e) Die 2010er Jahre: Perspektivwechsel, neue Institutionen und Akteur*innen und Empowerment
f) Lernprozesse, Resonanz und jüngste Erfolge: Strukturen in Politik und Zivilgesellschaft
g) Sensibilisierung und Bildung wegen und gegen Antisemitismus: Stand und Perspektiven
h) Jüdische Lebenswelten und postmigrantische Kulturen: Eigenständigkeit, Netzwerke und ‚Allianzen'
i) Kooperation, Netzwerke und Solidarisierung gegen Antisemitismus: Stand und Perspektiven
j) Gemeinsam gegen Antisemitismus und / im Rechtsextremismus?
k) Für eine Gesellschaft der Vielen einschließlich Juden*Jüdinnen in Berlin
l) Gespräche über Gräben und Brücken
m) Gemeinsam für eine offene und solidarische Gesellschaft? Bündnispolitiken in Berlin
Zusammenfassung und Ausblick
Aktivierende Befragung: Erläuterung des methodischen Vorgehens als Lese- und Rezeptionshilfe
Literaturverzeichnis
Endnoten
Vorwort und Einleitung
Berlin ist Lebensort einer heterogenen Bevölkerung, die in dieser Stadt Freiräume für diverse Lebensentwürfe schafft und findet. Zugleich spüren viele, dass diese Freiräume zunehmend bedroht sind. Der damit einhergehende Widerspruch wird nicht zuletzt in den jüdischen Communities der Stadt erlebt. Im Berlin-Monitor (vgl. Pickel et al. 2019) versuchen wir mit den uns zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Mitteln auszuloten, wie es um Kräfteverhältnisse zwischen progressiven und regressiven Strömungen in der Stadt bestellt ist, und Wissensgrundlagen für die Weiterentwicklung demokratischer Alltagskulturen zu schaffen.
Im Kontext der Aktivierenden Befragung, einem von drei methodischen Ansätzen (vgl. a. a. O., 70 ff., und 122 ff. in diesem Bericht), werden sukzessive vier Schwerpunkte mit qualitativ-subjektwissenschaftlichen Mitteln untersucht: Antisemitismus, Rassismen, Prekarisierung und Heteronormativität. Der vorliegende Bericht ist dem ersten Schwerpunkt gewidmet. Ausgangs- und Fluchtpunkt ist dabei die demokratische Zivilgesellschaft Berlins. Von ihr gehen wir gedanklich und praktisch-forschend jeweils aus. Ihre Akteur*innen sind die primären Adressat*innen des vorliegenden Berichts.
Vielen dieser Akteur*innen der Berliner Zivilgesellschaft ist die längere Entwicklung des Ringens um demokratische Verhältnisse (nicht nur) in Berlin bekannt. Nach einem kurzen Moment der Hoffnung, den Schwung der DDR-Oppositionsbewegung für die Entwicklung demokratischer Alltagskultur nutzen zu können, griff auch in Berlin der nationalistische Furor der 1990er Jahre um sich. Zugleich boten gegenkulturelle Bewegungen ihm die Stirn und schufen Freiräume für non-konforme Lebensweisen. Aus diesen progressiven Strömungen speiste sich der um die Jahrtausendwende ausgebildete gesamtgesellschaftliche Kompromiss, der das ethno-nationale Paradigma zugunsten der Propagierung von Vielfalt hinter sich zu lassen begann. Die seit den 2000er Jahren aufgelegten Bundes- und Landesprogramme für Demokratie geben dem Umstand Ausdruck, dass auch unter diesen Vorzeichen Menschenrechte verteidigt und Teilhabe und Anerkennung erstritten werden mussten. Und während dies einerseits gelang, erodiert andererseits die gesellschaftliche Basis eines teils instrumentell verkürzten Verständnisses einer Gesellschaft der Vielfalt. Der ‚historische Block’ (Gramsci), der diesen Kompromiss ‚für Vielfalt’ trug, sieht sich seit den 2010er Jahren von einer zunehmend organisierten und vernetzten regressiven Strömung herausgefordert.
Dass wir uns vor diesem Hintergrund zunächst dem Schwerpunkt Antisemitismus widmen, liegt nicht nur daran, dass diesem in Politik und Öffentlichkeit in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Ausschlaggebend ist auch die Überzeugung, dass eine Demokratie in Deutschland nicht bestehen kann, wenn Juden*Jüdinnen in ihr nicht ‚ohne Angst verschieden sein‘ (Adorno) können. Damit wird keiner Hierarchisierung von Leid das Wort geredet, sondern angesprochen, dass der ‚Zivilisationsbruch, verübt an Juden‘ (Diner), die Spannung zwischen Partikularem und Universellem in sich trägt. Gesprächspartner*innen drückten ähnliche Gedanken mit Blick auf die Bedeutung von Menschenrechten in der Gegenwart so aus: Die Garantie der allgemeinen Menschenrechte im Grundgesetz ist ohne Auschwitz nicht zu denken, und das Grundgesetz hat seine Bestimmung, eine Republik zu verfassen, nicht erreicht, solange Antisemitismus virulent ist.
Es ist aus unserer subjektwissenschaftlichen Perspektive begrüßenswert, dass in der Antisemitismusforschung jüngst die Perspektive der Betroffenen ins Blickfeld gerückt wurde und so bettet sich die Aktivierende Befragung in diese (recht junge) Forschungsrichtung ein. Es geht hier also um Antisemitismus als Erfahrung, als etwas, das von Menschen in Berlin erlebt wird bzw. werden muss, sowie um die Frage, welche Folgen dies insbesondere im Hinblick auf die Einschränkung des Rechts auf Gleichheit und Differenz hat. Das Interesse unserer subjektwissenschaftlichen Handlungsforschung gilt zudem der Frage, wie Betroffene auf Antisemitismuserfahrungen reagieren und welche mehr oder weniger defensiven und offensiven Umgangsweisen sie unter bestimmten Umständen entwickeln (können). Diese drei Teilbereiche behandelt das erste Kapitel.
Weil jüdische Zugehörigkeiten plural und die jüdischen Communities in Berlin im bundesweiten Vergleich relativ vielfältig sind, war es uns ein Anliegen, diese Diversität in thematisch relevanten Bereichen zu berücksichtigen. Dazu gehört insbesondere der Umstand, dass jüdische Berliner*innen nicht allein Antisemitismus erfahren, sondern verknüpft mit oder unabhängig von diesem auch andere Formen der Diskriminierung. In und aus jüdischen Communities heraus entwickeln zivilgesellschaftliche Akteur*innen auch angesichts dessen Initiativen, die auf Inklusion zielen. Dies vollzieht sich in einer jüdischen und nicht-jüdischen Umgebung, die durch Heterogenität gekennzeichnet ist, woraus insbesondere im Kontext der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft Blindstellen und Ausschlüsse entstehen, aber auch Perspektiven für die Formulierung gemeinsamer Anliegen sichtbar werden. Diese drei Teilbereiche sind Gegenstand des zweiten Kapitels.
Das dritte Kapitel widmet sich vor diesem Hintergrund der Frage, inwieweit es in Berlin gelingt, angesichts der gegebenen Vielfalt Netzwerke, Allianzen und Bündnisse gegen Antisemitismus zu bilden. Dabei geht es auch darum zu rekapitulieren, welche Voraussetzungen in der Berliner Stadtgesellschaft geschaffen werden mussten, um diese Fragen aus jüdischen Perspektiven heraus zu stellen und praktisch aus jüdischen Communities heraus anzugehen.
Der Bericht schließt mit einer Erläuterung der Methodik und einem Ausblick auf den weiteren Verlauf der Aktivierenden Befragung.
Die Studie beruht auf Gesprächen mit 30 Expert*innen, die fachliche und/oder persönliche Einblicke in die genannten Themenbereiche geben können. Ihnen gilt unser herzlicher Dank. Wir hoffen, dass die erarbeitete Rekonstruktion eine nützliche ergänzende Grundlage für die Weiterentwicklung der Gegenwehr gegen Antisemitismus und des Engagements für eine demokratische Alltagskultur in Berlin sein kann.
Katrin Reimer-Gordinskaya (Haifa/Stendal) und
Selana Tzschiesche (Berlin)
I. Antisemitismus in Berlin: Erfahrungen, Folgen und Umgangsweisen
Einleitung
In Berlin existiert eine im bundesweiten Vergleich relativ große Bandbreite jüdischer Communities, die Teile der Vielfalt dieser Stadt ausmachen. Die jüdischen Berliner*innen1 gestalten in dieser Stadt ihr Alltagsleben und sind insbesondere auch in der demokratischen Zivilgesellschaft aktiv. Über sie war und ist in der nicht-jüdischen Öffentlichkeit und Forschung verschiedentlich die Rede, mit ihnen und aus ihrer Perspektive wurde und wird jedoch seltener gesprochen und geforscht.
Dies gilt auch für jene sozialpsychologische Forschung zu Antisemitismus, die die Entstehung und Entwicklung der Bundes- und Landesprogramme des sogenannten zivilgesellschaftlichen Ansatzes der Demokratieförderung (vgl. Roth 2003; Roth & Benack 2003) seit Anfang der 2000er Jahre begleitet hat. So wird in den Repräsentativerhebungen antisemitischer Einstellungen bzw. Vorurteile (vgl. Decker & Brähler 2018, 192 ff.; Zick et. al. 2019, 82 und 102 ff.2) die Verbreitung von Facetten ‚pathischer Projektionen‘3 in der Gesamtbevölkerung (ab einem bestimmten Alter) ermittelt. Auch der Berlin-Monitor mit seinem Mixed-Method-Design geht teilweise auf diese Weise vor (vgl. Pickel et al. 2019, 55 ff.). Wenngleich dieses Design zusätzlich auch die Erhebung von Diskriminierungserfahrungen umfasst, sind in den Samples dieser Art der Repräsentativerhebungen Juden*Jüdinnen (und andere von Antisemitismus Betroffene) nicht in hinreichender Zahl aufgehoben, so dass deren Erfahrungen nicht abgebildet werden können (vgl. a. a. O., 15). Und während Befunde über (die Verbreitung von) Facetten antisemitischer Projektionen wichtige Grundlagen für die Gestaltung von Handlungsstrategien gegen Antisemitismus liefern, können sie per definitionem nur wenig darüber aussagen, wie sich Antisemitismus in der Lebenswelt und in der Erfahrung von Juden*Jüdinnen darstellt. Diese Perspektive einzubeziehen und in den Mittelpunkt zu stellen, ist für die Aktivierende Befragung im Berlin-Monitor und diesen Bericht leitend.
In diesem Kapitel werden drei Leitfragen, die auch im Titel angedeutet werden, verfolgt:
– Wie stellt sich Antisemitismus in der Erfahrung von Betroffenen lebensweltlich dar?
– Welche lebensweltlichen und persönlichen Folgen hat Antisemitismus?
– Welche individuellen und kollektiven Umgangsweisen mit (Folgen von) Antisemitismus gibt es?
Beantwortet werden diese Leitfragen auf der Grundlage von Expert*innen-Interviews, die theoriegeleitet (ein)geordnet, verknüpft und zu rekonstruktiven Beschreibungen verdichtet werden (zur Methodik und Datenbasis siehe: 126 ff.). Leitend ist dabei der Gedanke, die Bandbreite all dessen in den Blick zu nehmen, was das Recht auf Gleichheit und Differenz von Juden*Jüdinnen in Berlin einschränkt (vgl. Pickel et al. 2019, 55 ff.). In einer auf die Re konstruktion von Antisemitismus aus der Sicht von Betroffenen angelegten Studie ist es nicht zielführend, dieses Phänomen vorab – und womöglich zu eng – zu definieren. Zudem kommen für die Einordnung des von den Gesprächspartner*innen Mitgeteilten neben Theorien des Antisemitismus und der Geschichte und Gegenwart von Judenfeindschaft in ‚Deutschland‘4 auch angelagerte Bereiche wie kulturelles Gedächtnis und Erinnerungspolitiken infrage. Welche historischen und zeitgeschichtlichen Konstellationen, welche Dimensionen und Facetten des Antisemitismus und dessen Nachgeschichte und Gegenwart von den Expert*innen angesprochen wurden, zeigt sich im Zuge der Darstellung. Es wird an Ort und Stelle auf jeweils einschlägige Theorie, Forschung bzw. Debatten verwiesen.
Die Darstellung folgt im Groben den o. g. Forschungsfragen, die indes nicht trennscharf nacheinander abgearbeitet werden. Sie beginnt mit der Thematisierung der Kontinuität von Antisemitismus in Berlin in einem biografisch und dynamisch für Gesprächspartner*innen relevanten Erfahrungszeitraum und geht auf aktuelle Bedeutungen des Lebens in einer postnationalsozialistischen Stadtgesellschaft ein (a, b). Es folgen Schilderungen zu Besonderung, Bedrohung und Aggressionen als Formen von Antisemitismuserfahrungen im Berliner Alltag, wobei die Erfahrung, im ‚Israel-Blick‘ der Mehrheitsgesellschaft zu stehen, eigens behandelt wird (c – f). Anschließend werden persönliche und über-individuelle bzw. lebensweltliche Folgen dieses Alltagsantisemitismus beleuchtet, wobei auch Reaktionen Dritter thematisiert werden (g, h). Abschließend wird auf teils unterschiedliche Wahrnehmungsweisen von Antisemitismus sowie individuelle, kollektiv-informelle und professionell-kollektive Umgangsweisen (i – l) als Formen der Gegenwehr gegen Antisemitismus eingegangen. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung und Reflexion der Ergebnisse.
Hinweis: Die Zitate ohne Quellennachweis stammen aus den Expert*innen-Interviews.
a) Kontinuitäten von Antisemitismus in Berlin und ihre aktuellen Bedeutungen
Im Sinne der Leitfragen und eingedenk der Problematik, dass Antisemitismus im dominanten Diskurs historisiert wird, fragten wir nach Erfahrungen mit aktuellem Antisemitismus in Berlin. Diese Fragen wurden teils mit Verweisen auf dessen Kontinuität(en) in der Stadt beantwortet. Aktuell bedeutsam werden diese Kontinuität(en) für Gesprächspartner*innen u. a. dadurch, dass gegenwärtiger Antisemitismus vor deren Hintergrund erfahren wird. Und während die Auseinandersetzung mit aktuellem Antisemitismus begrüßt wird, problematisieren Gesprächspartner*innen eine Assoziation von Shoa und Judentum bzw. Antisemitismus und Juden*Jüdinnen. Folgend wird geschildert, wie aus jüdischen Perspektiven auf Kontinuitäten des Antisemitismus und postnationalsozialistische Konstellationen in Berlin geblickt wird.
Auf die Bitte um eine Einschätzung des aktuellen Antisemitismus in Berlin antwortet ein*e Gesprächspartner*in5 im Bewusstsein um die unterschiedlichen Geschichten der beiden Stadthälften mit dem Hinweis, dass er nie verschwunden war: „Ja, […], also, ich würde sogar einen Schritt zurückgehen und sagen […], den gab’s immer“, womit „die beiden Nachkriegsdeutschlands“ gemeint sind sowie „nicht nur die bekannten Fälle“, sondern „eben die kleinen Beleidigungen und Angriffe des Alltags“. Während demnach nach der Shoa in Ost- und Westberlin lebende jüdische Generationen auf teils unterschiedliche und teils ähnliche Weisen mit Antisemitismus konfrontiert waren, sind die biografisch-familiären Verbindungen der heute in Berlin lebenden Juden*Jüdinnen zu diesem Kontinuum in der Stadt unterschiedlich (vgl. zur Heterogenität jüdischer Berliner*innen: Kapitel II, d – k und III, b). Unseren Gesprächspartner*innen ist diese Linie jedoch unabhängig davon bewusst, ob sie selbst bzw. ihre Familien schon lange oder erst seit kurzem in der Stadt leben. Kontinuitäten des Antisemitismus und Verbindungslinien zur Shoa wurden in unterschiedlichen Zusammenhängen angesprochen.
Um die Geschichte der Kontinuität, des Bruchs und Fortwirkens zu wissen, bedeutet aus dieser Perspektive allerdings gerade nicht, Juden*Jüdinnen bzw. jüdische Kulturen und Zugehörigkeiten mit der Geschichte des Antisemitismus und der (Nachgeschichte der) Shoa zu identifizieren.6 Im Gegenteil: So macht ein*e andere*r Gesprächspartner*in darauf aufmerksam, dass „das zwanghafte Nebeneinanderstellen von Faschismus und Judentum“ in Teilen der nicht-jüdischen Dominanzgesellschaft 7 als Zumutung erlebt wird. Und gewissermaßen an die Adresse derjenigen gerichtet, die diese Engführung (mehr oder weniger unbewusst) vornehmen, fährt er*sie fort: „Das Judentum hat mit dem Faschismus überhaupt nichts zu tun. Also, das kann ich nur an dieser und jeder anderen Stelle immer nur wieder ganz, ganz deutlich machen. Das ist nicht miteinander verknüpft, sondern nur dadurch verknüpft, dass es diese Verbrechen gegeben hat.“ Ein*e weitere*r Gesprächspartner*in führt einen ähnlichen Gedanken mit Blick auf aktuelle Debatten über Antisemitismus aus. So sei es einerseits wichtig, dass Antisemitismus wahrgenommen wird: „Ich habe das Gefühl, sozusagen, dass es eben dieser- es ist total wichtig, dass es diese gesellschaftspolitische Debatte um Antisemitismus gibt. Guckend auf die Mehrheitsgesellschaft, so.“ Allerdings stelle sich dies in einem bestimmten Sinn für Juden*Jüdinnen anders dar: „Ich habe das Gefühl, dass es für mich und auch für viele Menschen um mich herum ein totales Ärgernis ist, dass diese Debatte funktioniert“, weil „es so schön ins Narrativ der Mehrheitsgesellschaft passt. Aus dem einen Opferstatus Juden und Jüdinnen in den nächsten zu packen. Und immer auch verbunden mit der Frage: ‚Stelln die sich nicht doch an?‘ Ja, und so, oder ‚Das wird aufgebauscht‘, oder wie auch immer. Das find ich ein Problem.“
Jenseits solcher von außen erfolgenden Zuschreibungen spricht aus den Worten der Gesprächspartner*innen eine Sensibilität für Kontinuität, Zäsur und Wandel der Judenfeindschaft in dieser Stadt, in der im 19. Jahrhundert der im Nachhinein so genannte Antisemitismusstreit tobte (vgl. Zimmermann & Berg 2011), die im 20. Jahrhundert Ausgangspunkt der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden*Jüdinnen war (vgl. Hilberg 1961) und in deren Stadthälften Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Bergmann & Erb 1991; Haury 2002) ebenso wie in der Berliner Republik präsent blieb und bleibt (vgl. Reensmann 2004, 334 ff.; Salzborn 2019).
Dabei deutet sich schon an, dass die Gesprächspartner*innen auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 aus unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Begriffen (Antisemitismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Holocaust, Shoa) referieren. Gemeinsamer Bezugspunkt ist darin in unserem Zusammenhang jedoch die Katastrophe der Ermordung der europäischen Juden*Jüdinnen. Dieser „Zivilisationsbruch, verübt an Juden“ (Diner 2007, 14), hat auch aktuell für Juden*Jüdinnen in Berlin andere Bedeutungen als für nicht-jüdische Berliner*innen. Während insbesondere Nachfahren der Täter*innen sich aus der Sicht von Gesprächspartner*innen mit diesem Verbrechen und insbesondere mit der konkreten eigenen Familiengeschichte befassen sollten (s. u.), könnten sie nicht dasselbe von den Nachfahren der Opfer verlangen: „Und wir müssen uns von Hause aus, außer dass es uns eben bis ins Tiefste betrifft, aus Verstrickungen in der Familie, in der Geschichte, müssen wir uns als jüdische Menschen damit überhaupt nicht beschäftigen, wenn wir das nicht wollen“, betont ein*e Gesprächspartner*in. Der hier womöglich anklingende Protest gegen den ungewollten Einbezug jüdischer Berliner*innen in die nicht-jüdisch-deutsche Verantwortungsübernahme geht mit dem Verweis darauf einher, sich der familiär tradierten Nachgeschichte der Shoa kaum entziehen zu können. Andere Gesprächspartner*innen der zweiten und dritten Generation formulieren, dass überlebt zu haben für ihre Eltern und Großeltern mit dem Gefühl der „Schuldigkeit, rausgekommen zu sein“, verbunden war. Dieses Trauma hinterlässt in ihrem Leben Spuren (vgl. Rosenthal 1997, 135 ff.; Aarons & Berger 2017). Und während vielfach von Überlebenden berichtet worden ist, dass sie sich angesichts der Shoa von Gott abwandten (vgl. Lassley 2015), berichtet ein*e Gesprächspartner*in umgekehrt von einer Hinwendung zum Judentum als Religion, mit der sie*er aufwuchs: „Für mich persönlich sind meine Eltern religiös geworden, sagen wir, not disconnected from the Holocaust.“
So sehr jüdische Berliner*innen mit dieser Stadt verbunden sind (vgl. Kapitel II, i), gilt vor diesem Hintergrund doch auch, dass das heutige Berlin seine NS-Geschichte in sich trägt und seine Bevölkerung sich zu großen Teilen aus zwei der drei postnationalsozialistischen Gesellschaften (vgl. Lepsius 1993; Hammerstein 2017) speist.8 So resultiert für eine*n schon lange in Berlin lebende*n Gesprächspartner*in aus dem Gesagten, „wie man dieses Land halt auch als verbrannte Erde wahrnehmen kann, als Land, in dem man vielleicht nie mehr wirklich sein kann.“ Und für eine*n in den letzten Jahren nach Berlin gekommene*n Gesprächspartner*in war die Entscheidung für Berlin als Stadt in „Germany“ keine ungebrochene: „I also had mixed feelings about […] living here as a Jew and what does that mean.“
Vielleicht lässt sich als resultierende Anforderung an den öffentlichen Diskurs über Antisemitismus vor diesem Hintergrund festhalten, dass in ihm ein „Spagat“ gelingen sollte bzw. müsste: Nämlich einerseits Antisemitismus als Alltagsphänomen mit einer langen Geschichte wahr- und ernst zu nehmen, ohne dabei Juden*Jüdinnen in eine Opferrolle zu pressen und jüdische Kulturen und Zugehörigkeiten hinter Stereotypen verschwinden zu lassen.9