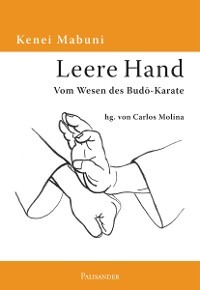Kitabı oku: «Leere Hand», sayfa 4
Mit einer geraden Linie einen Kreis beschreiben
Im chinesischen Kempō ist die Grundlage der Bewegung der Kreis. Auch im Boxen und Kickboxen werden die Schläge und Tritte mit kreisförmigen Bewegungen ausgeführt. Im Karate der Nachkriegszeit sind unter dem starkem Einfluß dieser Techniken die Bewegungen ebenfalls kreisförmig geworden.
Vor einiger Zeit zeigte mir ein Schüler ein Buch von Aragaki Kiyoshi mit dem Titel »Die Essenz des okinawanischen Budō-Karate«. Der Autor hatte zuvor in der Monatszeitschrift Karatedō im Rahmen der Artikelserie Karate sankoku shi Schriften aus dem Nachlaß meines Vaters herausgegeben. Sein Buch war für mich sehr lehrreich. Er schreibt: »Die Essenz des japanischen Budō liegt darin, mit einer geraden Linie einen Kreis zu beschreiben.« Dieser Satz hat mich sehr bewegt. Was ich mit dem ganzen Körper wahrnehme, hat er sehr treffend in Worte gefaßt. Im Iaidō40 kann man sehr gut erkennen, daß die Arme sich geradlinig nach vorn bewegen, während das Schwert aus der oberen Position mit einer kreisförmigen Bewegung nach unten schneidet. Eine gerade Linie beschreibt also einen Kreis. Auch die Geschwindigkeit, mit der das Schwert im Jigen ryū als »Flammenwolke« aufschlägt, kann mit einer kreisförmigen Bewegung allein nicht erreicht werden. Nach Meister Aragaki wird die aus der kreisförmigen Bewegung gewonnene maximale Energie mit der geraden Linie über die kürzestmögliche Distanz übertragen. Diese Technik des japanischen Budō repräsentiert das höchste Niveau der Körperbeherrschung.

Foto 5

Foto 6

Foto 7
Fotos 5-7:Das Ausführen des Fauststoßes. Die Faust ist neben die Hüfte eingezogen (5). Sie dreht sich aus dieser eingezogenen Position heraus (6), und es erfolgt ein Stoß in gerader Linie (7).
Nicht das Abhärten der Fäuste, ihre Verwandlung in Waffen, macht den Unterschied zum chinesischen Kempō aus, sondern die Körperbeherrschung im Moment des Stoßens oder Tretens. Alle Techniken schließen den ganzen Körper ein. Betrachten wir die Stoßbewegung der Faust im Karate, so wird anders als beim geraden Schlag im Boxen der Schlag in einer vollständig geraden Linie geführt, indem sich die Faust aus der zurückgezogenen Position (hikite) herausdreht (Fotos 5-7). Auch die Tritte des Karate beschreiben im Gegensatz zum chinesischen Kempō oder zum Kickboxen keine großen Kreise. Der Tritt geht gerade ins Ziel. Dazu wird das Bein nach innen eingewinkelt nach oben geschwungen und auf diese Weise Energie aus der Kreisbewegung gewonnen. Dann wird ein geradliniger Stoß mit dem Fuß ausgeführt (siehe Fotos 8-10).

Foto 8

Foto 9

Foto 10
Fotos 8-10: Ausführung eines Fußtritts. Einnehmen derGrundstellung oder Bereitschaftshaltung (kamae) (8). Das Bein wird angewinkelt nach oben geschwungen (9). Der Tritt oder Fußstoß erfolgt in gerader Linie (10).
In den traditionellen Karate-Kata gibt es keine Halbkreisfußtritte (mawashi geri). Es gibt auch keine Tritte in der oberen Ebene (jōdan geri). Allerdings gibt es Sprungtritte (tobi geri), die jedoch nur als finale Fall- oder Selbstopferungstechnik (sutemi) zum Einsatz kommen. Tritte, die eine große Ellipse beschreiben, beeinträchtigen die Stabilität und legen die eigenen Schwachstellen bloß. Zudem sind sie für den Kampf mit einem Schwert-Gegner nicht schnell genug, und sie sind nicht für einen tödlichen ersten Tritt geeignet. Außerdem kann man Tritte häufig nicht wirksam gegen einen physisch stärkeren Gegner einsetzen.
 Foto 11
Foto 11
Foto 11: Mabuni Kenwa und sein Sohn Kenei bei der Übung des »Fallenden Baumes« (tōboku hō).
Es gibt eine für das japanische Budō spezielle Übung, die man »Fallender Baum« (tōboku hō) oder »zu Boden fallen« (tōchi hō) nennt. In dem oben erwähnten Buch »Die Essenz des okinawanischen Budō-Karate« von Meister Aragaki ist ein Foto abgebildet, das mich als Kind bei einer solchen Übung zeigt. Es stammt aus dem Buch meines Vaters von 1938 »Einführung in die Angriffs- und Abwehrtechniken im Karate«. Es zeigt, wie mein Vater mich stützt bzw. auffängt. Bei dieser Übung gewinnt der Körper seine Geschwindigkeit gleich einem fallenden Baum. Man bringt der Schwerkraft dabei keinerlei Widerstand entgegen. Dieses dem japanischen Budō eigentümliche Prinzip bezeichnet Aragaki als Gipfel menschlicher Körperbeherrschung. Mir persönlich gefällt die Formulierung, unter der die Technik im Itosu-Stil bekannt ist, am besten, auch wenn sie vielleicht nicht sehr wissenschaftlich ist. Man nennt sie hier »Kraft von der Erde leihen«.
Alle Anfänger im Itosu ryū beginnen ihre Studien mit den Kata des Shuri-te. Die Technik »Kraft von der Erde leihen« gehört zu den Übungen des ursprünglichen Okinawa-te, also zu den Grundlagen des Shuri-te. Der natürliche Fall wird durch die Kraft der Erde bewirkt. Ob man stößt oder tritt, immer wirkt diese Kraft, und man kann sie sich dabei zunutze machen. In allen Kata des Shuri-te wird das Prinzip des fallenden Baumes angewendet. Ob dieses Prinzip auch im heutigen Karate genutzt wird, ist eine Frage, zu der ich mich an anderer Stelle äußern möchte, wenn es um die Entwicklung des Karate zum Wettkampfsport geht.
Die Entwicklung des Naha-te
Das Naha-te soll seinen Ursprung im Dorf Kume haben. Kume wurde von Chinesen gegründet, die 1393, während der Ming-Dynastie, aus der chinesischen Provinz Fukien auf die Ryūkyū-Inseln gekommen waren.41 Unter ihren Nachkommen waren viele im Handel mit China tätig. Sie brachten Kempō-Kenntnisse aus ihrer chinesischen Heimat mit, die sie offenbar auch den Adligen von Kume vermittelten. Wahrscheinlich handelte es sich aber schon nicht mehr um reines chinesisches Kempō, sondern um eine vom Shuri-te beeinflußte und den auf Ryūkyū herrschenden Verhältnissen angepaßte Kampfkunst. Aragaki Seishō (1840-1920) aus Kume, der den Namen »Aragaki, die Katze« erhalten hatte, war ein großer Meister der Kampfkünste. Sowohl mein Vater, als auch Funakoshi Gichin und Miyagi Chōjun hatten bei ihm Unterricht. Er praktizierte nicht nur Karate, sondern auch bō-Techniken.
Higaonna Kanryō (1853-1916) hat ebenfalls bei Meister Aragaki Karate gelernt. Higaonna stammte aus einer Familie von Feuerholzhändlern aus Naha. Er muß sich durch besonderes Talent zum Kämpfen ausgezeichnet haben, da Aragaki ihn trotz seiner einfachen Herkunft Kempō lehrte, das eigentlich den Adligen aus Kume vorbehalten war. Er begab sich danach für 15 Jahre nach Fukien, studierte das dortige Kempō und entwickelte nach seiner Rückkehr das Naha-te. Deshalb ist das Naha-te jünger als das Shuri-te und der chinesische Einfluß noch stärker. Mein Vater sagte über das Karate von Higaonna: »Meister Higaonna war in China und hat dort das Fukien-Kempō studiert. Sein Unterricht ist anders als der heute sonst allgemein übliche.«
Während für das Shuri-te der Kampf auf Distanz charakteristisch ist, da man von einem Gegner mit Schwert ausgeht, ist das auf dem südchinesischen Kempō beruhende Naha-te auf den Nahkampf orientiert.
 Foto 12
Foto 12
 Foto 13
Foto 13
Fotos 12 und 13: Die hängende, auf- oder angelegte Hand (kake-te). Foto 12 zeigt die Technik des kake-te, wie sie im Shuri-te eingesetzt wurde, und Foto 13 zeigt dieselbe Technik bei ihrem Einsatz im Naha-te.
Es gibt keine Stöße und Tritte wie im Distanzkampf. Natürlich ist auch das Naha-te nicht reines chinesisches Kempō, sondern vom Shuri-te beeinflußt und weitgehend an die Bedingungen Okinawas angepaßt, aber seine Besonderheit sind die im chinesischen Kempō »Explosivkraft« (hakkei) oder »Kraft des Moments« (sunkei) genannten Techniken. Im Naha-te werden sie zuerst anhand der Basis-Kata Sanchin (»drei Phasen«) und Tenshō (»Handfläche drehen«) trainiert.
Im Naha-te gibt es eine Übung, die im Shuri-te nicht existiert. Bei dieser kontrahiert man mit einer besonderen Atemtechnik die gesamte Muskulatur des Körpers. Anfänger üben, indem sie langsam ein- und langsam ausatmen, dabei langsam die Faust in die Hüfte ziehen (hikite) und langsam nach vorn den Stoß ausführen. In Kampfsituationen erfolgen Stöße und Blöcke natürlich schneller.
Der oben genannte Ausdruck »Kraft des Augenblicks« (sunkei), d. h., explosive Kraft, bezeichnet die Harmonie von Atmung und Aktion, um die inneren Energien zu akkumulieren, die gesamte Körpermuskulatur in einem Augenblick zu kontrahieren und dann explosionsartig loszulassen. Gewöhnlich spricht man dabei von ki oder omoi.
 Foto 14
Foto 14
Foto 14: Analyse des kake te im Shuri-te: Die Hand blockt und greift.
In den modernen Kata lassen sich die Unterschiede zwischen dem Shuri-te und dem Naha-te kaum noch erkennen. Die ursprünglichen Stile unterscheiden sich aber deutlich voneinander. Das betrifft nicht nur die Prinzipien der Stöße und Tritte, sondern auch die konkreten Techniken. Als Beispiel soll hier die Blocktechnik der aufgelegten Hand, kake-te, dienen (siehe Fotos 12-15). Diese Technik existiert sowohl im Shuri-te als auch im Naha-te, aber die Anwendung unterscheidet sich. Im Shuri-te als Distanzkampf wird der vorstoßende Arm des Gegners auf Distanz abgefangen, und das Auflegen erfolgt mit einer greifenden und ziehenden Bewegung (Fotos 12 und 14). Im nahkampforientierten Naha-te dagegen ist die Distanz zum Gegner reduziert, und sein Angriff wird mit der hochgestellten Hand abgelenkt (Fotos 13 und 15).
 Foto 15
Foto 15
Foto 15: Analyse des kake te im Naha-te: Die Hand blockt und leitet den Angriff ab.
Der Ursprung des Tomari-te
Das früheste Tomari-te wurde nach der mündlichen Überlieferung »von einem Pilger, den man Anan42 nannte, von der chinesischen Provinz Shandong auf die Ryūkyū-Inseln gebracht«. Mehr weiß man darüber nicht. Als Ahnherr des neuzeitlichen Tomari-te gilt Matsumora Kōsaku (1829-1898). Er soll unter den Lehrern Teruya Kise (1804-1868) und Uku Karyū (1800-1850) gelernt haben, die ihrerseits Schüler des oben genannten Anan waren. Im Itosu-Karate gibt es viele Kata aus dem Tomari-te, die nach Matsumora benannt sind. Mehrheitlich sind diese dem Shuri-te nahe, gelegentlich aber auch dem Naha-te.
Shitō-Karate als Erbe des Okinawa-te
Das moderne Karate auf den japanischen Hauptinseln umfaßt vier große Strömungen: Shōtōkan ryū, Gōjū ryū, Wadō ryū und Shitō ryū. Der Shōtōkan-Stil beinhaltet einen Teil des Shuri-te. Der Gōjū-Stil beruht ausschließlich auf dem Naha-te. Der Wadō-Stil enthält darüber hinaus auch einen Teil des Shuri-te, allerdings als Jūjutsu arrangiert. Die einzige Richtung, die alle Stile des Okinawa-te enthält, ist das Shitō-Karate.
Auf Okinawa gibt es heute hingegen drei Hauptströmungen: Shōrin ryū, hervorgegangen aus dem Shuri-te, Gōjū ryū, entstanden auf Grundlage des Naha-te, und Uechi ryū, ein Stil, der das südchinesische Kempō repräsentiert. In letzterem sind die Grundmuster des chinesischen Kempō noch stärker präsent als im Naha-te. Meister Uechi Kanbun (1877-1948) entwickelte den nach ihm benannten Stil nach seiner Heimkehr von einem Studienaufenthalt in der Provinz Fukien. Meister Uechi ging Anfang der 20er Jahre auf die Hauptinseln und eröffnete in der Präfektur Wakayama einen Verein, in dem sein Stil trainiert wurde. Als mein Vater ebenfalls auf die Hauptinseln und in dieselbe Präfektur zog, kam es zu einem regen Austausch mit Uechi Kanbun, dem er freundschaftlich verbunden war. So wurden auch einige der Kata des Uechi-Stils in das Repertoire des Shitō ryū aufgenommen. Auf der Grundlage von Techniken, die Uechi Kanbun meinem Vater in Wakayama zeigte, entwickelte dieser die Kata Shimpā. Da diese Kata unvollständig geblieben war, habe ich sie nach dem Tod meines Vaters vervollständigt.
 Foto 16: Uechi Kanbun (1877-1948)
Foto 16: Uechi Kanbun (1877-1948)
Uechi Kanbuns Sohn und Nachfolger, Meister Uechi Kanei (1911-1991), wohnte in Ōsaka, in der Nähe des Bezirks Nishinari. Ich erinnere mich, daß ich kurz nach meiner Ankunft in Ōsaka einen Okinawa-Heimatverein in Nishinari besuchte, in dessen Räumlichkeiten regelmäßig unter seiner Leitung trainiert wurde.
2 Shitō-Karate – die Lehren des Mabuni Kenwa
2.1 »Gefangen« in der Welt des Budō
Das Streben nach einem gesunden Körper
Vor einiger Zeit weilte ich als Trainingsleiter in Indien. Eines Tages kam einer meiner dortigen Studenten zu mir und berichtete voller Freude, sein Sohn, der schon seit dem sechsten Lebensjahr trainiere, habe nun den schwarzen Gürtel bekommen. Ich freute mich auch darüber und wir kamen ins Gespräch. Dabei fragte er mich, wann ich denn mit dem Karate begonnen hätte. Ich antwortete lachend, ich hätte wohl schon im Mutterleib treten geübt. Und das war genaugenommen mehr als nur ein Scherz. Denn dort, wo ich im Mutterleib war, war auch immer mein Vater irgendwo in unmittelbarer Nähe und trainierte mit wilder Energie sein Karate. Das hat mich wohl schon vor der Geburt erzogen. Ich wurde buchstäblich in eine Karate-Welt hineingeboren und wuchs in ihr auf. Nachdem mein Vater im Jahre 1952 mit nur 63 Jahren verstorben war, trainierte ich vier Stunden täglich ohne Unterbrechung, und auch heute ist Karate eigentlich alles, woran ich denken und worüber ich nachdenken kann.
Mein Vater wurde 1889 in der Stadt Shuri in der Präfektur Okinawa geboren. Einer seiner Vorfahren war Ōshiro Kenyū, ein Feudalherr (daimyō) im alten Ryūkyū-Königreich, der wegen seiner Tapferkeit berühmt war und »Ōshiro der Dämon« genannt wurde. Er gehörte zum Sippenverband der Ka (Ka Uji). Auf Okinawa hat jeder ein Zeichen in seinem Namen, das die Sippenzugehörigkeit signalisiert. Für die Mitglieder der Ka-Sippe ist es das Zeichen mit der Bedeutung »klug« und der Lesung »ken«. Die Familie Mabuni ist die Hauptfamilie des Verbandes, dessen legitimer Erbe in der 18. Generation ich bin. Da ich als Familienvorstand in Ōsaka lebe, haben die Familien der Ka-Sippe einen Verein gebildet, der sich um die Pflege des Sippenschreins kümmert.
Mein Vater war in seiner Kindheit extrem schwach. Die Familie machte sich deshalb große Sorgen. Bei jeder Gelegenheit erzählten sie ihm deshalb die Geschichten von seinem tapferen Vorfahren. Offenbar haben diese Erzählungen meinen Vater damals sehr beeindruckt, denn schon als kleines Kind soll er den Entschluß gefaßt haben, nach einem gesunden und starken Körper zu streben.
Ein Leben frei von Habsucht
Nach Abschluß der Mittelschule absolvierte mein Vater seinen Wehrdienst. Danach wurde er Polizist. Aber mehr als jeder andere engagierte er sich für sein geliebtes Karate-Training. Oft erzählte mein Vater, wie sehr ihm das Karate bei der Arbeit, bei der Festnahme von Verbrechern oder in anderen Situationen geholfen habe.
Um von seinem Karatelehrer angenommen zu werden, mußte er einflußreiche Bürgen vorweisen und nach mehrfacher Prüfung seines Entschlusses vor dem buddhistischen Altar Räucherstäbchen entzünden, lange starr davor sitzen und einen Schwur leisten, seine Fähigkeiten in den Kampfkünsten nie zu mißbrauchen. Damals konnte man noch nicht frei seinen Lehrer wählen und einfach in einen Karateverein eintreten. Man könnte sagen, daß zu jener Zeit gewissermaßen das Karate sich die Leute aussuchte, von denen es studiert werden wollte.
Da mein Vater als Polizist viel herumkam, boten sich ihm auch häufig Gelegenheiten, andere Arten des Budō kennenzulernen. So konnte er von Experten, die irgendwo in den Dörfern lebten, nicht nur Shuri-te oder Naha-te, sondern auch andere, lokale Karatearten und alte Kata lernen.
Mein Vater war ein charaktervoller Mann. Er war großzügig, kam gut mit den Leuten zurecht und war allgemein beliebt. Er war ohne Habgier und selbstlos. Oft half er Leuten, die in Schwierigkeiten waren, und hin und wieder geriet er deshalb später selbst in Not. Seine Großzügigkeit scheint er von seinem eigenen Vater geerbt zu haben. Nach der Abschaffung der feudalen Domänen und der Einführung der Präfekturverwaltung zu Beginn der Meiji-Ära, Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, wurde die Familie Mabuni in ihrem Adelsstand in der neuen Ordnung bestätigt. Mein Großvater erhielt von der Regierung eine finanzielle Entschädigung, mit der er ein Süßwarengeschäft gründete. Aber dieser Laden ging bald bankrott, weil, wie man scherzhaft sagte, mein Großvater die Süßigkeiten allzu großherzig an all seine Freunde verschenkt hatte.
Mein Vater hatte keine besonderen Talente. Auch mochte er weder das Go- noch das Schachspiel, und er interessierte sich nicht für Wetten. Seit seinen mittleren Lebensjahren trank er keinen Alkohol mehr. Aber er mochte Zigaretten. Seine Lieblingsmarke war Golden Bat.43 Da kurz nach dem Krieg alles rationiert war, waren auch Genußmittel knapp, und man bekam natürlich kaum Zigaretten. Wenn mein Vater gelegentlich welche bekam, teilte er sie mit seinen Schülern und reichte seine Schachtel herum, selbst wenn für ihn am Ende keine mehr übrig blieb. Auf Geld und Dinge war mein Vater wirklich nicht begierig.
Das einzige wonach er gierig war, war Budō. Wahrscheinlich trieb ihn auch die unbewußte Sorge, daß unter dem Ansturm der Wellen der Modernisierung auch das Okinawa-te verschwinden könnte. Überall auf Okinawa studierte er die überlieferten Techniken. Mittlerweile gibt es viele Persönlichkeiten, die den Beitrag meines Vaters zur Bewahrung des traditionellen okinawanischen Kulturgutes anerkennen und hochschätzen. Es ist sehr bedauerlich, daß heute bereits 70 Prozent der Kata, die mein Vater studiert hatte, sogar auf Okinawa verlorengegangen sind.
Kanō Jigorōs Lob
Die Leidenschaft meines Vaters für das Karate ließ nicht einen Tag nach. 1918, im Jahre meiner Geburt, gründete er in seiner Wohnung eine »Karate-Studiengesellschaft«. Mein Vater war damals 29. Den ganzen Tag lang herrschte in unserem Haus ein Kommen und Gehen von Leuten, die etwas mit Karate zu tun hatten. Schon als kleines Kind, seit ich einigermaßen verstehen konnte, worum es ging, saß ich immer an der Seite und sah dem Unterricht meines Vaters zu. Ich erinnere mich noch gut daran, daß mich oft Besucher Kata nachahmen ließen und ich als Belohnung von ihnen Süßigkeiten bekam. Wenn mein Vater an Schulen unterrichtete oder zu Budō-Vorführungen ging, nahm er mich meistens mit. Wie der »Novize vor dem Tempeltor« die heiligen Bücher kennenlernt, ohne sie studiert zu haben, so lernte ich Karate, ohne es zu trainieren.
 Foto 17:Kanō Jigorō (1860-1938).
Foto 17:Kanō Jigorō (1860-1938).
Mein Vater schied schließlich aus dem Polizeidienst aus und wurde 1924 Karate-Lehrer an der Fischereischule von Okinawa, am Lehrerseminar und an der Polizeischule. Im darauffolgenden Jahr gründete er den »Okinawa Karate Studienclub«, und er eröffnete sein erstes dōjō und begann mit der Ausbildung von eigenen Schülern. Das dōjō lag gleich hinter unserem Haus und war aufs beste mit allen für Okinawa typischen Trainings-Gerätschaften ausgestattet. Außer meinem Vater unterrichteten hier u. a. Miyagi Chōjun, Kyoda Jūhatsu, Motobu Chōyū, Hanashiro Chōmo, Ōshiro Chōjo, Chibana Chōshin und Go Kenki, der ein Meister des chinesischen Kempō war. Hier war wirklich die Elite des modernen Karate versammelt.
Im Jahre 1921 besuchten die Prinzen Kuninomiya und Kachōnomiya Okinawa und im Jahre 1925 Prinz Chichibunomiya. Sie gaben meinem Vater und seinen Kollegen die Ehre, sich deren Karatevorführungen anzusehen. Eines Tages im Jahre 1927, mein Vater und andere Lehrer waren gerade dabei, den Trainingsplan zu besprechen, erschien Kanō Jigorō (1860-1938), der Begründer des Jūdō, um zur Eröffnungsfeier des »Vereins der okinawanischen Jūdō-Danträger« einzuladen. Bei dieser Gelegenheit führten Miyagi Chōjun und mein Vater Karate vor und gaben einige Erläuterungen dazu. Meister Kanō war davon sehr beeindruckt und sagte: »Eine universale Kampfkunst, geeignet für Angriff und Verteidigung. Ein so ideales Budō muß im ganzen Land verbreitet werden.«