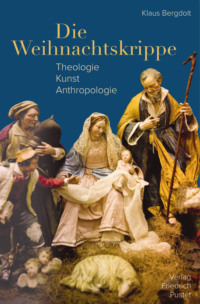Kitabı oku: «Die Weihnachtskrippe», sayfa 2
Theologische Herausforderungen
Spätestens im frühen 4. Jahrhundert war auch Christi Geburt ein zentrales Motiv christlicher Kunst. Nicht nur seine symbolgetragenen Wunder und seine Auferstehung beschäftigten die Theologen, sondern auch die Menschwerdung des Erlösers, der zugleich Gott blieb. Dieses Faktum, für viele eine provokante These, die aller tradierter Logik widersprach, wurde jahrhundertelang in aller Schärfe diskutiert. Gott sollte Mensch geworden sein – war dieses für Anhänger wie Gegner des Christentums absurde Paradoxon überhaupt denkbar? Nie in der Geschichte der antiken Völker hatte es Vergleichbares gegeben, nie war Gott bzw. ein göttliches Wesen wie in Betlehem als hilfloses Wesen mit menschlichen Eigenschaften sichtbar geworden. Es kann nicht verwundern, dass es hier zu Disputen kam, die vorübergehend sogar zur Spaltung der noch jungen Kirche führten. Es wurde auf schmerzliche Weise klar, dass eine Interpretation gewisser Passagen des Alten und Neuen Testaments, selbst wenn sie, wie man später sagte, „historisch-kritisch“ intendiert war, auf unterschiedliche Weise möglich war (ein Phänomen, auf das im 18. Jahrhundert der französische Geistliche Richard Simon hinwies!).11 Der Kirchenvater Johannes Chrysostomos (um 400) forderte sogar – eine ungeheure Provokation des intellektuellen Umfelds! – die meditative Versenkung in den Stall von Betlehem, „damit wir unseren Herrn in Windeln in der Krippe liegen sehen“. Auch dies war eine Zumutung, ging es doch scheinbar darum, rationales Denken – wenn auch nur exklusiv in dieser Sache – zumindest zu relativieren. Man darf hier daran erinnern, dass bekannte Stoiker wie Seneca und Kaiser Mark Aurel ihre ganze Kraft darangesetzt hatten, dem Leib – verächtlich nannte man ihn „Fleisch“ (σαρκίδιον) oder „Körperchen“ (σωμάτιον) – geistig zu entfliehen. Dasselbe Ziel verfochten auch zahlreiche zeitgenössische Mysterienreligionen, die auf die „Befreiung“ vom „Gefängnis“ des Körpers setzten. Und nun sollte sich in Betlehem der höchste Logos, also Gott, umgekehrt vom Geistigen ins Körperliche „inkarniert“ haben? Im Westen ermahnte auch Hieronymus, ein Zeitgenosse des Johannes Chrysostomos, die Gläubigen, sich das Weihnachtsgeschehen zunächst einmal sinnlich zu vergegenwärtigen. Beide Kirchenväter, der östliche wie der westliche, betonten damit, dass der Sohn Gottes, ungeachtet seiner göttlichen Natur ganz und gar Mensch geworden sei. Gerade deshalb erschien die Vorstellung des kleinen, hilflosen „Christkinds“ emotional so berührend. Ungeachtet ihrer Bekanntheit, die in der westlichen Gesellschaft allerdings, wie Umfragen im studentischen Umfeld ergaben, rasant abnimmt, sei die berühmte Passage aus dem Lukasevangelium (Lk 2,1–20) hier noch einmal wiedergegeben:
In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reichs in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter in Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt. Denn er war aus dem Hause und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davidas der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen und sehen, was uns der Herr verkünden ließ: So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, die zuhörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrt alles, was geschehen war, in ihrem Herzen auf und dachte darüber nach. Die Hirten aber kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gesehen hatten.
So vertraut diese Geschichte Generationen von Christen später erschien – in einer Zeit, wo die meisten Gläubigen, gerade auch im Judentum, das Göttliche mit der Vorstellung grenzenloser Allmacht verbanden, der man Zorn und Rache, freilich auch Gerechtigkeit und Weisheit zuordnete, musste sie im wahrsten Sinn des Wortes unglaublich erscheinen. Nicht nur dem Gott des Alten Bundes, auch den griechisch-römischen Gottheiten war man über Jahrhunderte zitternd und furchtsam entgegengetreten. Der reaktive Tremor, das „furchtsame Zittern“ – es blieb im Christentum, wie auch Blitz und Donner, für das Jüngste Gericht reserviert –, stellte eine angemessene Reaktion auf das Unbegreifliche dar, die Begegnung mit dem göttlichen Numen ließ jede Alltagserfahrung versagen. So scheinbar menschlich es in der homerischen Götterwelt zugegangen war, so dreist sich etwa Zeus seinen Geliebten genähert hatte, es war allein schon der Rahmen der Mythologie, der die geziemende Distanz garantierte. Auch Osiris war, um ein in der Antike bekanntes Beispiel anzuführen, als Sohn der Isis eine haptisch wie optisch unfassbare Gottheit geblieben, nur seinen Priestern auf mystisch-geheimnisvolle Weise zugänglich. Ebenso blieb die altbabylonische bzw. assyrische Heilige Hochzeit (ἱερός γάμος), die Vereinigung von Mensch und Gott, den Gläubigen durch Liturgie und kultische Feiern weit entrückt, zumal sie im Adyton, dem unzugänglichen Teil der Tempel, stattfand. Es war deshalb mehr als verständlich, dass viele Gelehrte skeptisch blieben, was die göttliche Natur des Kindes von Betlehem betraf. Für wie ungebührlich, ja gefährlich man den Anblick des Göttlichen hielt, zeigte exemplarisch die von Plutarch (Plutarch, Isis und Osiris C 9) überlieferte Geschichte vom Jüngling von Sais: Dieser hatte, von Neugier übermannt, im Tempel der Isis zwar die göttliche Wahrheit entschleiert, musste dafür aber sterben („Ihn trieb ein tiefer Gram zum frühen Grabe“). Schiller bearbeitete das Thema später in der bekannten Ballade, wo die Hinterfragung von Mysterien, d. h. die Suche nach dem, was die Welt zusammenhält – in der Aufklärung war sie programmatisch geworden –, überraschenderweise sehr kritisch gesehen wurde. Jan Assmann sieht den Mythos des Jünglings von Sais sogar als Vorbild der jüdischen Bilderfeindlichkeit.12
Die Hirten von Betlehem begegneten dem göttlichen Kind dagegen ohne Angst und Zittern, ja mit menschlicher Neugier, die bald in Freude umschlug. Das Mysterium tremendum (Rudolf Otto), das die Gottheiten aller Religionen auszeichnete und, kam es zur Begegnung mit Sterblichen, Schrecken hervorrief, war im christlichen Umfeld zu einem Mysterium fascinans geworden, das alle Befangenheit nahm und allein Ehrfurcht einforderte. Während der alttestamentliche Gott stets unsichtbar blieb – Mose hörte im Brennenden Dornbusch allein seine Stimme (Ex 3,4–6) und der Held Gideon sowie Manoach, der Vater Simsons, hatten schon den Anblick seines Engels für tödlich gehalten (Ri 6,22; 13,22) – lag dessen Inkarnation, sein göttlicher Sohn, nun in einer banalen Futterkrippe. Dieses Phänomen war, die frühen Theologen fanden dafür keine andere Erklärung, nur möglich geworden, weil dieser sich nach dem Willen des Vaters – gemessen an der Skala menschlicher Eitelkeiten und Hierarchien auf geradezu unerträgliche Weise – erniedrigt hatte. Nach dem Zeugnis des Origenes soll Ignatius von Antiochien sogar die Meinung vertreten haben, Gott habe durch die ärmlich-weltlichen Umstände der Geburt seines Sohnes den „Fürsten der Welt“ täuschen wollen. Wäre diesem die Göttlichkeit des Kindes bekannt gewesen, hätten satanische Mächte, folgen wir dem Autor des 2. Jahrhunderts, von Anfang an mit allen Kräften den Heilsplan Christi zu zerstören versucht (Homilie 6, 5). Taucht in manchen Krippenszenerien, für viele etwas überraschend und scheinbar unbiblisch, im Hintergrund auch der Teufel auf, entspricht dies jedenfalls nicht nur künstlerischer Fantasie, sondern uralten theologischen Überlegungen!
Was sich aus christlicher Sicht in Betlehem ereignete, war das Gegenteil von allem, was aus der Erfahrung der heidnischen, aber auch jüdischen Antike heraus – sah man von der Messiasprophezeiung (vgl. etwa Jes 7,14) einmal ab – für möglich gehalten worden war. Es war so verständlich, dass sich bei gebildeten Christen, wenn sie an die altbekannten philosophischen Narrative dachten, unwillkürlich die Vermutung aufdrängte, dass, wie etwa Apollinaris von Laodikea, der Bischof der Konzilsstadt Nikaia, um 360 schrieb, Christus nur einen Scheinleib, d. h. keine wirklich menschliche Physis besessen habe und somit in der Krippe, entgegen dem optischen Eindruck, nur über eine Natur, nämlich die göttliche, verfüge. Waren Hirten und Weise nicht einfach, vielleicht sogar durch den Willen des Vaters, durch eine „weltliche Performance“ getäuscht worden? Hatte sich Gott in Betlehem nur eine menschliche Maske übergestülpt? Seit dem 4. Jahrhundert bestimmte diese Frage, ob Christus nur Gott oder eben Gott und Mensch war, in Ost und West die innerchristliche Diskussion. Beide Positionen ließen sich mit gewichtigen Argumenten stützen. Für den monophysitischen Bischof Kyrill von Alexandrien (ca. 375–440) konnte, um eine gewichtige, in der Kirchengeschichte allerdings umstrittene Stimme zu zitieren, nur ein rein göttliches, von menschlicher Unreinheit unbeflecktes Wesen die Erlösung der Menschheit bewerkstelligen – eine menschliche Komponente hätte, so seine durchaus plausible These, die hierfür notwendige Allmacht zu sehr beeinträchtigt. Schließlich dogmatisierte das Konzil von Chalkedon (451) nach erbitterten Auseinandersetzungen die Zweinaturenlehre des Erlösers, nachdem lange Zeit die Doktrin des Monophysitismus – im Sinne einer „geistigen“ Vereinigung seiner menschlichen und göttlichen Natur (Miaphysitismus) – im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden hatte. Der zuvor von den Konzilien von Nikaia (325) und Konstantinopel (381) entwickelte Glaubenssatz, Christus sei schon „vor allen Zeiten aus dem Vater geboren“ worden (ex patre natum ante omnia saecula) und mit ihm „eines Wesens“ (consubstantialis), wurde bestätigt. Er sei, argumentierten die Konzilsväter, „wegen uns Menschen“ zwar nach dem Willen des Vaters, doch wie Paulus im Philipperbrief betont (Phil 2,6–11), dennoch freiwillig in die Welt gekommen und „nahm durch den Heiligen Geist Fleisch an“. Wir wissen heute, dass um jeden Satz und jedes Wort gestritten wurde. Die Mehrheit der Konzilsväter war am Ende der Meinung, dass zwischen Gott und Christus substantiell kein Unterschied sei. Für diese Vorstellung hatten schon Paulus und einflussreiche Theologen wie Irenäus von Lyon (2. Jh.) plädiert. „Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott“ lautete deshalb eine der zentralen Passagen des Glaubensbekenntnisses. Christus habe, wie Karl Lehmann in seinem Buch „Weihnachten“ herausstellt, seine Rolle als „Licht in der Finsternis“ (vgl. etwa Joh 8,12) immer wieder betont. Dieses hochsymbolische Bild beschäftigt die Theologen bis heute.13
Die künstlerische Darstellung des Kindes in der Krippe und der Verkündigung an die Hirten, aber auch von Ochs und Esel, deren früh herausgestellte Symbolik auf ein Wort des Jesaja zurückgeht („Es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn“, Jes 1,3), erfreute sich ungeachtet der heftigen Diskussionen, vielleicht aber auch aufgrund der damit verbundenen theologischen Dynamik rasch großer Beliebtheit. Während man die Evangelientexte las oder, etwa in den Katakomben, einschlägige Abbildungen betrachtete, dachte man eo ipso über Grundfragen des neuen Glaubens nach, der sich schon vor dem Toleranzedikt Konstantins (313) in Italien und Gallien, aber auch in Kleinasien, Armenien, Syrien, Ägypten und Nordafrika erstaunlich rasch ausbreitete. Wie dies möglich war, warum das Christentum „überlebte“, wurde von vielen katholischen und protestantischen Kirchenhistorikern des 19. und 20. Jahrhunderts, aber auch schon von heidnischen und frühchristlichen Zeitgenossen leidenschaftlich diskutiert.14 Während die spätantike Kultur mit ihren zahllosen politischen und religiösen Strömungen spätestens im 6. Jahrhundert untergegangen war, überstand das Christentum, dem einst der kaiserliche Statthalter in Bithynien, jedenfalls nach dem Zeugnis des Plinius (Ep. X, 96,8), nur „wüsten, maßlosen Aberglauben“ (superstitionem pravam, immodicam) unterstellt hatte, alle Krisen. Der katholische Schriftsteller Martin Mosebach sah gerade im Theologenstreit des 3. und 4. Jahrhunderts, der – in der Wissenschaft war dies schon damals üblich – mancherorts zu geradezu hasserfülltem Konkurrenzdenken führte, eine Stärkung des Christentums. Zwar meditierten auch Einsiedler und einfache Mönche über die Epiphanie Christi, doch führten erst die Dispute in Rom, Alexandria, Antiochia, Smyrna oder Karthago zu jener Schärfung des Denkens und Kühnheit der Argumente, die den christlichen Intellektualismus begründeten.15 Was Christi Geburt anging, setzte sich letztlich zwar das Dogma der „Zweinaturenlehre“ durch, wonach Christus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war. Doch hatten die in den Konzilien unterlegenen arianischen bzw. monophysitischen Theologien, so Mosebachs These, ebenfalls exzellente Argumente zur Hand. Beide Positionen waren logisch und plausibel, beide durch Schriftstellen gut belegt, galten am Ende aber als häretisch. Zum Dogma erhoben wurde letztendlich ein Axiom, das auf den ersten Blick der üblichen Logik und Beweise entbehrte. Es führte immerhin zur Exkommunizierung des Patriarchen von Konstantinopel, Nestorius, des wohl einflussreichsten Monotheisten überhaupt, durch das Konzil von Ephesus. Er war dort mit seinem Vorschlag, Maria nur als „Christusgebärerin“ (Χριστóτοκος) zu verehren, gescheitert. Von Nestorius wurde auch die Bemerkung kolportiert, „er könne einen zwei oder drei Monate alten Gott nicht anerkennen“. Er bestritt die Wesensgleichheit Christi und des Vaters und stellte sich damit, zumindest nach Meinung seiner Gegner, gegen das 325 vom ersten Konzil von Nikaia verabschiedete Glaubensbekenntnis.16
Es bleibt bemerkenswert, wie Bibelstellen, die der Jungfräulichkeit der Gottesmutter und der Degradierung Josefs zum bloßen „Nährvater“ zu widersprechen scheinen, im Lauf der Jahrhunderte unterschiedlich gedeutet wurden. Schon die palästinensische Urgemeinde war hier offensichtlich unsicher. War Jesus nicht doch der Sohn Josefs? Paulus, der ja vor den Evangelisten schrieb, hatte ihn zwar als Sohn Gottes bezeichnet, doch sprach Markus eine Generation später schlicht vom Menschensohn. Stammt der „Sohn Davids“, wie die bei Matthäus und Lukas überlieferten Stammbäume zeigten (Mt 1,16, Lk 3,23–38), nicht über Josef von dem altisraelitischen König ab? Wurde Jesus bei Lukas als „Erstgeborener“ bezeichnet, deutete dies zudem auf weitere, „natürlich“ gezeugte Kinder Josefs und Marias hin, ebenso wenn – und das war ein besonders gewichtiges Argument – Johannes (Joh 1,45) von „Jesus, Josefs Sohn“ sprach. Im gleichen Sinn lesen wir bei Matthäus (13,55): „Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder Jakobus, Joses, Simon, Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle drei bei uns?“ Dass diese Auffassung in den frühen Christengemeinden sehr verbreitet war, ist unbestritten. Schon in der Spätantike kam allerdings die Vorstellung auf, dass die „Geschwister Jesu“ einer ersten Ehe Josefs mit einer gewissen Salome entstammten (entsprechend wurden sie mit ihrer Mutter auf zahlreichen spätgotischen Altären in die „Heilige Sippe“ eingereiht). Johannes Chrysostomos (4. Jh.) vertrat dagegen die bekanntere, von der modernen Theologie heftig bekämpfte These, dass der Begriff Brüder (ἀδελφοί) Christi sich auf seine Vettern bzw. Verwandten bezogen haben muss.17 Demgegenüber hieß es im Markusevangelium, das heute als das älteste gilt: „Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn?“, während Josef unerwähnt bleibt (Mk 6,3). Wegweisend schien den Kirchenvätern einmal mehr das Alte Testament, wo Jahwe über David sagt: „Zum Erstgeborenen will ich ihn machen“ (Ps 89,28). Könnte sich dieses Attribut nicht, fragten scharfsinnige Theologen, möglicherweise vorausweisend auf Jesus, den Messias bezogen haben? War David nicht dessen berühmtester Vorfahr? Auch in Psalm 2,7 findet sich eine in diese Richtung weisende Bemerkung: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“. Bezog man die Geburt Jesu auf solche Bibelstellen, verblieb Josef tatsächlich nur die Rolle als „Nährvater“. Psychologisch einfühlsam wird, was Skeptiker trösten konnte, im Matthäusevangelium berichtet, wie er selbst an der jungfräulichen Empfängnis Mariens zweifelte und sie deshalb gekränkt und enttäuscht verlassen wollte. Allein das Wort des Engels „Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, denn was in ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist“ (Mt 1,20) konnte ihn davon abhalten.
Spätestens seit dem 2. Jahrhundert beeinflussten nicht nur die bekannten Passagen der kanonisierten und nicht kanonisierten Evangelien, sondern auch theologische Kommentare sowie dogmatische Einflüsse die Exegese der Bibeltexte und somit die bildende Kunst. Neben Origenes und Tertullian (um 200) wäre hier besonders Augustinus (um 400) zu erwähnen, der daran erinnerte, dass Christus – wie hätte es, setzt man dessen Göttlichkeit voraus, anders sein können! – niemals durch männlich-menschliche Zeugung, sondern allein durch eine Jungfrau geboren sein konnte (Sermo 196,1). Die wichtigste Weissagung findet sich freilich in der Weihnachtsgeschichte selbst, wo der Engel Josef weiter erklärte:
Sie [Maria] wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von den Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. (Mt 1,21–24)
Schien die Botschaft von der jungfräulichen Geburt Christi damit nicht von Gott selbst besiegelt? In der alttestamentlichen Bibelstelle (Jes 7,14), auf die sich der Engel bezog, hatte Gott dem König Ahas in einer Notsituation – er war von Feinden umringt – die von Matthäus zitierte Jungfrauengeburt geweissagt. Spätere Exegeten vermuteten hier eine irrtümliche griechische Übersetzung des hebräischen Wortes alma als „Jungfrau“ (in der Septuaginta als παρθένος und, hierauf basierend, in der Vulgata lateinisch als virgo). Alma könne nämlich, so vor allem protestantische Kritiker des 20. Jahrhunderts, auch junge Frau bedeuten. Immerhin handelte es sich bei der Jesaja-Stelle um die Ankündigung eines Wunders, das dem König Israels in einer speziellen Gefahr Rettung versprach. War nicht auch Christus, konnte man sich fragen, als wundersamer Retter erschienen? Interessanterweise umging Papst Benedikt XVI. die bis heute nicht eindeutig geklärte Frage, indem er in seiner berühmten Regensburger Rede (2006) die Septuaginta als „selbstständigen Textzeugen“ und „wichtigen Schritt der Offenbarungsgeschichte“ bezeichnete.18 Auch Justin der Märtyrer sprach schon im 2. Jahrhundert von der Jungfräulichkeit Mariens (Dialogus cum Tryphone Judaeo 100), die als „neue Eva“ den Sündenfall der „alten“ gleichsam korrigiert habe. Viele Symbole des Alten Testaments schienen auf die Jungfräulichkeit der Mutter Jesu anzuspielen, etwa die Verschlossene Pforte (Ez 44,2) oder der im Hohelied (Hld 4,2) erwähnte Hortus conclusus. Bis zum Konzil von Ephesus (431) wurde die virginitas Mariens immer wieder infrage gestellt, aber auch verteidigt. Clemens von Alexandria sah die Mutter Christi ebenfalls als Jungfrau (Stromateis VIII,16), ebenso – eine Stimme unter vielen – Gregor von Nyssa (Homilia in Cant. 13). Auch die Vorstellung einer virginitas in partu, wonach Maria nur bei der Geburt Christi Jungfrau war und später weitere Kinder bekommen haben soll, und einer virginitas post partum, die implizierte, dass sie auch danach Jungfrau blieb (etwa Origenes, Com. in Mt 10,17, Hieronymus, Ad Helv. 17, Johannes Chrysostomos, Hom. in Mt 5,2f.) spaltete die Kirchenväter. Immerhin hielt, um dieses Kapitel abzuschließen, noch der protestantische Theologe Karl Barth die Lehre von der Jungfräulichkeit Mariens für einen substantiellen Teil des christlichen Glaubens (1927). Er konnte hier sogar, was manchen überraschen mag, auf Luther und Zwingli verweisen (!)19
Aus religionswissenschaftlicher Sicht muss hier erwähnt werden, dass auch babylonische Könige und griechische Helden oft genug, ja in der Regel auf nicht natürliche Weise von Göttern gezeugt wurden. Zeus’ Geburt aus Rhea in tiefer Nacht in einer kretischen Höhle, die Geburt göttlicher Kinder überhaupt, etwa des ägyptischen Horusknaben, waren den Gebildeten wohl bekannt. In Paphos auf Zypern blieb ein Dionysos-Mosaik des 4. Jahrhunderts erhalten, das die Geburt des Gottes auf dem Berg Nysa zeigt. Das neugeborene Kind thront auf dem Schoß seiner Mutter Persephone wie kurze Zeit später Christus auf frühen Fresken auf dem Schoß Mariens. Auch Dionysos, Attis, Mithras und Perseus wurden, folgt man dem Mythos, aus einer Jungfrau geboren. Parallelen dieser Art sprachen aus frühchristlicher Sicht, wie wir sehen werden (S. 50–52), nicht etwa gegen, sondern für die Jungfräulichkeit Mariens. All diese Geburten heidnischer Heroen oder Götter blieben freilich geheimnisvoll entrückt, wie es der Göttlichkeit der Protagonisten entsprach. Jesu Geburt stellte dagegen eine unverhüllte Ausnahme dar.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.