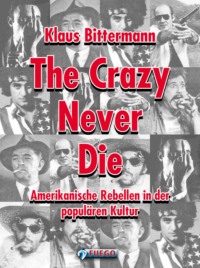Kitabı oku: «The Crazy Never Die», sayfa 3
Farewell my Lovely
Einer der vielleicht dutzend Filme, die bleiben werden und die ein bißchen mehr zu bieten hatten als die Gorillas, die ihn niederschlugen, war zweifellos »Farewell My Lovely«. Der Regisseur Dick Richards war keine Berühmtheit. Er hatte vorher als Photograph für Look und Life gearbeitet und zwei Filme gemacht, aber es war die Zeit vieler junger und aufstrebender Filmemacher. Dick Richards war der am wenigsten interessante. Ähnlich wie bei »Casablanca« deutete nichts darauf hin, daß »Farewell My Lovely« wenn nicht Filmgeschichte machen so doch immerhin sehr erfolgreich sein würde. Und er wurde es, weil Richards keine Experimente machte, sondern den klassischen Regeln des Filmgenres folgte und ganz nach dem Muster von Roman Polanskis »Chinatown« mit Jack Nicholson in der Hauptrolle drehte, und dieser ein Jahr zuvor entstandene Film war nicht umsonst so gut wie in allen Kategorien für den Oscar nominiert worden und hatte fürs Drehbuch auch einen bekommen.
Eine kluge Entscheidung war es, das Stück in Los Angeles Ende der Dreißiger spielen zu lassen, also an dem Ort und zu der Zeit, in denen auch der Roman Chandlers spielt. Als wegen des Erfolgs mit »The Big Sleep« eine weitere Chandler-Geschichte verfilmt wurde, verlegte der Regisseur Michael Winner das Ganze ins zeitgenössische London, weil, wie er glaubte, Chandler in seinem Stil einfach sehr britisch sei, womit er Recht hatte. Aber nach London paßte Robert Mitchum ungefähr so hin wie eine »Tarantel auf einem Käsekuchen«, das hätte vermutlich Raymond Chandler sich gedacht, wenn er noch gelebt hätte, und auch James Stewart sagte, er könne General Sternwood nicht spielen, weil die Rolle für einen Engländer geschrieben sei.
Eine weitere kluge Entscheidung war es, den Drehbuchautor David Zelag Goodman zu engagieren. Der fühlte sich jedenfalls nicht berufen, Chandler neu zu interpretieren oder, wie es Edward Dmytryk 1944 in »Murder My Sweet« getan hatte, ein Script zu nehmen, das die Geschichte noch verwirrender machte als die Vorlage. Goodman bediente sich ausgiebig beim Original, sowohl was die Dialoge als auch den Erzähler aus dem Off betraf. Außerdem gelang es Goodman, Stringenz und Logik in die Geschichte zu kriegen, denn wie Chandler einmal selber schrieb: »Die Handlung ächzt und knarzt wie ein kaputter Fensterladen im Oktoberwind.« Der Roman ist episodisch, verschlungen, kompliziert und widersprüchlich, eine Figur nach der anderen taucht auf und verabschiedet sich wieder, aber im Gegensatz zu Chandlers Kollegen, die ihre blassen Figuren durch ein perfekt konstruiertes Handlungsgerüst hindurchjagen, sind es gerade der Witz, der elegante Stil und der leichte, beschwingte Ton, die seine Bücher vom üblichen Krimikram wohltuend abheben.
Goodman bewahrte den Chandlerschen Stil und besserte die Handlung vorsichtig aus. Indem er sie straffte, einige überflüssige Figuren über Bord warf, andere Charaktere hinzu erfand und sich auf den Kern der Geschichte konzentrierte, wurden auch die Protagonisten glaubwürdig und tapsten nicht unbeholfen durch die Straßen von Los Angeles, ständig mit der Frage beschäftigt, was tue ich eigentlich hier. Beispielsweise erfindet Goodman den Zeitungsmann, der zwar etwas schlicht, aber als einziger nicht korrupt ist, eine Mischung aus Freund und Faktotum ist er Marlowes Mann für besondere Aufgaben, dem er vorbehaltlos vertrauen kann. Auch der lungenkranke Trompeter und sein farbiger Sohn sind neu und treiben die Geschichte voran. Die beste Idee war es jedoch, Moose Malloy mehr in Szene zu setzen. Bei Chandler ist der Riese zunächst nicht mehr als ein unangenehmer Geck und Sprücheklopfer, der erst am Schluß zum tragischen Helden wird, zum romantischen Verlierer. Bei Goodman bekommt Moose Malloy, der ungefähr so groß ist wie die Freiheitsstatue und von Jack O’Halloran mit der breitgeklopften Visage eines ehemaligen Boxers gespielt wird, eine tragende Rolle, er emanzipiert sich von den Chandlerschen Vorgaben, vom auffällig kostümierten Volltrottel, bei dem man sowieso nicht gewußt hätte, wie er so lange unentdeckt bleiben konnte.
Marlowe entdeckt sofort sein Faible für den tapsigen Riesen, die innere Verwandtschaft zu einem Mann, der seinem Glück hinterherrennt, es aber nie erreichen wird, dem wie Marlowe alles zu Scheiße gerät, was er anfaßt, und der aus Ungeschick schon mal jemanden umbringt. Moose Malloy sucht seine große Liebe, und dafür geht er auch über Leichen. Und als er ihre Stimme am Telefon hört, schnurrt er plötzlich zahm wie eine Katze hingebungsvoll und mit einem seligen Lächeln »Hallo Babe«. Ein wunderbares Melodrama also. Und als alles vorbei ist ertönt aus dem Off noch einmal die müde Stimme Marlowes und widmet dem Riesen mit dem geringen Verstand und dem großen Herzen ein Epitaph, das jeden, der eine sentimentale Ader hat, zum Schmelzen bringt. »Moose hätte ihr nie etwas antun können. Es machte ihm nichts aus, daß sie ihm sieben Jahre nicht geschrieben hatte. Es machte ihm nichts aus, daß sie ihn wegen der Belohnung an die Polizei verraten hatte. Dieser große Lulatsch liebte sie. Und wenn er noch leben würde, hätte es ihm nichts ausgemacht, daß sie ihm drei Kugeln in den Bauch gejagt hatte.«
Dann geht der große müde Mann einsam in die Nacht hinaus. Sein Gesicht ist noch grauer und faltiger geworden, aber er hat vor sich selbst bestanden. Er ist nicht stolz darauf. Er lebt. Das ist alles. Großes Kino eben.
Wo warst du, als der Spaß aufhörte?
Abschweifungen über Hunter S. Thompson
»Welterfahrung hat mich gelehrt, daß der durchschnittliche Weintrinker ein besserer Mensch ist als der normale Abstinenzler und daß der normale Spitzbube ein besserer Kumpan ist als der normale Spießbürger und daß der schlimmste Mädchenhändler, den ich kenne, ein anständigerer Mensch ist als der edelste Unzuchtbekämpfer.« H. L. Mencken
Hunter S. Thompson vor der Kamera
Als Hunter S. Thompson am 19. November 1987 bei Letterman zu Gast war, war das ein ziemliches Desaster. Zappelnd wie ein Fisch auf dem Trockenen saß er im Sessel und schnappte nach Luft, hektisch zog er an der Zigarette und nippte eilig an einem Glas. Er war nervös wie ein einjähriger Hengst vor seinem ersten großen Rennen oder vollgepumpt mit Speed wie eine verrückte Tanzmaus, der Oberkörper wippte vor und zurück und meistens neigte er seinen Kopf nach vorne, so daß sein Gesicht, das er hinter einer großkalibrigen Sonnenbrille verschanzte, auch noch von einer Basecap verdeckt wurde. Er hatte einen dicken weißen Winterpulli an und darüber noch eine Wildlederjacke, und er schwitzte derart, daß er während des Gesprächs begann, sich aus der Jacke zu schälen, während er sich dabei in den Mikros verhedderte. Dabei handelte es sich anscheinend nur um einen Probelauf. Das Studio bestand aus einer beklemmend kleinbürgerlichen Wohnzimmereinrichtung. Hinter Hunter S. Thompson stand ein Fenster offen und eine Gardine wehte im Wind, er saß zusammen mit einer Frau und einem Mann beengt auf einem Sofa, während Letterman in einem Bürostuhl lümmelte und seine Adidasschuhe in die Kamera hielt. Das Ambiente sah aus wie in einem privat gedrehten Porno und man wartete schon darauf, daß Hunter S. Thompson die gut aussehende Blondine mit dem tiefen Ausschnitt, die neben ihm saß, anbaggern würde. Doch dazu war er viel zu aufgedreht.
Hunter S. Thompson hörte sich an wie ein stotterndes Maschinengewehr. Dann verschluckte er auch noch die Hälfte aller Silben, so daß die Worte wie von einer Heckselmaschine zerstückelt oder durch einen Wackelkontakt ständig unterbrochen waren. Man mußte sich schon gewaltig anstrengen, um alles mitzubekommen.
Damals jedenfalls gab er keine gute Figur ab, da half ihm auch kein Wild Turkey, oder was immer er zu Stimulationszwecken in den Händen hielt. Als er sein »Hells Angels«-Buch im TV und Rundfunk vorstellte, vermurkste er die PR gründlich, denn entweder war er betrunken oder er hatte einen Knoten in der Zunge. Seinem Freund Paul Krassner schrieb Hunter S. Thompson, daß seine Fernsehauftritte der Horror waren und Random House absolut inkompetent. Vor allem der Literaturagent Scott Meredith bekam sein Fett ab. Thompson machte ihn für alles Ungemach verantwortlich und beschimpfte ihn als einen »motherfucking black-minded pig-whipping cocksucker«, einen »fascist soul-fucker«, dem er gerne die Zähne mit einem knotigen Stock einschlagen und jeden Knochen einzeln brechen würde, zumindest in der kurzen Zeit, die es Scott Meredith mit ihm aushalten würde. Niemand konnte so schön fluchen wie Hunter S. Thompson.
1988, sein 2. Band mit Gonzo-Schriften »Generation of Swine« war gerade herausgekommen, war Hunter S. Thompson bereits der Rockstar unter Amerikas Schriftstellern. Mit einer Stretchlimousine, in der er sich mit einer Flasche Whiskey in Stimmung brachte, wurde er von Stadt zu Stadt chauffiert, und überall gab es volle Häuser. Bei seinen Auftritten johlte und kreischte das Publikum und einige Fans schrien irgendwas auf die Bühne wie bei einem Rockkonzert. Hunter S. Thompson redete ohne Manuskript, ohne Punkt und Komma sowieso, er machte Witze über Reagan, Nixon und das Weiße Haus und hangelte sich wie ein Profi, der improvisieren muß, über die Zeit, während sich tausende von Zuschauern amüsierten.
Vor der Kamera wirkte er wie ein aufgedrehter kleiner Junge, der ständig irgendwelchen Blödsinn ausheckte. Und er sah auch so aus. Mit himmelblauen Shorts und weißen Kniestrümpfen, die schon damals mehr waren als sich ertragen ließ, wenn man ein bißchen Geschmack hatte, hüpfte und irrlichterte er durch Zeitungsredaktionen, hantierte mit einer Knarre und einem Golfschläger, brachte in der frühen Dokumentation »The Crazy Never Die« irgendetwas Großes zum Explodieren und ging wahrscheinlich einigen Leuten gehörig auf den Geist. Aber es war seine Show, und er zog die Show auf seine Art durch, und vermutlich hätte es niemand besser gekonnt.
Als er im Sommer 1997 in die Conan O’Brien-Show eingeladen wurde, teilte Thompson mit, er käme nur, würde man die Talkshow in die freie Natur verlegen und diverse Feuerwaffen zur Verfügung stellen, außerdem müßte ein Schießstand da sein und eine Bar, an der man sich mit anständigen Drinks versorgen könnte. Der Sender ließ sich darauf ein, weil die meisten leitenden Redakteure ganz scharf darauf waren, den berühmten Outlaw-Schriftsteller zu kriegen. Die Sendung war dann eigentlich keine Talkshow mehr, sondern eher eine Freak- und absurde Waffenshow, in der großkalibrige Schnellfeuergewehre und andere Modelle, die einem noch auf 500 Meter den Kopf wegpusten, vom Butler so stilvoll gereicht wurden wie sonst nur der Fünf-Uhr-Tee im England des vorletzten Jahrhunderts. Das neue Buch von Hunter S. Thompson »The Proud Highway« wurde dabei als Zielscheibe benutzt. Außerdem wurde ein Stoffteddy von den Geschossen zerfetzt, und wenn man bislang keine Antwort hatte auf die von den Sex Pistols gestellte Frage »Who killed Bambi?«, jetzt wußte man, Hunter S. Thompson jedenfalls schreckte nicht davor zurück. Für ihn fing der Spaß erst an, wenn der brave, gute Amerikaner drauf und dran war, seine Flinte aus dem Schrank zu holen, um diesem verrückten Trunkenbold eine Ladung Schrot in den Hintern zu verpassen.
Der hoffnungslose Romantiker
Was man nach der Lektüre beispielsweise von »Fear and Loathing in Las Vegas« und auch seiner anderen Bücher nicht unbedingt vermuten würde: Hunter S. Thompson war ein hoffnungsloser Romantiker, der an die große Liebe glaubte. Aber sie mußte sich auch als die große Liebe beweisen, sie mußte schon ein bißchen was hermachen. Einfach im Verborgenen blühen, das reichte nicht.
Als am 26. Mai 1986 der im berüchtigten Pariser Gefängnis La Santé einsitzende Bankräuber Michel Vaujour von seiner Frau Nadine mit dem Hubschrauber befreit wurde, hob Hunter S. Thompson die Nachricht aus der New York Times lange auf, bevor er sich in seinen 2003 erschienenen autobiographischen Schnipseln »Kingdom of Fear« an sie erinnerte und eine kleine Hommage auf das Paar und die Befreiungsaktion schrieb.
Als ich dieses Kapitel las, fiel mir die lange im Labyrinth der Erinnerung verschüttete Geschichte sofort wieder ein. Jeder hat wahrscheinlich ein paar »Nachrichten aus aller Welt«, die er sich ausgeschnitten hat, bis das Zeitungspapier vergilbt ist, Nachrichten, die einen eine Zeitlang über Wasser halten und daran erinnern, daß noch Hoffnung besteht in der Mühle des Alltags, weil es Menschen gibt, die durch frontale und rücksichtlose Angriffe auf das System Wünsche und Sehnsüchte nach Freiheit bei all jenen aufscheinen lassen, die das TV-Abendprogramm nicht für den Sinn des Lebens halten und sich damit zufrieden geben.
Meine Lieblingsnachricht handelte von einer zwölfjährigen Schülerin, die mit ihrem dreieinhalbjährigen Bruder von zu Hause abhaute und nach Madrid reiste. Von dort schrieb sie eine Ansichtskarte, in der sie ihrer Mutter mitteilte, daß sie endlich dort angekommen sei, wo sie hingehöre. Es gehe ihr gut, und auch ihr kleiner Bruder habe kein Heimweh. Von einer anderen Geschichte berichteten die Nürnberger Nachrichten am 13. Februar 1981. Eine Fünfzehnjährige war von zu Hause ausgerissen und mit ihrem noch jüngeren Freund durch die Wintersportorte in den Alpen gezogen. Sie stiegen in Luxushotels ab, hinterließen unbezahlte Rechnungen und beklauten die Hotelgäste. Die Fünfzehnjährige trat betont selbstbewußt auf. Die beiden hinterließen in insgesamt sechs Hotels nicht nur den Eindruck eines wohlhabenden jungen deutschen Ehepaares, sondern auch einen beträchtlichen Schaden, denn als sie festgenommen wurden, befand sich im gestohlenen Auto Diebesgut im Wert von 86.000 Mark.
Walter Serner hätte sich diebisch gefreut, denn es sah so aus, als wären die beiden einer seiner Kurzgeschichten entsprungen und hätten sich selbständig gemacht. Träumt nicht jeder mal vom erschwindelten Luxusleben? Oder davon, einfach abzuhauen? Lässig und stilvoll abzuräumen? Souverän und selbstbewußt aufzutreten, um das ganze Gesindel, das einen ohne Skrupel bei der Polizei verpfeifen würde, katzbuckeln zu lassen?
Eine solche Geschichte, die eine Menge Gefängnisstaub aufwirbelte und später sogar verfilmt wurde, war für Hunter S. Thompson die Gefangenenbefreiung aus dem Pariser Gefängnis La Santé, in dem auch schon Frankreichs Staatsfeind Nr. 1 Jacques Mesrine eine Zeitlang seine Anschrift hatte. Aber es war nicht eine gewöhnliche Gefangenenbefreiung. Amor vincit omnia – die Liebe überwindet jedes Hindernis, und Hunter S. Thompson stellt sich vor, wie »die Prinzessin im weißen Helikopter« monatelang Unterrichtsstunden genommen haben muß, denn es ist äußerst schwierig, eine »Kaffeemühle« derart niedrig mitten nach Paris hineinzufliegen und über dem Gefängnis so lange zu »parken«, bis ein Mann mit einer Uzi eine Strickleiter hinuntergeklettert ist und mit ihrem Mann wieder zurückkommt. »Sogar ein hirnloser Dummkopf würde sich in eine Geschichte wie diese verlieben«, begeisterte sich Hunter S. Thompson. »Sie hat die Reinheit eines Mythos und die Kraft einer einfach herabschwebenden Wahrheit, und sie spricht unsere lautersten Instinkte an. Ein perfektes Verbrechen, ein Verbrechen aus Liebe, durchgeführt mit einer erschreckenden Präzision und einer wahrhaft verrückten Furchtlosigkeit von einem wunderschönen Mädchen in einem weißen Helikopter.«
Aber wie jede große Liebe scheitert auch diese. Der »Honeymoon« dauert den Sommer über, aber im Herbst kehrt Michel Vaujour wieder zurück an die Arbeit. Ende September kommt es bei einem Banküberfall zu einer Schießerei, bei der ihn eine Polizeikugel in den Kopf trifft. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, und nachdem er aus dem Koma aufwacht, landet er wieder im Gefängnis. Hunter S. Thompson ist deprimiert, denn auch Nadine wird verhaftet. Sie hatte Michel Vaujour 1979 geheiratet als sie sich in verschiedenen Gefängnissen befanden. Im September 1981 kam ihre Tochter zur Welt – wo sonst als im Gefängnis. Für Hunter S. Thompson waren sie Liebende, die das Wort Liebe durch eine »schreckliche Intensität ehrten«.
Michel Vaujour verbringt insgesamt siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis, siebzehn davon in Einzelhaft. Fünfmal konnte er entkommen. Einmal mit der klassischen Methode, als er mit einer aus einem Stück Seife geschnitzten Knarre drei Elitesoldaten und einen Untersuchungsrichter in Schach hielt. Der spektakulärste Ausbruch gelang ihm jedoch mit dem Hubschrauber, den seine damalige Frau Nadine flog. Begonnen hatte seine Karriere 1969 aus Langeweile, »um der Sinnlosigkeit zu trotzen«, wie er selber sagt. Das große Spiel begann. Diebstahl, Einbruch, Spritztouren mit geklauten Autos, Überfälle, Verhaftung und Ausbrüche, einmal mit geschwärzten Apfelsinen, die aussahen wie Handgranaten, und einmal mit der Nachbildung seines Zellenschlüssels, von dem ihm trickreich ein Abdruck in einem alten Käse gelang. »Wir waren keine Gangster«, sagte er, »sondern anarchistische Rebellen.« Nach der letzten Schießerei mit der Polizei ändert sich alles. »Als ich da auf dem Trottoir lag, diese Kugel im Kopf, hörte ich noch den Polizisten zu seinem Kollegen sagen: ›Vergiß den, der ist schon tot!‹ Da dachte ich bei mir: ›Ich bin lebendiger, als du es jemals warst‹.« Der »König der Ausbrecher« tritt eine Reise ins Innere an und entkommt durch Meditation und Selbstbesinnung dem selbstmörderischen Kreislauf des Knastlebens. Im August 2005, ein halbes Jahr nach Hunter S. Thompsons Selbstmord, wird »Le roi de la belle«, wie der 52jährige Michel Vaujour auch genannt wird, mit Auflagen aus dem Gefängnis entlassen. Seither lebt Vaujour als Drehbuchautor zurückgezogen in Paris. Seine Geschichte wurde inzwischen verfilmt. Von der schönen Frau im weißen Helikopter aber ist nicht mehr die Rede.
Der Una-Bomber der amerikanischen Literatur
»Das Königreich der Angst«, und nicht nur dieses Buch, wurde nachts verfaßt, wenn die Besucher und Nachbarn, die gekommen waren, um sich irgendwelche Baseball- oder Basketballspiele im Fernsehen anzusehen und Wetten abzuschließen, wieder nach Hause gewankt waren. Dann saß Hunter S. Thompson »vor dieser gottverdammten Schreibmaschine, ein leeres Glas neben mir, eine nicht angezündete Zigarette zwischen den Lippen und auf dem Fernsehschirm eine nackte Frau, die ›Porgy & Bess‹ singt«. Hunter S. Thompson zimmerte fleißig an diesem Mythos des verrückten Außenseiters, der immer noch weiter machte, wenn schon alle die Waffen gestreckt hatten. Und warum auch nicht? Abgesehen von kleineren und größeren Ausmalungen stimmte es ja auch. Sein Leben hatte nur entfernte Ähnlichkeiten mit dem Leben, das ein Schriftsteller für gewöhnlich führt, jedenfalls Schriftsteller, die auf ihre Buchproduktion genauso achten wie auf ihre Gesundheit und deren Literatur die Ausstrahlung von Birkenstockschuhen besitzt.
Und von diesem ungewöhnlichen Leben legte Hunter S. Thompson 2003, zwei Jahre vor seinem spektakulären Selbstmord, mit »Königreich der Angst« ein letztes Mal Zeugnis ab. Noch einmal zeigt der »Una-Bomber der amerikanischen Literatur«, wie ihn Time einmal bezeichnet hat, was er zu bieten hat: als großer Erzähler und hervorragender Stilist, der Witz und Charme hat, aber auch grob werden kann, wenn er es für angemessen hält.
Häufig ist zu vernehmen, daß Hunter S. Thompson seit »Hells Angels« und »Fear and Loathing in Las Vegas« nichts mehr Großes gelungen sei. Dahinter steckt die Erwartung, daß Hunter S. Thompson das später verfilmte »Angst und Schrecken«-Buch noch einmal in etwas abgewandelter Form hätte schreiben sollen, also das zu tun, was andere Autoren zweifellos sofort getan hätten, nämlich an der Schraube der Wiederholung zu drehen und eine Idee zu Tode zu reiten. Hunter S. Thompson hat das nicht getan. Stattdessen hat er in dem als seine Memoiren geltenden »Königreich der Angst« häufig nur Artikel zweitverwertet. Das macht aber nichts, weil er sowieso nie eine klassische, linear erzählte Lebenserinnerung geschrieben hätte. Und deshalb erfährt man nichts über die Zeit, als er mit den Hells Angels oder seinem übergewichtigen samoanischen Anwalt herumzog. Das alles hatte er bereits erzählt, und warum es noch einmal erzählen, wenn er überzeugt ist, daß es besser nicht hinzukriegen ist?
Er macht sich über den nationalen Nervenzusammenbruch lustig, der in Amerika nach dem 11. September einsetzte, über die staatlich verordnete Hysterie, alles zu überwachen, zu kontrollieren und am besten gleich wegzusperren, bevor »dunkelhäutige Terroristen« das »ganze gottverdammte Land in Schutt und Asche legen«. Dazwischen eingestreut tauchen Zeitungsartikel, Kommentare, Briefe und detaillierte Gedächtnisprotokolle über einen Fall auf, in dem Hunter S. Thompson die Hauptrolle spielte und an deren Richtigstellen ihm viel lag, denn zum ersten Mal rückte ihm ein obsessiver Staatsanwalt bedrohlich nah auf die Pelle und wollte ihn wegen einiger Krümel Drogen ein paar Jahre hinter Gitter schicken.
Eine Journalistin, die früher im »Sex-Business« tätig war, will unbedingt ein Interview. Hunter S. Thompson hat keine Lust, aber sie erweist sich als aufdringlich und hartnäckig und schafft es schließlich, zur Owl-Farm vorgelassen zu werden. Was sich dort abspielt, darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. Die Journalistin behauptet, sexuell belästigt worden zu sein, und erstattet Anzeige. Daraufhin wird die Staatsanwaltschaft aktiv und ordnet eine Hausdurchsuchung an. Es werden geringe Mengen von Drogen gefunden.
Es kommt zum Prozeß, der jedoch für die Staatsanwaltschaft zur Farce gerät, denn nie hatte Hunter S. Thompson einen Hehl aus seinem Drogenkonsum gemacht, vielmehr sind die Drogen ein wesentlicher Bestandteil seiner Literatur. Und tatsächlich weist der Richter sämtliche Anklagepunkte ab. »Der Schuß ist nach hinten losgegangen«, schreibt Thompson später euphorisch. »Sie sind allesamt verloren. Schon bald werden sie im Gefängnis sitzen. Diese Hundesöhne besitzen nicht mehr Respekt vor dem Gesetz als das Diebesgesindel in Washington. Sie wird dasselbe Schicksal ereilen wie Charles Manson und Neil Bush.«
Die lustigste Geschichte in diesem Episoden-Buch heißt »Hiiiiiiiiiier ist Johnny! Angst und Schrecken vor Jacks Haus ...« und handelt von einem Geburtstagsbesuch, den Hunter S. Thompson Jack Nicholson abstattet und der zu einem totalen Fiasko gerät, weil Thompson es für eine gute Idee hält, irgendwann gegen drei Uhr in der Nacht das einsam in einer Schlucht gelegene Haus von Nicholson mit der Tonbandaufnahme vom Todeskampf eines Schweins zu beschallen, das lebendig von einem Bären gefressen wird, und einen Suchscheinwerfer mit einer Million Watt auf das Anwesen zu richten, außerdem ein bißchen mit einer Neun-Millimeter-Pistole von Smith & Wesson herumzuballern und ein blutiges Wapitiherz an die Tür zu lehnen. Da sich Jack Nicholson bei diesem Frontalangriff verständlicherweise verbarrikadiert und das Licht löscht, fährt Thompson auf seine Owl-Farm zurück, um am nächsten Morgen zu erfahren, daß die gesamte Polizei des County auf der Suche nach einem Durchgeknallten ist, der Jack Nicholson und seine Familie abschlachten wollte. Genau wie in »Shining«. Wer bei der Lektüre dieser Seiten keinen Lachkoller bekommt, hat für die hochkomische Literatur verloren.
Komisch bedeutet für Hunter S. Thompson aber immer auch, mit dem Schrecken zu spielen, den unerfahrenen und naiven Leser im Unklaren zu lassen, was da eigentlich gerade vor sich geht, die Grenze zu verwischen, die das Komische von der Bösartigkeit trennt, denn komisch zu sein heißt für Hunter S. Thompson nicht, harmlos zu sein und nur ein Ventil zum Lachen zu liefern, im Komischen tun sich Abgründe auf, entfaltet sich der absurde und nur unwesentlich übertriebene Schrecken, der durchaus realistisch ist.
»Wir schreiben das letzte und chaotische Jahr des Amerikanischen Jahrhunderts, und die Leute werden nervös. Hamsterer wagen sich hervor, murmeln düstere Prophezeiungen wegen der Jahrtausendwende und kaufen den Rindereintopf von Dinty Moore gleich kistenweise ... Ich persönlich hamstere Munition, viele Tausende Patronen. Kugeln werden sich immer als nützlich erweisen, besonders wenn das Licht ausgeht und das Telefon plötzlich tot ist und die Nachbarn hungrig ausschwärmen. Spätestens dann stellst du fest, wer deine Freunde sind. Selbst enge Verwandte wenden sich gegen dich. Nach dem Jahr 2000 werden die einzigen Freunde, vor denen du dich sicher fühlen kannst, die toten Freunde sein.«
Die Erfindung von Gonzo
Nimmt man Google als Indikator für die Beliebtheit oder zumindest für die Popularität eines Autors, dann kann niemand mithalten (jedenfalls war das Anfang 2007 so, inzwischen kann sich das auch wieder geändert haben). Weder Tom Wolfe noch Philip Roth, weder John Updike noch John Irving. Auch nicht der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, und weit abgeschlagen ist auch der Literaturbetriebsintrigant Günter Grass. Mit über drei Millionen Treffern hat Hunter S. Thompson seine Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Das ist umso erstaunlicher, als Hunter S. Thompson die Welt der Literatur nicht mit dickleibigen und schwerst bedeutenden Romanen überschwemmt hat. Sein Werk ist im Vergleich zu dem der Großschriftsteller schmal und überschaubar. Seinen ersten Roman »Rum Diary«, ein Jugendwerk, das erst 36 Jahre später veröffentlicht wurde, und »Fear and Loathing in Las Vegas« hat man bequem jeweils in ein paar Stunden durch. Das wars.
Die auf den ersten Blick verblüffende Tatsache ist jedoch kein undurchschaubares Rätsel. Im Unterschied zu seinen Kollegen war Hunter S. Thompson nicht einfach nur ein Schriftsteller, der hinter der Schreibmaschine in aller Ruhe und Abgeschiedenheit Zeilen schrubbte, sondern auch Journalist, und zwar einer, der tief in die Realität eintauchte, über die er schreiben sollte. Unter den Journalisten war er der beste Schriftsteller und unter den Schriftstellern der beste Journalist, schrieb mal jemand, der damit allerdings noch untertrieben hatte.
1970 erschien in Scanlan’s Monthly der Artikel »Das Kentucky-Derby ist dekadent und degeneriert«, der zum besten zählt, was Hunter S. Thompson jemals verfaßt hat. Damals lernte er den Zeichner Ralph Steadman kennen, der vom Chef der Scanlan’s Monthly Warren Hinckle engagiert worden war, um »das größte Spektakel, das dieses Land zustande bringt«, zeichnerisch festzuhalten. In einem Interview, das Hunter S. Thompson 1977 der High Times gab, erzählt er, wie er von der Pressetribüne eine Dose des chemischen Kampfstoffes Mace, der jede Auseinandersetzung schnell beendet, in die Box des Gouverneurs sprühte, »ein Neo-Nazi-Schwein namens Louie Nunn«, und sich anschließend schleunigst aus dem Staub machte. Mit der chemischen Keule setzte er dann auch noch einen Kellner außer Gefecht, der ihm dumm kam. Derart randalierend befeuerte er ein wenig den Wahnsinn, den dieses Pferderennen ausstrahlte, wenn einige tausend volltrunkene Trottel »schreien, heulen, kopulieren, sich gegenseitig niedertrampeln und sich mit zerbrochenen Whiskeyflaschen angreifen.« Eine phantastische Szenerie, in der Hunter S. Thompson mitmischte. Viel interessanter als darüber zu berichten, welches Pferd in welchem Rennen gewonnen hatte, war es, sich selber an der Presse-Bar volllaufen zu lassen und auf der Suche nach dem rattengesichtigen Menschen, der typisch für das Derby war, sich am Ende selber zu entdecken.
Hunter S. Thompson fuhr anschließend nach New York, wo er im Royalton Hotel die Titelstory schreiben sollte. Aber er litt an einer totalen Schreibblockade. Jede Stunde kam ein Botenjunge vorbei, was den Druck noch erhöhte, bis sich Hunter S. Thompson am dritten Tag schließlich in die Badewanne legte und White Horse aus der Flasche trank. »Schließlich riß ich einfach die Seiten aus meinen Notizbüchern – ich schrieb andauernd in Notizbücher – und die Sachen waren sogar leserlich. (...) Als ich dem Botenjungen die erste gegeben hatte, dachte ich, das Telefon würde jede Minute läuten und jemand, der das Ding im New Yorker Büro zu redigieren hatte, würde einen Sturzbach von Beschimpfungen über mich loslassen.« Stattdessen war Warren Hinckle »glücklich wie zwölf junge Hunde«, und er sagte am Telefon, daß »das Zeug phantastisch« sei und »er noch mehr Seiten haben wolle«.
Von Tom Wolfe gibt es eine ganz ähnliche Geschichte. Sie erzählt die Geburtsstunde des New Journalism. Beide Geschichten dürften nur einen rudimentären Wahrheitskern haben, denn das Kentucky-Derby-Stück ist alles andere als eine auf einen Schmierblock hingekritzelte Skizze, und selbst die Stellen, an denen Thompson aus seinen »Notizen« zitiert, machen einen durchaus elaborierten Eindruck. Aber zu jeder Erfindung eines literarischen Genres gehört ein Gründungsmythos. Tom Wolfe ruft in einer nächtlichen wilden Schreibsession mit seiner Geschichte über »Das bonbonfarbene tangerin-rot-gespritzte Stromlinienbaby« den New Journalism ins Leben, Hunter S. Thompson entdeckt ein paar Jahre später seinen eigenen unverwechselbaren Stil: Gonzo.
Bill Cardoso vom Boston Globe Sunday Magazine, ein Kollege und Freund, mit dem er später in Kinshasa war, um über den Jahrhundertkampf Muhammad Ali gegen George Foreman zu berichten, außer Spesen aber nichts zustande brachte, sagte ihm: »Vergiß all den Mist, den du bisher geschrieben hast. Das hier ist es, das ist purer Gonzo. Falls das der Anfang ist, mach weiter so!« Bill Cardoso schrieb in den Siebzigern selber Gonzo und zählte zu den großen Reportern, die damals den Journalismus neu definierten. Er schrieb über den Krieg der Gangs in Chinatown von San Francisco, und über das große Zaire-Stück meinte Hunter S. Thompson, er hätte einen Nachmittag lang geweint, weil »dieser Bastard« so fein und elegant schreiben würde.
1979 übernahm das »Webster’s New Twentieth Century Dictionary« den Begriff: »Adjektiv (Herkunft unbekannt): bizarr, hemmungslos, bezeichnet besonders eine Form von subjektivem Journalismus, daher Gonzo-Journalismus.« Cardoso präzisierte Gonzo als einen Begriff, der im irischen Slang in Boston denjenigen bezeichnet, der nach einem Saufgelage als letzter aufrecht am Tresen steht. Gonzo war für Hunter S. Thompson, der in dieser Kampfsportart häufig genug als Sieger hervorgegangen war, genau der richtige Ausdruck, um gierig »wie ein ausgehungerter Hund« danach zu grapschen und »wegzurennen« (Ralph Steadman). »Gonzo ist das, was ich mache«, lautete nunmehr die knappe Antwort auf die immer wieder gestellte Frage, was damit gemeint sei. Eine andere Definition von »Gonzo-Journalismus«, »wie ich sie besser noch nicht gehört habe«, lieferte Muhammad Ali in einem Interview mit dem unbestrittenen »Gonzo-Schwergewichtsweltmeister« Hunter S. Thompson: »Meine Art Witz ist es, die Wahrheit zu sagen. Das ist witziger als alles andere.«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.