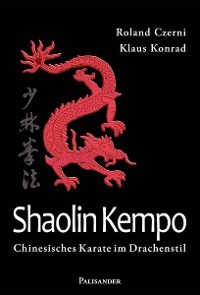Kitabı oku: «Shaolin Kempo», sayfa 2
8. Atmung
In allen Bereichen des Shaolin Kempo sind eine korrekte Atmung und ein guter Atemrhythmus wichtig. D. h., daß bei sämtlichen Techniken hinsichtlich Kraft, Energie und Kondition auf eine Atemtechnik geachtet werden muß, die dem Ablauf der Technik angemessen ist und sie sinnvoll unterstützt.
Ziele des Shaolin Kempo
Die primäre Zielsetzung des Shaolin Kempo ist seine breitensportliche Verbreitung als Selbstverteidigungssportart. Darüber hinaus kann sie aber auch – leistungsorientiert – als Wettkampfsportart betrieben werden.
Als Grundlage dienen die ursprünglichen Techniken des chinesischen Quanfa, d. h., die Anwendung von Schlägen, Tritten und Stößen mit Armen und Beinen in wechselnder Verbindung von kraftvoller Dynamik und vitaler Gewandtheit, teilweise ergänzt durch Hebel- und Wurftechniken.
Das zweite Ziel des Shaolin Kempo ist die Ausbildung körperlicher Fitneß sowie das harmonische Wechselspiel von Körper und Geist, das in der Schulung von Konzentrationsfähigkeit, richtiger Atmung und Charakterbildung zum Ausdruck kommt. Dies schließt die Entwicklung einer entsprechenden Ethik ein: die Bereitschaft zur Bildung und zu sozialem Verhalten.

Das Symbol des Drachens im Shaolin Kempo
In der heutigen Form des Shaolin Kempo finden sich nur noch sehr wenige ursprüngliche Elemente des chinesischen Drachenstils, so daß man kaum noch vom klassischen Drachenstil sprechen kann. Dennoch wird der chinesische Drache im Shaolin Kempo als Symbol für Kraft, Gewandtheit und Weisheit verwendet.
 Foto 11
Foto 11
 Foto 12
Foto 12
 Foto 13
Foto 13
Fotos 11 bis 13: Die traditionelle Ausbildung in den Kampfkünsten zielte darauf ab, daß man zu jeder Zeit und unter allen Umständen auf unverhoffte Gefahr mit den zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren konnte. Auf den 1976 entstandenen Fotos ist Meister Tang mit einem seiner Schüler zu sehen. Rechts im Bild auf Foto 13 ist der Autor Klaus Konrad zu sehen.
II
Musubi dachi, Heiko dachi und Shiko dachi
 Foto 14: Musubi dachi. Die sogenannte V-Fuß-Stellung.
Foto 14: Musubi dachi. Die sogenannte V-Fuß-Stellung.
 Foto 15: Heiko dachi. Stellung in Schulterbreite mit nach vorn gerichteten Zehen.
Foto 15: Heiko dachi. Stellung in Schulterbreite mit nach vorn gerichteten Zehen.
 Foto 16: Shiko dachi. Stellung in doppelter Schulterbreite mit nach außen gerichteten Zehen.
Foto 16: Shiko dachi. Stellung in doppelter Schulterbreite mit nach außen gerichteten Zehen.
Kake dachi und Uchihachiji dachi
 Foto 17: Kake dachi. Überkreuzstellung.
Foto 17: Kake dachi. Überkreuzstellung.
 Foto 18: Uchihachiji dachi. Stand in Schulterbreite mit nach innen gerichteten Zehen.
Foto 18: Uchihachiji dachi. Stand in Schulterbreite mit nach innen gerichteten Zehen.
Kokutsu dachi und Sanchin dachi
 Foto 19: Kokutsu dachi.
Foto 19: Kokutsu dachi.

 Foto 20: Sanchin dachi.
Foto 20: Sanchin dachi.

Bei der Rückwärtsstellung Kokutsu dachi (19, Schwerpunktdarstellung) trägt das hintere Bein 70 %, das vordere 30 % des Körpergewichts.
Aus dieser Stellung kann man sehr leicht in eine andere übergehen, und sie ist somit sowohl gut für den Angriff als auch für die Abwehr zu gebrauchen.
Bei der Knieinnenstellung Sanchin dachi (20, Schwerpunktdarstellung) sind die Knie nach innen gerichtet, so daß man eine gute Standfestigkeit erlangt.
Aus dieser Stellung kann man eine große Schlag- und Stoßkraft erzielen. Ein Fuß steht etwa eine Fußlänge weiter vor oder zurück als der andere.
Kiba dachi
 Foto 21: Kiba dachi.
Foto 21: Kiba dachi.
 Foto 22
Foto 22
 Foto 23
Foto 23

Die Füße sind im Kiba dachi, dem Reitersitz, etwa um die doppelte Schulterbreite auseinander, wobei das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt sein soll. Die Knie sind nach außen gebeugt und die Zehen zeigen gerade nach vorn.
Diese Stellung bezeichnet man im Shaolin auch als mittleren Reitersitz. Man unterscheidet zwischen dem tiefen (22) und dem hohen Reitersitz (23). In diesen Stellungen sollte man öfter einige Zeit verharren, um Körper und Geist zu stärken.
Beide Fäuste werden vor der Brust plaziert; die Ellenbogen zeigen dabei nach unten und die Fäuste nach oben. Wichtig ist hierbei vor allem die vollkommene Konzentration auf die Körperhaltung. Dabei wird langsam und gleichmäßig durch die Nase geatmet, wobei die Zunge den Gaumen berühren soll.
Zenkutsu dachi
 Foto 24: Zenkutsu dachi.
Foto 24: Zenkutsu dachi.
 Foto 25
Foto 25
 Foto 26
Foto 26

Beim Zenkutsu dachi, der Vorwärtsstellung (24), ist das vordere Bein gebeugt und das hintere gestreckt, wobei auch hier wieder die Zehen nach vorn zeigen sollten. Das vordere Bein trägt 60 %, das hintere 40 % des Körpergewichts. Der seitliche Abstand zwischen den Füßen geht nur wenig über die eigene Schulterbreite hinaus.
Diese Stellung bezeichnet man im Shaolin Kempo auch als geduckten Reitersitz (25 und 26). Aus ihm kann die gleiche Konzentrationsübung wie bei den anderen Reitersitzen durchgeführt werden. Diese Übung kann rechts und links ausgeführt werden, so lange, bis die Knie anfangen zu zittern.
Tsuruashi dachi und Fudo dachi
 Foto 27: Tsuruachi dachi.
Foto 27: Tsuruachi dachi.
 Foto 28: Fudo dachi.
Foto 28: Fudo dachi.
Beim Stehen auf einem Bein im Tsuruashi dachi (27) soll das nichtbelastete Bein mindestens bis auf Höhe der Kniescheibe des Standbeins angehoben werden, wobei die Zehen leicht nach unten gerichtet sind. Der Oberkörper muß eine gerade Haltung annehmen. Die Finger der unteren Hand sollen wie Krallen gekrümmt sein. Die obere Hand ist einfach geöffnet. Auch in dieser Stellung kann die beschriebene Konzentrationsübung rechts und links durchgeführt werden.
Foto 28 zeigt den Fudo dachi mit nach außen gerichteten Zehen.
Kakato dachi
 Foto 29
Foto 29
 Foto 30
Foto 30
Der Kakato dachi (Fersensitz, 29 und 30) ist der Gegensatz zum geduckten Reitersitz. Bei ihm ist das vordere Bein gestreckt und das hintere gebeugt. Die Hauptlast liegt auf dem hinteren Bein. Das vordere berührt nur leicht den Boden.
Die Haltung der Arme und Fäuste ist identisch mit der für die vorhergehenden Stellungen beschriebenen. Diese Stellung sollte rechts und links bis zur Ermüdung durchgeführt werden.
Nekoashi dachi und Heisoku dachi
 Foto 31: Nekoashi dachi.
Foto 31: Nekoashi dachi.
 Foto 32: Heisoku dachi.
Foto 32: Heisoku dachi.

Im Nekoashi dachi, der Katzenfußstellung (31), trägt das hintere Bein 90 % des Körpergewichts (siehe Darstellung des Schwerpunkts). Das vordere Bein wird nur mit dem Fußballen aufgesetzt. Dieser Stand bietet die besten Voraussetzungen für anschließende fließend ineinander übergehende Bewegungen und ist somit Ausgangspunkt eines jeden Kumite.
III
Oi zuki, Gyaku zuki und Tate zuki
 Foto 33: Oi zuki.
Foto 33: Oi zuki.
 Foto 34: Gyaku zuki.
Foto 34: Gyaku zuki.
 Foto 35: Tate zuki.
Foto 35: Tate zuki.
Oi zuki ist der gleichseitige Fauststoß (33). Dies ist ein gerader Fauststoß nach vorn, wobei sich die ganze Kraft des Körpers auf die Faust überträgt. Die gestoßene Faust ist immer auf der Seite des vorderen Fußes.
Gyaku zuki ist der gegenseitige Fauststoß (34). Hierbei ist die gestoßene Faust immer auf der Seite des hinten stehenden Fußes. Dieser Fauststoß erhält seine Kraft aus dem Hüftimpuls.
Tate zuki ist der Stoß mit der vertikalen Faust (35). Die Faust wird aus der Hüfte gerade nach vorn gestoßen und macht kurz vor dem Ziel eine Vierteldrehung nach innen. Die Technik kann auch auf Jodan-Höhe ausgeführt werden, indem die Faust schon mit der Vierteldrehung vor der Brust plaziert und gerade nach vorn gestoßen wird.
Chudan ura zuki und Jodan ura zuki
 Foto 36: Chudan ura zuki.
Foto 36: Chudan ura zuki.
 Foto 37: Chudan ura zuki.
Foto 37: Chudan ura zuki.
 Foto 38: Jodan ura zuki.
Foto 38: Jodan ura zuki.
Chudan ura zuki ist der umgekehrte Fauststoß zur Körpermitte (36 und 37). Ausgangspunkt ist wieder die Hüfte. Die Faust wandert nach hinten, um dann in gerader Linie ohne Drehung nach vorn zu stoßen. Die Vorderseite der Faust trifft auf. Bevorzugte Ziele sind Solarplexus oder Kinn.
Jodan ura zuki (38) ist der umgekehrte Fauststoß zum Kinn.
Morote zuki und Yama zuki
 Foto 39: Morote zuki.
Foto 39: Morote zuki.
 Foto 40: Morote zuki.
Foto 40: Morote zuki.
 Foto 41: Yama zuki.
Foto 41: Yama zuki.
 Foto 42: Yama zuki.
Foto 42: Yama zuki.
Morote zuki ist ein doppelter Fauststoß (39 und 40). Beide Fäuste starten gleichzeitig von der Hüfte aus zum Ziel.
Yama zuki ist ein doppelter Fauststoß zu zwei verschiedenen Angriffspunkten (Hindernisstoß, 41, 42). Die rechte Faust stößt zum Kopf, die linke trifft in Ura-zuki-Form in Chudan oder Gedan auf. Die Fäuste stehen übereinander.
Hiraken zuki
 Foto 43
Foto 43
 Foto 44
Foto 44
 Foto 45
Foto 45
 Foto 46
Foto 46
 Foto 47
Foto 47
 Foto 48
Foto 48
Hiraken zuki ist der Fingerknöchelstoß (43-48). Diese Technik wird von der Hüfte aus auf geradem Wege nach vorn gestoßen; dabei treffen die Fingerknöchel auf. Bevorzugte Ziele sind Augenpartie, Kehlkopf, Solarplexus und die Herzregion.
Shotei zuki
 Foto 49
Foto 49
 Foto 50
Foto 50
 Foto 51
Foto 51
 Foto 52
Foto 52
 Foto 53
Foto 53
Shotei zukiist der Stoß mit dem Handballen (48-53). Die Hand wird auf geradem Weg von der Hüfte aus in Jodan-Höhe (49) oder in Chudan-Höhe (50) nach vorn gestoßen. – Das Ziel wird bei dieser Technik mit der Handwurzel getroffen (51-53).
Mawashi zuki
 Foto 54
Foto 54
 Foto 55
Foto 55
 Foto 56
Foto 56
 Foto 57
Foto 57
 Foto 58
Foto 58
 Foto 59
Foto 59
Der Mawashi zuki ist der Halbkreisfauststoß (54-57 ). Die Faust wird dabei von der Hüfte aus im Halbkreis zum Ziel gestoßen. Das Ziel wird entweder mit der Vorderseite der Faust (56, 58) oder dem Faustrücken (57, 59) getroffen. – Auch hier ist wieder die charakteristische Drehung des Handgelenks kurz vor dem Ziel zu beachten.
Atama zuki
 Foto 60
Foto 60
 Foto 61
Foto 61
 Foto 62
Foto 62
Atama zuki ist der Kopfstoß (60-62). Stöße mit dem Kopf werden meistens mit dem Gesicht nach unten ausgeführt. Es kann aber auch die Seite des Kopfes oder der Hinterkopf auftreffen.
Kopfstöße eignen sich gut für den Nahkampf, können aber auch beim Ausführenden Verletzungen und Schädigungen wie Gehirnerschütterungen usw. hervorrufen.
Jodan tettsui zuki
 Foto 63
Foto 63
 Foto 64
Foto 64
 Foto 65
Foto 65
Jodan tettsui zuki ist der gestoßene Hammerschlag. Hierbei wird die Faust von der Hüfte aus auf geradem Weg nach vorn gestoßen (63, 64). Auch hier trifft die Kleinfingerseite der Faust auf (65).
Hiraken uchi, Haito uchi und Oyayubi ipponken uchi
 Foto 66: Hiraken uchi.
Foto 66: Hiraken uchi.
 Foto 67: Haito uchi.
Foto 67: Haito uchi.
 Foto 68: Oyayubi ipponken uchi.
Foto 68: Oyayubi ipponken uchi.
 Foto 69: Oyayubi ipponken uchi.
Foto 69: Oyayubi ipponken uchi.
Die auf dieser Seite dargestellten Techniken werden mit der gleichen Kreisbewegung ausgeführt wie der Mawashi zuki.
Hiraken uchi: Die Fingerknöchel der halbgeballten Faust treffen im Ohrbereich auf (66).
Haito uchi: Handkantenschlag mit der Daumenseite. Diese Technik kann von innen nach außen und umgekehrt, sowie auch zur Seite (z. B. als Schlag zum Kehlkopf) ausgeführt werden (67).
Oyayubi ipponken uchi: Daumenfaustschlag. Bei diesem Schlag trifft der Daumenknöchel auf. Die Daumenspitze wird dabei fest an das Zeigefingergelenk gedrückt (68, 69).
Yonhon nukite, Ippon nukite und Nihon nukite
 Foto 70: Yonhon nukite.
Foto 70: Yonhon nukite.
 Foto 71: Yonhon nukite.
Foto 71: Yonhon nukite.
 Foto 72: Ippon nukite.
Foto 72: Ippon nukite.
 Foto 73: Ippon nukite.
Foto 73: Ippon nukite.
 Foto 74: Nihon nukite.
Foto 74: Nihon nukite.
 Foto 75: Nihon nukite.
Foto 75: Nihon nukite.
Die Speerhand (Nukite) kann in verschiedenen Formen ausgeführt werden. Bei der gebräuchlichsten Form, dem Yonhon nukite (70, 71) wird der Daumen bei ausgestreckten Fingern etwas nach innen gedreht.
Ippon-Nukite, der Zeigefingerspeer. Hierbei wird mit gestrecktem Zeigefinger zugestoßen (72, 73).
Nihon-Nukite, der Zwei-Finger-Speer. Zeigefinger und Mittelfinger bilden ein »V« (74, 75). Auch dieser Stoß dient dazu, den Gegner an Hals, Augen usw. zu verletzen.
Uraken shomen uchi
 Foto 76
Foto 76
 Foto 77
Foto 77
 Foto 78
Foto 78
 Foto 79
Foto 79
 Foto 80
Foto 80
Uraken shomen uchi ist der Schlag mit der Vorderseite der umgekehrten Faust. Die Faust wird von der Hüfte aus, ohne daß man sie dabei dreht, nach vorn gestoßen (76-78). Die Vorderseite der Faust trifft auf (79, 80).
Uraken uchi
 Foto 81
Foto 81
 Foto 82
Foto 82
 Foto 83
Foto 83
 Foto 84
Foto 84
Uraken uchi – Schlag mit der umgekehrten Faust zur Seite. Die Faust wird von der anderen Hüfte aus in Form einer Aufwärtsbewegung zur Seite geschlagen (81-83). Die Vorderseite der Faust trifft auf (84).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.