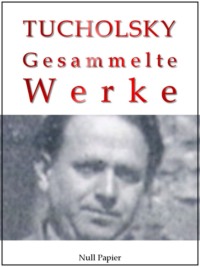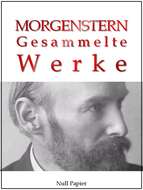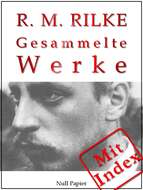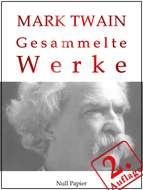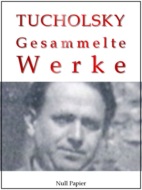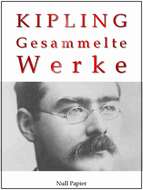Kitabı oku: «Kurt Tucholsky – Gesammelte Werke – Prosa, Reportagen, Gedichte», sayfa 14
Ein Zug rollt an mir vorbei. Der Krankenträger, der hier die Ordnung aufrechtzuerhalten hat, trennt sie nach Nationen. »Francais?« fragt er. »Italien?« – Ein schrecklicher Stumpf von einem Menschen sitzt in einem Stuhl, mit ganz großem Kopf, winzigen Gliedmaßen, eine Masse Fleisch. Das Ding nickt mit dem Kopf. Frauen mit wunderlichen Auswüchsen fahren vorbei, manchen hat man Tücher über das Gesicht gelegt, man ahnt nur das Entstellte darunter. Ein rothaariger junger Mensch wird herangefahren, er klappert mit den Zähnen, er hat Fieber, und seine langen gelben Zähne ragen seltsam aus dem spitzen Gesicht. »Francais?« fragt der Krankenträger. »Italien?« Der Fahrer scheint es nicht zu wissen, und der junge Mensch antwortet nicht. Da will der Ordner nach dem Abzeichen sehn. Er lüftet die Decke…
Aber das ist eine Frau, die darunter liegt! eine junge Frau mit welken Brüsten, und jetzt hat sie die Augen geschlossen und sich hintenübergelegt und sagt überhaupt nichts mehr. Sie verschwindet im Asyl. Und so kommen noch viele.
Die Menge diskutiert die Heilungen, die sich in den Gerüchten minütlich vergrößern, an Zahl, an Schwere, an Kraft des Mirakels. Sehr langsam zerstreuen sich die Massen im Staub der Nachmittagssonne.
Für den Abend ist die große Fackel-Prozession angesetzt, kurz nach dem Abendbrot schon laufen alle Leute in Lourdes mit kleinen Fackelchen umher, wie man sie uns auf den Kinderfesten in die Hand gesteckt hat. Blaugedruckte Papierschirme mit dem Bildnis der Jungfrau umhüllen die Kerze. Aber bevor das angeht, sehe ich doch noch etwas anderes.
Die Kranken können die Hospitäler nicht verlassen, sie können den Fackelzug nicht verstärken –.
Wenn der Pilgerzug groß genug ist, dann versammeln sich manchmal die Angehörigen vor dem großen Krankenhaus und bringen ihren Zug den Kranken dar. Und das ist wohl das Erschütterndste, das ich in Lourdes gesehn habe.
Zum Fackelzug wird das »Ave Maria« gesungen. Verfasser und Komponist ist Abbé Gaignet, ein Geistlicher aus der Vendée, er schuf dieses Lied im Jahre 1874. Es hat unzählige Strophen, einfache Vierzeiler aus einer simpeln Melodie, und als Refrain ist ihm das Ave angesetzt, das in der französischen Liedbetonung ungefähr folgendermaßen klingt:
Avé
Avé
Avé Mariaa –
Es ist so einfach, daß es ein Kind nachsingen kann. Und da stehen sie nun vor dem Hospital de Notre-Dame-des-Douleurs und singen:
Sur cette colline
Marie apparut
Au front qu’elle incline
Rendons le salut:
Avé – Avé –
Ich darf mit ihnen gehn.
*
In den hohen hallenartigen Krankenzimmern ist helles Licht angezündet. Kerzen aller Art, kleine Tische sind aufgebaut mit beleuchtetem Kirchenschmuck. In den Betten liegen die Kranken und sehen mit glänzenden Augen auf den Zug, der da heransingt. Wir ziehen durch alle Gänge, durch die Korridore, in den Höfen sind wir, wir gehen durch alle Zimmer, durch alle, es soll keiner ausgelassen werden. Ave – Ave – Ave Maria –
Auf den Backenknochen liegt hektisches Rot, die Gesichter sind mit Schweißperlen besetzt, der Ausdruck ist fiebrig, aufgeregt … Ein Kind streckt die Hände nach den bunten Lichtern aus … Eine alte Frau schluchzt und kann nun gar nichts sehn vor Tränen. Ein Alter liegt mit gekreuzten Händen – ich weiß zufällig, wie er am Körper aussieht – er leidet Schmerzen. Wir steigen die Treppen hinauf, zum ersten Stock, zum zweiten … Die Mauern hallen vom Chorgesang wider. Wachsbleiche Frauengesichter sehen uns an, es ist so viel Zärtlichkeit in diesen Augen, kraftlose Hände liegen auf Decken, einmal weint ein ganzer Saal. Mir steigt etwas in der Kehle auf.
Inzwischen haben sie sich vor der Kirche und um die Kirche versammelt. Auf den Rampen stehen sie Kopf an Kopf, die Plattform ist gedrängt voll, der Platz ist leer, aber weit unten, an der Esplanade, tauchen Feuerfünkchen auf … Sie fangen an.
Und da leuchtet die Basilika, ihre Konturen sind mit Glühlämpchen nachgezogen, ein Scheinwerfer erhellt die Spitze des Turmes, der liegt in bleichem Licht und sieht aus, als verschwinde er in den Wolken, obenauf dem Pic du Jer, einem Berg in der Nähe von Lourdes, blitzt ein Feuerkreuz. Und da setzt sich die Prozession in Bewegung.
Hier hört jede Schätzung auf. Es ist einfach ein breiter Lichtstrom, der sich dahinbewegt, die Pünktchen ergießen sich glitzernd über den tiefen Abgrund vor der Kirche. Bevor sie sich auf der Esplanade versammeln, gehen sie über die Plattform, sie ziehen an mir vorbei, und ich höre alle einundfünfzig Strophen des Marienliedes »Espérance« – und »France« kann ich hören, und auch von der Wahrheit wird gesungen …
La France l’écoute
Se lève soudain.
Et se met en route
Chantant ce refrain:
Avé – Avé
Avé Maria –!
Aber nun sind die letzten hier oben vorüber, und der große Feuerzug ist auf dem Platz angekommen. Sie marschieren in Schlangenlinien, sie nähern sich auf dem gewundnen Lichtpfad immer mehr der Kirche … Und als sie nun alle, alle vor dem Tor der Kirche stehen, wie um Einlaß singend, da zischen einige: Ssss! – es wird einen Augenblick still, und dann steigt das Credo unter den Fackeln zum Himmel.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem … Sie singen es alle, Männer und Frauen, auswendig, alle die schwierigen lateinischen Worte, die sie französisch aussprechen: Spiritüs sanctüm … Das steht wie ein Wall da unten. Unerschütterlich, voller Kraft klingt das Credo.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
Das ist ein Tag in Lourdes.
III. Siebenundsechzig Jahre
Vor siebenundsechzig Jahren fing es an. Lourdes war damals »ein Haufe trüber Dächer, von traurigem Bleigrau; so stehen sie da, unterhalb der Straße eng zusammengedrückt«. Taine hat seine Reise im März 1858 abgeschlossen, er kam grade einen Posttag zu früh. Sonst hätte er folgendes beobachten können:
In Lourdes lebte zu dieser Zeit eine kleine Müllerstochter, Bernadette Soubirous, sie war vierzehn Jahre alt. Das Kind war immer krank, es litt an Asthma, an Atemnot, an schweren Hustenanfällen. Die Alten hatten viele Kinder und wenig Brot, es ging ihnen nicht gut. Im Sommer hütete die Kleine die Schafe in Bartrès, in der Nähe von Lourdes, bei einer Frau, die ihr Kind verloren und die kleine Soubirous genährt hatte. (Diese Frau ist noch am Leben.) Lesen und schreiben konnte sie nicht – aber an kalten Wintertagen, wenn in den Hütten abends kein Feuer brannte, um zu wärmen, und kein Licht, um zu leuchten, versammelten sich die ärmern Bauernfrauen und ihre Kinder in der kleinen Kirche zu Lourdes, und da erzählte der Curé fromme Geschichten, von göttlichen Erscheinungen, wunderbaren Quellen, Segen und Heilungen der Gebenedeiten – – Die Pyrenäen sind reich an solchen Legenden. Ihnen gemeinsam ist stets: die plötzlich auftauchende Erscheinung, meist eine weiße Frau, sie vertraut dem ahnungslosen Hirten ein gutes Geheimnis an, das der nie verraten darf, sie gibt ihm einen Auftrag, sie zeigt ihm eine Quelle, die Quelle heilt Kranke. Um Lourdes wimmelt es: Unsre Liebe Frau in Barbazan, Unsre Liebe Frau von Nestè, Médoux, Bétharram, Garaison, Bourisp – so viel Namen, so viel Wundererscheinungen, weiße Frauen, Heilquellen, Geheimnisse. In der abendlichen Kirche, wohlgeborgen vor den Schneestürmen, im Flimmer der Kerzen, die die Schatten im Halbdunkel auf Goldgrund tanzen ließen, saß die Kleine und sog in sich auf, was es da zu hören gab. Manchmal war sie traurig: in ihrer Atemnot hatte sie husten müssen und das Schönste nicht gehört.
Der Bruder ihrer Ziehmutter war ein Priester, er brachte oft bunte Bildchen mit und auch die Bibel und Heiligengeschichten, die das Mädchen nicht lesen konnte… Aber die Bilder konnte sie betrachten, die schönen Bilder mit der Heiligen Mutter Maria in weißem Gewande, mit den Rosenornamenten als Schmuck, die ihr fromme Maler zu Häupten gesetzt hatten, und sie sah sich diese Bilder gern an. Das, was ihr die Priester an solchen Winterabenden erzählten, war ihr geistiges Leben, denn sie war noch nicht eingesegnet und wußte weiter nichts von Religion als diese vagen und frömmelnden Historien. Da war von Gott- Vater die Rede, von der Heiligen Jungfrau, von Jesus und von der Dreieinigkeit und wohl auch von der unbefleckten Empfängnis.
Denn drei Jahre vorher, am 8. Dezember 1854, war von Pius IX. das Dogma der Conceptio Immaculata verkündet worden, das beinahe so viel Aufsehen gemacht hat wie das von der Unfehlbarkeit des Papstes. Diese Tatsache findet sich in der gesamten populären Bernadette-Literatur verschwiegen. Wir werden sehen, warum.
Am Donnerstag, dem 11. Februar 1858, fror es in Lourdes, der Himmel war grau, die Bauern machten, daß sie ihre Arbeit draußen beendigten und beeilten sich, in die Hütten an den Herd zu kommen. Der Müller Soubirous brauchte sich nicht zu beeilen: es war kein Holz im Hause. Die Kinder sollten Holz holen. Bernadette ging in die Kälte hinaus, ihre jüngste Schwester Toinette und eine Freundin, Jeanne Abadie, begleiteten sie. Die drei stiegen an den Abhängen herum, überquerten den Bach, der jetzt, abgeleitet, am Eisenbahndamm entlangfließt, und kamen schließlich in die Grotte. Winterstille und Geriesel von trockenem Laub. Da hörte sie ein dumpfes Geräusch. Sie hob den Kopf …
»Ich konnte nichts mehr sagen, und ich wußte gar nicht, was ich denken sollte, denn als ich den Kopf zur Grotte wendete, sah ich an der Felsöffnung einen Busch, aber nur einen, hin- und herschwanken, wie wenn großer Wind wäre. Beinah zu gleicher Zeit kam innen aus der Grotte eine goldene Wolke, und danach: eine junge und schöne Dame, so schön, wie ich niemals eine gesehen hatte. Sie stellte sich an der Öffnung auf, oberhalb des Buschs. Sie sah mich an, lächelte und machte mir ein Zeichen, näher zu kommen, grade wie wenn sie meine Mutter wäre.«
Die beiden kleinen Begleiterinnen hatten nichts gesehen, nur allein Bernadette. Erst war es in ihren Berichten »etwas Weißes«, dann eine Dame, dann eine wunderschöne Dame, mit weißem Gewand, blauem Gürtel und gelben Rosen zu Füßen – aber die sprach zunächst nicht, sie lächelte. Bernadette ging immer wieder in die Grotte. Die Mutter wollte das nicht. Die Grotte stand in keinem guten Ruf, Liebespaare pflegten sich dort zu verstecken, und wenn man wieder einmal am Morgen leere Flaschen und sonstige schöne Sachen dort gefunden hatte, stießen sich die Bauern in die Rippen und grinsten: »Heute nacht haben sie wieder Dummheiten in der Grotte gemacht!« Aber Bernadette ging wieder und wieder hin. »Sie« erschien ihr achtzehnmal.
Beim drittenmal sprach die Dame. Sie bat die Kleine, während vierzehn Tagen in die Grotte zu kommen. Bernadette versprach das. Und dann: »Trink aus der Quelle und wasch dich in dem Wasser!« – Es war aber keine Quelle da, das Kind kratzte die Erde auf, da lief ein dünnes Rinnsal über die Erde. Die Wunderquelle war geboren. Und später: »Sage den Priestern: sie sollen hier eine Kapelle bauen und in Prozessionen hierherkommen!« Und nun auf inständige Fragen, endlich, endlich: »Ich bin die Conceptio immaculata.« Die Dame, die dies gesagt hatte, sprach das bäurische Platt. »Qué soy ér’ Immaculada Councepsiou.« Und da war Bernadette schon nicht mehr allein.
Die Sache war durchgesickert, die Polizei mischte sich ein, mißtrauisch, liberal, halb aufgeklärt und durchaus dagegen. Der Priester des Orts war vorsichtig, skeptisch, außerordentlich klug. »Ein Wunder! Ein Wunder!« verlangte er. Und vor der Namensgebung: »Sage deiner Dame, daß ich sie nicht kenne – sie solle sich vorstellen.« Sie stellte sich vor, und nach jeder Halluzination wurde das Publikum größer, der Glaube stärker, die Legendenbildung wilder.
Bei alledem hat man sich die kleine Bernadette als ein bescheidnes, artiges, schwächliches Kind zu denken, das kein Wesens aus der Sache machte. Sie hatte einen schweren Stand: der Geistliche wollte nicht heran, die Polizei drohte, sie einzusperren, wenn dieser Unfug nicht aufhörte, und das Dorf verlangte seine Wunder. Ein alter Abbé, der als kleiner Junge sie noch gekannt hat, zeigte mir in Lourdes eine Fotografie, die angeblich an der Grotte während der Ekstase aufgenommen sein soll – ein offenbar gestelltes Bild, ohne jeden visionären Zug in dem kleinen Bauerngesicht. Das arme Ding mit seinen Läusen unter dem Kopftuch, bekam von allen Seiten zugesetzt, es prasselte nur so auf sie herunter: Klagen, Bitten, Beschwörungen, Segenswünsche… Schon wollten einige durch Handauflegen von ihr geheilt werden.
Ein Zug, ein einziger in diesen zahllosen Berichten ist rührend, zeigt, wie tief sich die Halluzination in das Kind eingefressen hat und beweist ihre wirkliche Herzensunschuld. Sie hatte dem Steuereinnehmer Estrade und seiner Schwester ihre Geschichte erzählt: »Also, die Dame bat mich, vierzehn Tage lang in die Grotte zu kommen.« – »Sag mal genau, wie sie gesprochen hat!« sagte der Steuereinnehmer. »Die Dame sagte: Wollen Sie so gut sein …« Und hier unterbrach sich Bernadette, senkte den Kopf und flüsterte: »Die Madonna hat Sie zu mir gesagt…«
Und nun gings los.
Die Presse nahm sich der Affäre an, die Artikel für und wider setzten ein ohne Ende, und die Polizei ließ die Grotte mit Brettern versperren. Die Gegend stand auf dem Kopf.
»Ein Wunder! Ein echtes Wunder! Hat sie nicht von der Conceptio immaculata gesprochen? Aber das Kind hat das Wort nie gehört, kann es gar nicht gehört haben!« – Die Bernadette-Literatur legt auf diesen Punkt den allergrößten Wert. Man kann nur Erinnerungen produzieren, während man halluziniert, sagen sie, (was falsch ist) – dieses schwierige Wort und der noch kompliziertere Begriff seien dem Kinde unbekannt gewesen. Nein, sie waren das nicht. Man wird nun verstehen, warum die Bernadette-Traktätchen so ängstlich darüber schweigen, daß das Dogma schon drei Jahre, ex cathedra verkündet, vorlag. Es war also nicht nur möglich, sondern höchst wahrscheinlich, daß das Kind diesen Ausdruck von den Priestern aufgeschnappt hat, ohne zu begreifen. Und man weiß, wie Latein auf die wirkt, die es nicht verstehen.
Die Grotte gesperrt? Streik der Bauarbeiter, Rumor unter den Bauern, die Grotte mußte wieder geöffnet werden. Bis zum Kaiser drang der Lärm, denn nun war aus den Halluzinationen eines kranken Kindes eine hochpolitische Affäre geworden. Kulturkampf? Napoleon III. tat das, was er immer getan hatte: er zögerte. Aber die Kaiserin lag ihm in den Ohren, es war das wohl auch kein casus belli, die innre Politik erheischte Frieden… Er gab nach. Der Polizeikommissar wurde versetzt, der Präfekt von Tarbes wurde versetzt – das Land hatte sein Wunder. Die Prozesse prasselten. Die ersten Heilungen wurden ausgerufen.
Denn die Quelle war da, das war kein Zweifel. Jetzt war es eine große Quelle geworden: sie gab zwölfhundert Hektoliter am Tage her. Nun wollen sogar die orthodoxesten Katholiken nicht, daß Bernadette dieses Wasser aus dem Nichts gerufen habe. Der Abbé Richard hielt schon im Jahre 1879 dafür, daß nicht das Kind die Quelle erschaffen habe, sondern Gott – die Kleine habe nur durch das Wunder eine bestehende Quelle entdeckt. Leute, die mit einer Wünschelrute umgehen, wissen etwas von den Prädispositionen gewisser Personen zu sagen, die auf Wasser, Metalle und Steinarten reagieren.
Herr Fabisch aus Lyon setzte der Jungfrau eine Statue, eben jene, die heute noch in der Grotte steht. Er ließ sich von Bernadette die Erscheinung beschreiben, war tief gerührt von der weichen Frömmigkeit der Kleinen und lieferte das Äußerste an Talentlosigkeit. Die Statue hat siebentausend Francs gekostet, genau die gleiche Summe zuviel. Als man Bernadette das Werk zeigte, lief sie zunächst fort, ein beachtliches und gutes Zeichen von Kunstverstand. Dann wurde sie beruhigt, noch einmal an die Figur herangeführt, die aussieht, wie wenn sie aus Seife wäre, und man fragte sie: »Ist das deine Jungfrau, so, wie du sie gesehen hast?« – Und sie: »Keine Spur.« Aber Fabisch kassierte ein, und die Priester aus Lourdes stellten auf.
Bernadette hatte kein Glück mit den Statuen. In der Ordenskapelle der Schwestern von Nevers zu Lourdes steht eine, von der hat sie gesagt: »C’est la moins laide de toutes!« –
Diese Madonna steht da, wo die Kleine bei den Schwestern im Klostergarten herumgehüpft ist, und die Oberin zeigte mir Kloster, Säulenhalle, Garten und eben diese Kapelle. Wenn die kluge und energisch aussehende Frau – Gott verzeihe mir diesen Ausdruck, aber sie sah so aus wenn sie von Bernadette und ihren Wundertaten berichtete, glaubte man, eine Walze rolle ab. Sie sprach wie ein Museumserklärer. Sie hatte das wohl schon so oft erzählt … Diesen eingelernten Eindruck machten übrigens viele Geschichten, die ich in Lourdes zu hören bekam.
Bernadette blieb bei ihrer Familie, und als sie es dort nicht mehr ertragen konnte vor Besuchen, Fragen, Verhören, Freunden und Feinden, die sie alle, alle sehen wollten, als sie immer und immer wieder ihren Bericht erzählen mußte, brachte man sie ins Hospital. Das hatte noch einen andern guten Grund: das Mädchen kränkelte. Im Krankenhaus wurde sie zunächst gepflegt, die Besuche wurden ferngehalten, später verrichtete sie Arbeiten in der Küche und machte sich auch sonst nützlich.
Die Kirche rechnet mit Jahrhunderten und in eiligen Fällen mit Jahren. Erst vier Jahre nach diesen Erscheinungen, am 18. Januar 1862, erschien der große Hirtenbrief des Bischofs von Tarbes, des Monseigneurs Bertrand-Sévère. »Ja«, sagte der Brief.
Kollekten, Gläubige, Kirchenbauten, Zusammenlauf aus aller Welt. Die Pilgerzüge setzten in voller Stärke ein. Im Jahre 1867 waren es schon 28 000 Menschen, die kamen. Das Wunder war im Gang.
Das ging nicht ohne die bösesten Zänkereien ab. Der Curé von Lourdes bekam den Monseigneur-Titel, aber das tröstete ihn wenig, er fühlte sich zurückgesetzt; die Orden bekriegten sich bis aufs Messer, warfen einander Habsucht, Neid, Mißgunst und übergroße Geschäftstüchtigkeit vor, und auch die Einwohner wüteten umher. Die Kirche hatte in kluger Voraussicht die Grundstücke gekauft, die der Grotte gegenüberlagen, um alle neugierige Nachbarschaft zu vermeiden. Welches Geschäft war den Lourdesen da aus der Nase gegangen –! Was wäre das gewesen –! »Hotelzimmer mit direkter Aussicht auf die Wundergrotte und alle Zeremonien! Abends Dancing!« Ein Jammer. Es roch nicht gut zum Himmel, was da aufstieg.
Und dann war da diese kleine Bernadette, die der Anstrom der Neugierigen immer noch suchte. Eine unangenehme Konkurrenz, dieses Werkzeug Gottes … Sie durfte fernerhin nicht mehr in Lourdes leben – vor allem: unter gar keinen Umständen durfte sie dort begraben liegen. Nur keine Ablenkung! Sie lebte auch nicht mehr da, sie starb nicht da. Man hat sie nach Nevers gebracht, einer kleinen Stadt südöstlich von Orléans, in das Mutterkloster des Ordens des Soeurs de la Charité de Nevers, und dort erlosch sie im Alter von fünfunddreißig Jahren. Sie hat keine Wunder mehr angezeigt und auch keines tun wollen, sie war eine schwächliche Person, die in Ruhe leben und sterben wollte. Sie ist sehr krank gewesen.
Jetzt, zu ihrer Seligsprechung im vorigen Jahr, haben sie sie exhumiert: der Körper war gut erhalten, ihr linkes Auge, das der Erscheinung zugewendet war, soll offen gewesen sein, ihr Grab so nach Blumen geduftet haben, daß – wie in Lourdes erzählt wird – Briefe, die dort gelegen hatten, dufteten … Man hat sie in einem Glassarg ausgestellt, es kommen viele Gläubige. Ich habe eine Reliquie geschenkt bekommen, ein Stückchen von ihrem Totengewand.
Eine Heilige –? Noch nicht.
In Lourdes wird ein alter Mann aufbewahrt, es ist ihr Bruder, der einen Andenken-Laden hatte und sich vorzeitig vom Geschäft zurückgezogen hat. Er empfängt viele Besuche, will aber keine haben – er ist ein stiller und ruhiger, etwas bäurischer Mensch. Nein, ich habe sein Ruhebedürfnis geehrt und ihn in Frieden gelassen. Er weiß auch nicht viel von damals zu vermelden – er war sieben Jahre alt, als Bernadette ihre Erscheinungen hatte. Aber wenn er einmal gestorben sein wird, und wenn alle persönlichen Erinnerungen verflogen sind, wenn die Gestalt der kleinen Bernadette weit, weit hinten im grauen Nebel der Geschichte verschwindet –: dann wird sie heilig gesprochen werden. Die Kirche ist so klug …
Denn über Bernadette Soubirous, die Müllerstochter, kann man heute noch kleine persönliche Bemerkungen machen, sie ist zu nah –. Jeanne d’Arc aber ist heilig und entlockt selbst einem so wilden Spötter wie Bernard Shaw – außen Stacheldraht, innen Gummibonbon – ein schönes Pathos.
*
Das ist die Geschichte der seligen Bernadette, zu der Hunderttausende in Lourdes beten. Tagaus, tagein… Aber immer andre. Denn das ist das Gefährliche an der Sache: tagaus, tagein darf man dergleichen nicht sehen. Der Mechanismus wird sichtbar…
Jede pélerinage ist höchstens vier, fünf Tage in Lourdes, und das ist sehr gut eingerichtet. Der längere Aufenthalt geht auf Kosten der Intensität. Man sieht zu viel.
Man sieht:
Die Ausstattung in den Kirchen. »Aber das übersteigt die kühnsten Träume. Mit Kunst, selbst mit Kunst in ihrer niedrigsten Entartung, hat das hier überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht einmal schlecht…« Nein, es ist grauslich. »Das ist alles so häßlich! Wenn es wenigstens naiv wäre – aber leider: grade das ist es nicht.« Das sagt ein Freigeist? Ein frecher Aufklärichtsmann? Ein Kerl, der vom Katholischen nichts versteht –? Ach, es ist J.-K. Huysmans, dessen »A rebours« Oscar Wilde zum Dorian Gray angeregt hat, der in den Schoß der Kirche zurückgekehrte, reuige Sünder. Und der muß es ja wissen. Er erklärt sich auch den Jammer dieser Geschmacklosigkeiten.
»Unzweifelhaft: solche Attentate können nur den rachsüchtigen Possen des Dämons zugeschrieben werden. Es ist das seine Rache gegen die, die er verabscheut…« Sein Buch »Les Foules de Lourdes«, eines der interessantesten Dokumente über diese Stadt, ist das Zeichen eines beklagenswerten Geisteszustandes, mit vielen lichten Momenten. Er beobachtet außerordentlich scharf – aber alle seine Schlußfolgerungen sind falsch. Der Teufel –? Hier irrt der Großpapa Dorian Grays; es ist nicht der Teufel, der Lourdes so scheußlich gemacht hat. Es ist der Bürger.
Lourdes ist ein einziger Anachronismus.
Diese organisierten Pilgerzüge mit der Eisenbahn und dem ermäßigten Billett, diese elektrisch erleuchtete Kirche, die aussieht wie ein Vergnügungslokal auf dem Montmartre, der grauenhafte Schund, der da vorherrscht – nicht nur in den dummen Läden, sondern in den Kirchen selbst – diese unfromm bestellten Altäre, Schreine, Ornamente, Decken und Beleuchtungskörper –: es ist die Industrie, die das nicht mehr leisten kann. In Carcassonne steht in der Kathedrale ein altes Taufbecken, das ist siebenhundert Jahre alt, und man möchte davor knien, so fromm ist es. Aber der, der es gemetzt hat, hat geglaubt, er hat seinen Glauben in den Stein versenkt; er machte ein Geschäft, indem er ihn lieferte, gewiß – aber es war doch ein Taufbecken, und der Mann wußte sehr wohl, was er da unter den Händen hatte, und was es galt. Heute –? »Und liefern wir Ihnen einen Posten Taufbecken 1a Qualität zu besonders kulanten Bedingungen.« Es ist aus. Die kirchliche Kunst kopiert sich selber, und wenns gut geht, sind die Kopien wenigstens anständig. Die Versuche, zu modernisieren, mißlingen kläglich – zwischen Erfrischungsraum im Warenhaus und Bahnhofshalle ist da keine Dummheit ausgelassen. Gefühle kann man nicht herstellen.
Daran sind übrigens die Juden schuld. Huysmans: »Die Priester sollten daran denken, wie sehr heutzutage das jüdische Element unter den Verkäufern von frommen Andenken dominiert. Getauft oder nicht: es hat den Anschein, als ob diese Kaufleute, neben der Sucht, Geld zu verdienen, nun auch das unfreiwillige Bedürfnis verspürten, den Messias noch einmal zu verraten: indem sie ihn in einer Gestalt verkaufen, die ihnen der Teufel eingeblasen hat.« Da kann man nichts machen.
Solch ein Wunderglaube, dessen Form die absolute Herrschaft der Kirche zur Voraussetzung hat, ihre Herrschaft besonders über die Finanzmächte der Länder – und dann diese Zeit: es ist eine Dissonanz der Epochen, die hier aufeinanderstoßen. Es klingt nicht. Und Kunstwerke bringt so etwas schon gar nicht hervor.
Und weil alles auf der Welt ein greifbares Symbol findet, so leuchtet abends die Basilika, oben strahlt das Kreuz in der Luft auf dem fernen Berge – und heller als alles andre brennt sich eine Flammenzeile in den dunklen Nachthimmel:
Hotel Royal
Unten klingt das Credo. Keine Zeit hat solche Sehnsucht nach Verkleidung wie die, die keine hat.
Ja, man sieht zu viel. Treibe dich vierzehn Tage in der Stadt herum, und du fühlst nie mehr nasse Augen, aber manchmal ein verdächtiges Zucken im Gesicht. In den Läden klingelt das Ave Maria, das einmal so schön geklungen hat, im Bauch von Heiligen Jungfrauen, die man innen erleuchten kann, Ansichtskarten, Bilder, Rosenkränze sind von auserlesner Scheußlichkeit … Nebenerscheinungen? Ich weiß doch nicht. Die Pilger fassens nicht so auf. Und während ich mich in Rumänien so oft gefragt habe: »Wo, in aller Welt, kann man nur einen solchen ausgemachten Plunder kaufen?« – Jetzt weiß ich es.
Ich sehe:
Die fetten Bischöfe, die hier Gastspiele geben, und die andern, die hier zu Hause sind – man sagt ihnen Schauspielergesichter nach, man müßte das differenzieren. Da gibt es ältere Heldenspieler, denen das Tripelkinn tragisch auf den Ornat fällt, da gibt es Bonvivants und Väterrollen, und einer sah aus wie ein listiger, verschmitzter Komiker – es hätte mich keinen Augenblick gewundert, wenn er die Soutane an zwei Zipfeln angefaßt und ein Couplet getanzt hätte. Ich gehe durch die Verkäufer am Gitter, wo sich der dürre Gebetlaut von drinnen fortsetzt, aber hier ist es kein Latein, sondern: »Les cierges – les cierges – les cierges –« und »Vanillevanillevanille …« Soll ich ihnen etwas abkaufen? Wenn ich sparsam sein will, tue ichs nicht. Denn im Hotel hing eine Tafel.
Pilger … welch altes, schweres Wort. Man denkt an Männer mit Barten und großen Stöcken, mit einem Bettelsack und einem Heiligenschein um den Kopf … »Die Herren Pilger«, stand im Hotel, »die ihre Einkäufe an Andenken im Laden des Hotels machen, erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.« Hierauf sehn sich freudig an, Pilgerin und Pilgersmann.
Und ich sehe: die Brancardiers.
Die Krankenträger leisten eine aufopfernde Arbeit. Es sind sämtlich Freiwillige, sie bekommen keinen Franc Bezahlung. Ihr Dienst ist unendlich ermüdend, er erfordert sehr viel Körperkraft, sehr viel Geduld, sehr viel Hingabe. Ihr Benehmen zu den Kranken ist rührend. Aber der angenehme Umstand, daß in allen Prozessionen und bei allen Veranstaltungen niemals ein Schutzmann zu sehen ist, wird dadurch aufgewogen, daß gewisse Träger sich schlimmer benehmen als acht Polizisten zusammen. Sie teilen ein und ordnen an, sie geben Befehle und sind nervös, lassen die Kranken in Frieden, aber treiben die Gesunden zu Scharen, obgleich das gar nicht nötig wäre – kurz: manche unter ihnen spielen die Rolle des dummen August, der herumwirtschaftet, während andre arbeiten. Da waren so schnurrbartgezwirbelte Gesichter, die krähten – Huysmans hat mal einen sagen hören: »Wir werden jetzt die Heilige Kommunion austeilen!« – mir war sonderbar zumute, als ich sie herumtanzen sah – das hatte ich doch schon einmal im Leben gesehen … »II y a beaucoup d’anciens officiers parmi eux!« sagte mir ein Abbé.
Da, über den Eisenbahndamm, fahren die Züge, da flattern die weißen Tücher zur Begrüßung und zum Abschied, und sie singen während der Fahrt, nach dem Wort eines katholischen Dichters, nicht als ob es nach Lourdes, sondern als ob es ins Fegefeuer ginge.
Und so vieles hiervon steht bei Huysmans. Sein Fanatismus hat ihn, den Frischbekehrten und also lächerlich Überhitzten, nicht gehindert, in Lourdes die Augen aufzumachen. Auf einen Teil der schwarzen Flecke hat er mich erst aufmerksam gemacht, und wenn ich zögerte, mir Luft zu machen, so stärkte mich ein Blick in sein Buch. Da stands noch viel schlimmer. Aber freilich: er glaubte an das Wunder.
Sein Resumé sieht so aus:
»Das steht fest: in Lourdes erreichen wir die letzten Niederungen der Frömmigkeit.« Sowie: »Lourdes ist ein riesiges Krankenhaus auf einem ungeheuern Jahrmarkt. Nirgends sonst gibt es einen solchen Tiefstand von Frömmigkeit, von Fetischismus bis zu postlagernden Briefen an die Heilige Jungfrau …«
Man darf nicht verweilen. Man sieht zu viel. (Aber nirgends sieht man Betrunkene, nirgends Leute, die in den Lokalen juchhein.)
Tagaus, tagein Prozessionen, Menschenversammlungen, Fackelzüge … nach dem achten Mal spürt man die treibende Macht und die Räder.
Und zu allen diesen Prozessionen, Menschenanhäufungen, Fackelzügen ist zu sagen, daß meine Generation den Krieg gesehen hat, wo sich oft Zehntausende auf einem Platz zusammenballten oder im Karree aufgestellt waren – zur Schlachtung. Der Respekt vor der Quantität an sich ist vorbei. Und wenn es nicht meine eigne Sache ist, die da durch eine Menschenmenge gefördert oder bekämpft wird, wenn es mich nicht berührt, was die vielen Lichter aufflammen läßt – dann greift es mir nicht ans Herz, und ich müßte lügen, wenn ich mich in den Strom der Begeisterung stürzte. Das Faktum allein, daß dreißig- oder vierzigtausend Menschen zusammenkommen, ist mir gleichgültig. Ja, wenn es der Weltfriede wäre, den sie da mit Gesang und Fackellicht verlangten! Wenn es ein einziger, tobender Protest gegen den staatlichen Massenmord wäre, ausgestoßen von Müttern, Witwen, Waisen… ich hätte wahrscheinlich geweint wie ein kleines Kind. So aber schlug keine Quantität in die Qualität um.
Man sieht zu viel. Man sieht, bei längerm Aufenthalt, wie es gemacht wird, sieht am Häuschen hinter der Basilika die Aufschrift »Hommes« – »Femmes« und »Cabinets Reservés«, wonach also zu schließen wäre, daß die Geistlichen, denen man sie reserviert hat, weder Männchen noch Weibchen sind… Man sieht die Kinoplakate an den Ecken, Fanale eines unentrinnbaren Zeitalters. Dies ist anders als der Jahrmarkt, der auch im Mittelalter jede religiöse Zeremonie und jede Hinrichtung begleitet hat. Dies hier ist mehr, selbständig richtet es sich neben der Kirche auf. Mady Christians, muß ich hier dich wiederfinden –? Wahrhaftig, da hingst du.