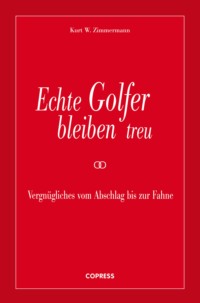Kitabı oku: «Echte Golfer bleiben treu»
Echte Golfer bleiben treu
Kurt W. Zimmermann
Echte Golfer bleiben treu
Vergnügliches vom Abschlag bis zur Fahne
COPRESS
Vollständige eBook-Ausgabe der im Copress Verlag erschienenen Printausgabe (ISBN 978-3-7679-1087-4).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2., durchgesehene Neuauflage 2015
© 2013, 2015 Copress Verlag
in der Stiebner Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Gesamtherstellung: Stiebner, München
ISBN 978-3-7679-2002-6
Für Uli Rubner, meine Frau. Sie liefert mir immer wieder originelle Ideen für meine Texte – aber das ist noch lange kein Grund, sie in diesem Buch zu verschonen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort oder das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten
Wir wissen genau, was wir tun
Ententanz gegen die Angst
Ein Philosoph im Klubhaus
Gentlemen only, Ladies forbidden
Paralyse durch Analyse
Singing in the Rain
Rommel, Hitler & Co.
Gute Laune, schlechte Laune
Der Polarbär in uns
Kennen Sie den schon?
Geschlossene Gesellschaft
Der Raum in unserer Seele
Der Schrei des Wasserschweins
Revolverhelden aus Wildwest
Echte Golfer bleiben treu
Nachbehandlung des Patienten
Otto Normalgolfer
Spiegeleier mit Speck
Die Kunst des Möglichen
C2H6O
Fünfzehn Jahre falsch gewürzt
Ich bin keine Micky Maus
Do it yourself
Mann gegen Mann: O’zapft is
Das Leben ist ein Probeschwung
Das ganze Jahr im Stress
Die Zerstörung einer Beziehung
Ich dachte dauernd an Sexpuppen
So werden Sie Golfer – garantiert
Wuchernd und blühend
Das Besteck im Kofferraum
Aussichtslose Flucht
Die Hose für Inselgolf
Der Pro
Der Highend-Royal-Pro-Titan-Caddy
Der A-Faktor
Eiserne Ladys
Bauarbeiter und Models
Verstehen heißt nicht bestehen
Ein Prozent an Lebensfreude
Leistungsgolfer und Spaßgolfer
Kein Alligator bei Aldi
Berberitzen statt Business
Schweigen ist Silber, Reden ist Gold
High Heels und Cohibas
Einer zahlt immer
Die Wahrheit und die Weisheit
Snobs und Proleten
Die Kathedrale der Kalorien
Unsere Heldengeschichten
Vorwort oder das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten
Stellen Sie sich einmal vor, wir gehen unter.
Stellen Sie sich vor, unsere Kultur geht unter, genauso wie die Kulturen der Azteken, der Ostgoten und der Mayas untergegangen sind.
Wir sind also untergegangen. Tausend Jahre später graben ein paar Archäologen die Überreste unserer Kultur aus. Als erstes graben sie einen Golfshop aus. Die Archäologen finden eine Menge von dünnen Metallstöcken. Dann finden sie eine Menge von weißen Bällen.
Die Archäologen schließen daraus, dass unsere Zivilisation mit diesen Metallstöcken die weißen Bälle in die Luft geschlagen hat. Die Bälle flogen dem Himmel entgegen. Die Archäologen sind darum sicher, dass es sich um ein religiöses Ritual gehandelt hat. Es war ein Ritual zur Anbetung des Sonnengotts.
Es ist tatsächlich nicht ganz leicht zu verstehen, was wir hier treiben. Wir hauen mit Metallstöcken weiße Bälle in die Luft. Wir hören erst damit auf, wenn der Ball in einem dunklen Loch verschwunden ist.
Dann ziehen wir gemeinsam ins Klubhaus und feiern, dass der weiße Ball in einem dunklen Loch verschwunden ist.
Jeder von uns entwickelt rund um diese seltsamen Aktivitäten einen sehr persönlichen Stil. Der eine konzentriert sich minutenlang, der andere haut einfach drauf. Die eine spielt nur in Lila, die andere nur mit gelben Bällen. Manche brauchen Zuspruch. Andere wissen alles besser. Die einen nehmen Golf tierisch ernst. Die anderen wollen nur ihren Spaß. Manche zittern vor Nervosität. Manche rauchen stoisch Zigarre. Der eine ist kollegial. Der andere betrügt. Manche lachen. Manche fluchen. Am einen Tag treffen wir jeden Ball. An nächsten Tag treffen wir keinen Ball.
Golf ist das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten.
Wir Golfer sind Individualisten. Wir sind Individualisten, die sich zu einem gemeinsamen Spiel zusammenfinden. Das ist eine wunderbare Ausgangslage, weil sie eine natürliche Spannung erzeugt. Das individuelle Verhalten des Golfers auf dem Platz steht seinem sozialen Verhalten auf dem Platz gegenüber. Das muss zwingend zu heiteren Situationen und vergnüglichen Beobachtungen führen.
Über Golfer zu schreiben, ist darum nicht schwierig. Sie geben immer wieder neuen, amüsanten Stoff her. Darum erscheint – nach den zwei Bestsellern »Echte Golfer weinen nicht« und »Echte Golfer fahren links« – nun mein dritter Band zur Verhaltenskunde der golfenden Gattung.
Auch wenn es genug amüsanten Stoff gibt, so ist man als Autor doch immer wieder dankbar für Hinweise zur golferischen Verhaltensbiologie. Ich freue mich stets über Hinweise zu all diesen Eigenheiten, Eigenwilligkeiten und Eitelkeiten der Golfergemeinde.
An solchem Input, so kann ich gerne bestätigen, ist kein Mangel. Wir Golfer sind eine Art Hobbysoziologen, die mit einem bemerkenswert scharfen Blick für unsere Umgebung ausgestattet ist. Wenn sie mit einer neuen Tigerhose auftaucht, ist das sofort ein Thema. Wenn er mit einem neuen Superdriver auftaucht, ist das sofort ein Thema. Wir sind nicht ganz frei von Voyeurismus.
Wenn wir also von einer Runde zurück sind, sagt zum Beispiel der Peter zu mir: »Warum schreibst du nicht einmal über diese Marotten auf dem Abschlag? Nimm zum Beispiel die Elisabeth.«
Später sagt die Elisabeth zu mir: »Warum schreibst du nicht einmal über diese Wichtigtuer im Klubhaus? Nimm zum Beispiel den Peter.«
Ich schreibe also über die Elisabeth und den Peter und all die anderen. Ich mache mich mitunter lustig über sie. Ich mache mich lustig auch über meine Freunde und Freundinnen.
Sorry Freunde – aber so ist das Golferleben.
Wir wissen genau, was wir tun
Golfer wissen selbst sehr genau, warum sie neben den Ball hauen. Danach hauen sie neben den Ball.
Auf unserer Golfrunde schlug meine Frau zweimal hintereinander in den Boden. »Du schlägst in den Boden«, sagte ich, »weil du während des Schwungs in die Knie gehst.«
»Ich weiß selbst, warum ich in den Boden schlage«, fauchte meine Frau zurück.
»Wenn du weißt, warum du in den Boden schlägst«, sagte ich, »warum schlägst du dann in den Boden?«
Das war eine äußerst sachliche, aber offenbar keine passende Frage. Der Blick, den sie mir zuwarf, wird in der Literatur gerne als »eiskalt« bezeichnet. Ich erwarb mir ihre Gunst erst später wieder, als ich ihr nach der Runde ein paar Gläser Champagner spendierte. »Den Champagner bitte eiskalt«, sagte sie.
Es gibt ein paar wirklich delikate Dinge auf dieser Welt. Delikat zum Beispiel ist die Frage, wie man am besten aus der Atomenergie aussteigt. Delikat sind auch die Pläne für neue Siedlungen im Westjordanland.
Noch delikater ist nur, einer Golferin oder einem Golfer zu sagen, dass er beim Golfen etwas falsch macht. »Ich weiß selbst, warum ich in den Boden schlage«, fauchen dann die Golferin und der Golfer zurück.
Damit sind wir bei der Frage, was Golf von Microsoft Excel oder von Autofahren im Winter unterscheidet.
Niemand hat ein Problem, wenn man ihm erklärt, dass man beim Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel mit der Tastenkombination STRG+X den Zellinhalt ausschneiden kann. Es ist nützlich, dies zu wissen. Niemand hat beim Autofahren ein Problem, wenn man ihm erklärt, dass man auf Schnee besser im zweiten Gang anfährt. Es ist nützlich, dies zu wissen. Jeder ist froh über den Tipp.
Wenn man aber dem Golfer etwas erklärt, dann findet er das nicht nützlich und ist er nicht froh über den Tipp. Er faucht.
Die Erklärung dafür ist einfach: Am Computer und beim Autofahren weiß man selbst genau, dass man nicht alles kann. Man ist dankbar für externe Hilfe.
Bei Golf hingegen weiß jeder sehr genau, wie es geht. Oder etwas präziser formuliert: Man weiß in der Theorie sehr genau, wie es geht. Man kann es nur in der Praxis nicht. »Ich weiß sehr genau, warum ich in den Boden schlage«, sagen wir dann.
Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis ist einer der Hauptgründe, warum Golf so faszinierend ist und warum wir so gern auf den Golfplatz gehen. Die Spannung zwischen Ist und Soll ist immer da. Manchmal wissen wir im Kopf genau, wie es geht, aber auf dem Platz geht es trotzdem nicht. Dann wieder wissen wir im Kopf nicht genau, wie es geht, aber auf dem Platz geht es wunderbar.
Als ich vor Kurzem wieder mit meiner Frau spielte, landete ihr Ball im Sand, eingegraben in der Bunkerkante. Ich hatte keine Ahnung, wie man so ein Ding herausspielt.
Sie machte nicht lange herum, holte aus, schlug drauf, der Ball stieg in die Luft und blieb einen halben Meter neben der Fahne liegen.
»Was sagst du jetzt?«, fragte sie. Der Blick, den sie mir zuwarf, wird in der Literatur gerne als »triumphierend« bezeichnet.
Ententanz gegen die Angst
Jeder von uns hat seine Marotten, Macken und Ticks. Auf dem Golfplatz helfen sie uns beim Überleben.
Meine Freundin Elisabeth ist eine gute Golferin. Sie erinnert mich an eine Ente.
Bevor Elisabeth abschlägt, hebt sie mehrmals die Arme und die Ellbogen an, dann geht sie drei- oder viermal in die Knie, bevor sie erneut die Arme und die Ellbogen anhebt. Dann erst schlägt sie ab.
Der Ententanz heißt im französischen Original »la dance des canards«. Es ist das bekannteste Stück des Komponisten Werner Thomas. Auf Englisch heißt das Stück »Chicken Dance«. Der Song wurde über vierzig Millionen Mal verkauft. Die Enten im Ententanz-Video tanzen genauso wie meine Ente Elisabeth.
Mein Freund Theophil ist ein guter Golfer. Er erinnert mich an einen Landvermesser. Beim Putten kniet er nieder und legt seinen Ball aufs Green. Er legt den Ball so hin, dass die Markeninschrift des Balls genau in die Mitte des Lochs zielt. Weil es wirklich genau die Mitte des Lochs sein muss, muss er den Ball mehrmals neu justieren. Das dauert gefühlte fünf Minuten.
Nach fünf Minuten Landvermessung puttet Theophil dann endlich und schiebt den Ball links oder rechts am Loch vorbei.
Im Fall von Dieter ist es ähnlich. Bevor er zum Driver greift, steckt er sich immer ein Holztee hinters Ohr. Dann erst schwingt er durch.
Ich habe ihn einmal gefragt, warum er sich vor dem Abschlag immer ein Holztee hinters Ohr stecke. »Weil ich den Ball sonst nicht treffe«, sagte er.
Gute Antwort. Fast alle Golfer haben irgendeine Marotte. Am häufigsten zeigt sich die Marotte bei der Vorbereitung zum Schwung. Da tanzen die Enten in jeder erdenklichen Form, da werden halsbrecherische Probeschwünge vollführt und symbolhafte Ballbeschwörungen ausgesprochen. Ähnlich verbreitet sind die Macken rund ums Material. Der eine kann nur mit roten Tees, die andere nur mit den teuersten Bällen, der Dritte nur mit einem Armreif aus Kupfer.
Warum stellt sich keiner ganz normal hin, haut ganz normal drauf und geht ganz normal weiter?
Ich habe in meiner Jugend einmal Psychologie studiert und kann mich darum als Experte aufspielen. Macken und Marotten haben mit Kontrolle und Kontrollverlust zu tun.
Macken und Marotten entstehen, wenn das Individuum weiß, dass es keine Kontrolle über seine Umgebung hat. Dann versucht es, diese Kontrolle mit Ritualen zurückzugewinnen. Die Rituale müssen ständig wiederholt werden. Die häufigsten dieser Ticks sind Reinigungs- und Ordnungszwänge. Manche waschen sich darum dauernd die Hände oder richten die Bücher im Büchergestell mehrmals täglich millimetergenau aus.
Macken und Marotten entstehen aus Angst vor Kontrollverlust. Jeder Golfer kann das sehr gut verstehen. Wenn es im Leben eines Golfers irgendetwas gibt, über das er keine Kontrolle hat, dann ist das Golf. Dieser Ansicht ist der lausigste Platzreife-Spieler genauso wie der letzte Sieger der British Open.
Die Psychologie sagt, dass eine Marotte erst dann zu einer zwanghaften Störung wird, wenn sie mehr als eine Stunde pro Tag beansprucht. Wenn der Putzfimmel also mehr als eine Stunde pro Tag verschlingt, dann muss man einmal mit einem Arzt reden.
Nun fällt mir wieder Freund Theophil ein, der Landvermesser, der den Ball dauernd so hinlegt, dass die Markeninschrift genau in die Mitte des Lochs zielt. Das dauert. Wenn ich zusammenrechne, beansprucht seine Ball-Macke rund eine Stunde pro Runde.
Ich glaube, ich muss einmal mit Theophil reden.
Ein Philosoph im Klubhaus
Genieße jeden Tag deines Lebens, sagt Epikur. Das braucht man uns Golfern nicht zweimal zu sagen.
Epikur, wie man weiß, war der Begründer des Hedonismus. Die philosophische Schule des Hedonismus stellt die Optimierung des individuellen Lebensglücks an die oberste Stelle der Werteskala. Die Leitlinie des Lebens ist das Lustprinzip.
Epikur, griechische Schreibweise Ἐπίϰουϱος, zog 307 v. Chr. von Samos nach Athen. Dort kaufte er einen üppigen Garten, den Kepos, in dem er nun einen großen Teil seiner Zeit verbrachte. Im Kepos traf sich manch fröhliche Runde zum Zechen und Palavern. Es war eine Art hellenistische Spaßgesellschaft.
Wir können davon ausgehen, dass Epikur seinen Lebensmittelpunkt heute nicht im Kepos, sondern im Klubhaus einrichten würde. Das wäre folgerichtig. Der Golfplatz ist in unserer Gesellschaft so etwas wie der letzte Garten des bekennenden Hedonismus. Nirgendwo sonst wird so freimütig gelacht, gebechert, geblödelt, geraucht und geschwatzt.
Ich kenne mich bei etlichen Subgruppen dieser Gesellschaft einigermaßen aus. Ich kenne die Subgruppe der Unternehmer, der Politiker, der Banker, der Beamten, der Geistlichen, der Bergsteiger und der Briefmarkensammler.
Aber es ist wahr: Ich habe noch nie so viele fröhliche Gesellen getroffen wie in der Subgruppe der Golfer und auch noch nie so viele Zigarrenraucher, Cognactrinker, Sportwagenfahrer und Gänseleberesser. Viele Golfer sind Lebenskünstler. Die Golferinnen sind leider keinen Deut seriöser, auch wenn sie Panetelas rauchen und Aperol Spritz statt Cognac trinken.
Und damit wären wir beim Problem.
Epikur gehört zu den meistgehassten Philosophen der Geistesgeschichte. Die Truppe der sittenstrengen Weltverbesserer versuchte, seine fröhliche Lehre immer wieder zu unterdrücken und zu verbieten. Vor allem den christlichen Kirchenfürsten ging Epikurs Philosophie gewaltig auf die Nerven. Martin Luther und die Calvinisten hassten ihn wie die Pest. Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel fand Epikurs lustbetonte Lebensfreude eine Zumutung.
Gegenüber uns Golfern ist die Wahrnehmung ganz ähnlich. Auch wir sind lebensfroh, und vielen gehen wir dadurch gewaltig auf die Nerven, obschon sie noch nie einen Golfplatz betreten haben.
Die Ablehnung, bis hin zum Hass, wird jeweils bei Golfprojekten sichtbar. Die Golfer werden nicht bis aufs Blut bekämpft, weil ihre Plätze eine ökologische Bedrohung wären. Umweltauflagen sind heute lösbar. Die Golfer werden bekämpft, weil man in ihnen Epikureer vermutet.
Unsere Gegner glauben, dass wir Golfer die Optimierung des individuellen Lebensglücks an die oberste Stelle der Werteskala stellen und unsere Leitlinie des Lebens das Lustprinzip ist.
Vermutlich haben sie sogar Recht. Doch damit gehen wir den Sauertöpfen natürlich gewaltig auf den Keks.
Epikur, wie jeder große Philosoph, hat eine Menge an anschaulichen Aphorismen hinterlassen. Die besten davon finden sich im Buch »Wege zum Glück«.
»Der Anfang des Heils ist die Kenntnis des Fehlers«, sagt zum Beispiel Epikur. Das sagt mein Golflehrer auch immer zu mir.
Gentlemen only, Ladies forbidden
Was bedeuten eigentlich die vier Buchstaben G-o-l-f? Es ist eine frohe Form des Geschlechterkampfs.
Es gibt eine ganze Menge Erklärungen, wie das Wort »Golf« entstanden ist.
Man kann die Frage etymologisch angehen. Die heutige Schreibweise findet sich erstmals im Jahr 1457, als das schottische Parlament »ye golf« verbot. Der Bann wurde nötig, weil die Armeeangehörigen zum Spaß dauernd Golf spielten, statt sich in der staatserhaltenden Pflicht des Bogenschießens zu üben.
Aus Holland wissen wir, dass es 1456 verboten wurde, ein Spiel namens »kolf« in der Nähe von Gotteshäusern zu betreiben. In Brüssel wurde das »colven« schon 1360 untersagt.
Zuerst einmal sehen wir also, dass die Geschichtsschreibung oft erst durch Verbote zustande kommt. Die Nachwelt erfährt, was die Vorfahren nicht durften. Das ist bis heute nicht anders. In unseren Gesetzen steht nicht, was erlaubt ist. Es steht nur, was verboten ist. Verboten ist zum Beispiel Steuern zu hinterziehen, im Restaurant zu rauchen oder nach der Golfrunde mit mehr als 0,5 Promille nach Hause zu fahren.
Man kann die Frage, wie das Wort »Golf« entstanden ist, aber auch weniger linguistisch und dafür lebensnaher angehen. In dieser Betrachtung ist vor allem die Interpretation von uns männlichen Kampfgolfern von Bedeutung.
»Golf« ist eine Abkürzung. Sie steht für: Gentlemen Only, Ladies Forbidden.
So erklären bis heute die Briten, wie das Wort Golf wirklich entstanden ist. Sie erklären es besonders gerne, wenn sie schon ein paar Bier intus haben. Tatsächlich waren bis ins 19. Jahrhundert Frauen und Hunde auf Golfplätzen nicht erlaubt. Eine Golfpartie war eine Herrenpartie. Das hat sich leicht geändert, weil heute nur noch Hunde auf der Spielbahn verboten sind.
Nicht geändert hat sich, dass Golf ein Refugium der Geschlechtertrennung geblieben ist. Geschlechtertrennung ist üblich im Golf. Aber das hat nichts mit Diskriminierung, sondern mit Vorlieben zu tun.
Es ist nun einmal so, dass Männer lieber mit Männern als mit Frauen Golf spielen. Das gilt ganz besonders für einen flotten Viererflight. Es spielen also Alex, Marco, Paul und Kurt am Dienstagnachmittag. Wir unterhalten uns zwischen den Schlägen über Sportwagen, Weine und Frauen. Hier würden Frauen nur stören.
Und es ist nun einmal so, dass Frauen lieber mit Frauen als mit Männern Golf spielen. Das gilt ganz besonders für einen flotten Viererflight. Es spielen also Christine, Ulrike, Bea und Sandra am Donnerstagnachmittag. Sie unterhalten sich zwischen den Schlägen über Häuser, Mode und Männer. Hier würden Männer nur stören.
Ich halte es für einen schönen zivilisatorischen Fortschritt, dass auf einer Golfrunde keine Frauenquote vorgeschrieben ist. Es braucht keinen Feminin-Proporz der heute üblichen 30 bis 50 Prozent. Und ich weiß, dass die Frauen es genauso schätzen, dass es keine Männerquote gibt. Ich halte es für einen zivilisatorischen Fortschritt, weil die Geschlechtertrennung auf dem Fairway freiwillig und spielerisch ist, und nichts mit der Verkrampftheit der politischen Diskussion zu schaffen hat.
Damit man mich richtig versteht: Natürlich spiele ich auch mit meiner Frau. Ich spiele mit ihr am Wochenende oder im Urlaub oder, wenn Alex, Marco und Paul aus anderen Gründen ausnahmsweise nicht verfügbar sind.
Paralyse durch Analyse
Das menschliche Gehirn ist mit einem Computer vergleichbar. Doch es hat einen unheilvollen Nachteil: Es denkt.
Der Satz ist von Lubo, und ich halte den Satz für genial. Lubo ist ein Golfkumpel aus der Tschechei. Wir spielen jedes Jahr ein paarmal miteinander.
»The brain is not your friend«, sagte Lubo.
Das Gehirn ist nicht dein Freund.
Lubo sagte den Satz, nachdem er einen kurzen Pitch statt an die Fahne in den Bunker gehauen hatte. Lubo klopfte daraufhin mit den Knöcheln an seinen Schädel und sagte: »The brain is not your friend.«
Lubo hat damit eine bemerkenswerte Golfweisheit geprägt. Golf gehorcht dem Gehirn nicht. Das Hirn ist auf dem Platz außer Kraft. Das Hirn ist nicht mit der Muskulatur verbunden. Ich vermute, dass Golf die einzige Sportart ist, bei der sich der Körper dermaßen vom Hirn entkoppeln kann.
Wenn das Gehirn eines Boxers dem Boxer sagt, er solle seine linke Faust ausfahren, dann fährt der Boxer seine linke Faust aus. Wenn das Gehirn eines Fußballers dem Fußballer sagt, er solle einen Rückpass spielen, dann spielt der Fußballer einen Rückpass. Es ist nicht denkbar, dass der Boxer stattdessen seine rechte Faust ausfährt und der Fußballer einen Steilpass spielt.
Bei uns Golfern ist diese Logik auf den Kopf gestellt. Wenn das Gehirn eines Golfers dem Golfer sagt, er solle einen kurzen Pitch an die Fahne setzen, dann setzt der Golfer einen langen Pitch in den Bunker. Wenn das Gehirn eines Golfers dem Golfer sagt, er solle einen Drive in die Mitte der Spielbahn schlagen, dann schlägt der Golfer den Drive links ins Gebüsch.
Unerklärlich, aber warum?
Oberflächlich betrachtet hat es damit zu tun, dass der Golfschwung eine äußerst komplexe Bewegung ist, bei der bis zu 130 Muskeln eingesetzt werden. Da kann beim physischen Zusammenspiel natürlich einiges schiefgehen.
Grundsätzlich betrachtet hat es damit zu tun, dass die Golfer auf dem Platz ihr Hirn überstrapazieren. Das unterscheidet sie von Boxern und Fußballspielern. Boxer denken während des Boxens nicht dauernd an die Probleme des Boxens. Fußballspieler denken während des Fußballspielens nicht dauernd an die Probleme des Fußballspielens. Sie fahren einfach die linke Faust aus oder spielen einen Rückpass, und damit hat es sich.
Golfer hingegen denken während des Golfens ununterbrochen an die Probleme des Golfens. Sie überlegen, ob der Wind von vorne oder von hinten kommt. Sie überlegen, ob die Fahne vorne oder hinten steckt. Sie überlegen, ob sie diesen oder jenen Schläger wählen. Sie überlegen, ob sie einen Fade oder eine Draw spielen. Sie überlegen, ob sie den Rückschwung eher hoch oder eher flach halten. Sie überlegen und überlegen und überlegen und denken und denken und denken.
Dann geht gar nichts mehr.
Es gibt einen schönen Ausdruck für diese Art von mentaler Selbstzerstörung. Er heißt »Paralyse durch Analyse«.
Vor lauter Analysieren paralysieren wir uns. Zehn Billionen Rechenoperationen schafft ein menschliches Gehirn pro Sekunde. Das entspricht etwa der Leistung eines IBM-Supercomputers. Für den Golfplatz und seine Bündelung von Fragen über Fragen ist das nicht genug.
Das Gehirn ist nicht dein Freund. Das Gehirn ist auf dem Platz hoffnungslos überfordert.
Singing in the Rain
Golfer und Fischer sind die zwei einzigen Volksgruppen, die sich auch im Regen amüsieren.
Für Sonntagvormittag hatten wir uns mit Carmen und Urs auf eine Runde verabredet. Als wir gegen neun Uhr aufwachten, regnete es. Es regnete ziemlich stark.
Ich rief also Carmen auf ihrem Handy an. »Schade«, sagte ich, »aber da wird nichts draus. Wir gehen ins Museum statt auf den Golfplatz.«
»Aber hallo«, sagte Carmen, »wir sind schon da.«
Bevor wir zur Frage kommen, warum erwachsene Erdenbürger in prasselndem Regen Golf spielen, schiebe ich kurz den klassischen Witz in dieser Angelegenheit ein.
Es regnet. Zwei Golfer kommen auf ihrer Runde an einem Punkt vorbei, von dem aus sie einen Fluss überblicken. Kopfschüttelnd sagt der eine: »Schau, diese zwei Deppen da drüben, die fischen sogar in strömendem Regen.«
»Nichts da Museum«, sagte nun Carmen, »Abschlag ist in sechzig Minuten.«
Wir stiegen also in den Keller hinunter. Wir konnten uns dunkel erinnern, dass wir aus alten Zeiten irgendwo eine Regenuniform hatten. Tatsächlich fanden wir im Schrank zwei wasserdichte Hosen, Jacken und Hüte. Sie waren reichlich angestaubt. Die zwei Schirme mussten wir nicht suchen. Die stecken stets in unseren Golfbags. Sie sind innen silbern beschichtet, weil dies am besten gegen die Sonne im Sommer hilft.
Wir spielten also mit Carmen und Urs. Es schüttete ohne Unterlass. Nach neun Löchern schlug ich vor, man könnte nun die nasse Übung abbrechen und sich ins warme Klubhaus verschieben. Carmen und Urs schauten mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte. Ich realisierte wieder einmal, was echte Golfer sind.
Es gibt nur wenige andere Sportarten, die derart regenfest sind. Ich habe zum Beispiel noch nie Tennisspieler in Regenjacken und Regenhosen auf dem Platz gesehen. Auch Springreiter mit Schirm sind selten. Am nächsten verwandt sind uns tatsächlich die Fischer. Die treiben es auch bei jedem Wetter.
Als wir nach der Runde, frisch geduscht, ins Klubhaus einbogen und zur Speisekarte griffen, musste auch ich mir sagen: Das war gar nicht schlecht. Nach 18 Loch im Regen hat man das Gefühl, für diesen Tag wirklich etwas geleistet zu haben. Ich bezahlte Carmen zum Dank für die nasse Runde einen Martini Dry.
Spielen im Regen hat mit der Tradition dieses Sports zu tun. In Schottland, wo Golf zum Alltag gehört, regnet es dauernd. Edinburgh zum Beispiel zählt im Jahr 191 Regentage. Interessanterweise spielen viele Schotten aber auch im Regen nicht in diesen wasserdichten Uniformen, wie wir das tun. Sie tragen eine Flanellhose und einen Strickpullover. Spielt eh keine Rolle, sagen sie sich. Spielt vermutlich wirklich keine Rolle.
Oder, wie im Witz, nur ganz selten: Ein Golfer spielt jeden Sonntagmorgen und kommt immer erst am Nachmittag heim. An diesem Morgen aber regnet wie aus Kübeln, der Platz ist gesperrt. Er fährt vom Platz also wieder nach Hause zurück, kriecht zurück ins Bett und flüstert: »Das Wetter da draußen ist fürchterlich.« »Und trotzdem«, sagt sie, »spielt mein blöder Ehemann da draußen auch heute wieder Golf.«
Rommel, Hitler & Co.
Wenn er direkt ins Loch trifft, dann sagt der Golfer beschwingt: »Mir ist ein Boris Becker gelungen.«
Wissen Sie was ein »Rommel« ist? Ganz einfach. Sie schlagen den Ball aus dem Bunker und landen im nächsten Bunker. Sie marschieren also von einem Sand zum nächsten Sand. Ein »Rommel«.
Generalfeldmarschall Erwin Rommel war der Chef der Wehrmacht in Afrika. Man nannte ihn Wüstenfuchs. Er verbrachte seine Karriere primär im Sand Nordafrikas. Rommel kannte sich aus im Sand.
Wissen Sie was ein »Hitler« ist? Ganz einfach. Sie schlagen den Ball im Bunker und liegen nach dem Schlag immer noch im Bunker. Sie sind im Bunker und bleiben im Bunker. Ein »Hitler«.
Reichskanzler Adolf Hitler war der Chef des deutschen Reichs. Man nannte ihn Führer. Am Ende seiner Karriere hockte er nur noch in seinem Führerbunker in Berlin. Hitler kannte sich aus im Bunker.
Etwas, was ich an Golf sehr liebe, ist diese ironische Respekt-losigkeit auf dem Platz. Golfer haben ein loses Maul. Das lose Maul macht sie sympathisch.
Sie haben ein loses Maul, weil der Golfplatz ihr Territorium der Unbeschwertheit ist. Es ist ihr Gegenentwurf zur alltäglichen Realität der verbalen Selbstdisziplin.
Im Berufsalltag zum Beispiel sind wir ja alle ein Muster an Kontrolle und Verbindlichkeit. Wenn der Präsident des Aufsichtsrates in einer Sitzung einen völligen Quatsch erzählt, dann sagen wir nicht: »Das ist völliger Quatsch«. Nein, wir sagen stattdessen: »Geschätzter Herr Präsident, bei allem Respekt, aber Ihre brillante Idee ist womöglich noch etwas optimierbar.«
Wenn unser Golfkollege im Bunker steht, draufhaut, und der Ball im Bunker liegenbleibt, dann sagen wir nicht: »Geschätzter Golfkollege, bei allem Respekt, aber dein brillanter Schlag ist womöglich noch etwas optimierbar.« Nein, wir sagen stattdessen: »Ein ›Hitler‹.«
Das kleine Spiel mit den symbolischen Namen ist ein beliebtes Vergnügen auf dem Platz. Was zum Beispiel ist ein »Heidi Klum«? Etwas lang getroffen. Was ist ein »Günther Grass«? Schwierig zu lesen. Was ist ein »Monica Lewinsky«? Ganz knapp ausgelippt. Was ist ein »Prinzessin Diana«? Hätte besser einen Driver genommen. Was ist ein »Boris Becker«? Direkt ins Loch.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.