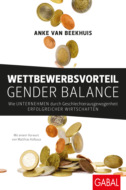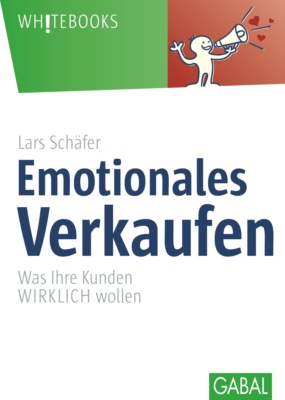Kitabı oku: «Verkaufen in digitalen Zeiten», sayfa 3
Google, Facebook, Red Bull und Co. als digitale Trendsetter
Es sind nicht nur Unternehmen wie Google (mittlerweile umfirmiert in »Alphabet«) und Facebook, die regelrechte Arbeitslandschaften für ihre Mitarbeiter und demnach auch für ihren eigenen Erfolg geschaffen haben. Auch die Red Bull GmbH hat sich im österreichischen Fuschl am See ein Denkmal erbaut, das aus der Vogelperspektive aussieht wie ein überdimensionierter Robinson-Club. Der Erfolg gibt dem Firmengründer Dietrich Mateschitz bislang recht: Ende 2015 betrug der Umsatz 5,9 Milliarden Euro bei weltweit circa 11 000 Mitarbeitern. Bei der Mitteilung des Gewinns hält man sich dort immer sehr bedeckt; allerdings sei der Betriebsgewinn in diesem Jahr wohl so hoch gewesen wie nie zuvor (Quelle: statista.com). Aber warum überhaupt betreibt ein Getränkehersteller solch einen Aufwand? Nun, ganz einfach: weil Red Bull streng genommen gar kein Getränkehersteller im klassischen Sinne ist, sondern nur ein Marketing- und Verkaufsunternehmen. Das Thema »Getränkeabfüllung« wird von externen Dienstleistern erledigt, im Unternehmen selbst braucht es jede Menge Kreativität, um die Marketing-Maschinerie am Laufen zu halten. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass solch verrückte Aktionen wie zum Beispiel das Red Bull Air Race an einem alten Schreibtisch unter Neonröhrenbeleuchtung entstehen könnten? Die Marken-Macht, die durch solche und weitere Veranstaltungen gefestigt wird, erlaubt dem Unternehmen, seine Getränkedosen zu einem hohen Preis zu verkaufen: Angeblich bleiben nach Abzug der Herstellungskosten satte 70 Prozent vom Verkaufspreis übrig, wovon ein großer Anteil wieder in das Marketing fließt.
Auch wenn das Beispiel Red Bull nicht wirklich repräsentativ für den mitteleuropäischen Raum sein mag, da die meisten Produkte und Dienstleistungen weniger publikums- und lifestylewirksam sind (30 Tonnen Flachstahl sind eben nicht wirklich sexy), so können wir doch festhalten:
Die Arbeitswelt und vor allem das Verkaufen werden sich in Zukunft grundlegend verändern. Der klassische Außendienstler, den Sie kennen, wird zukünftig anders arbeiten müssen.
Konkret: Zehn Kundenbesuche pro Tag an fünf Tagen in der Woche werden der Vergangenheit angehören. Stattdessen werden potenzielle Kunden noch viel gezielter angefahren werden, weil ein Großteil der Vertriebs- und Marketingaktivitäten und die Analyse von Marktteilnehmern, etwa bezüglich des Kaufverhaltens, es erforderlich macht, dass auch im Unternehmen selbst kreative und strukturierte Köpfe tätig sind, etwa im Innendienst. Der Kunde wird sich nicht mehr wirklich um viel kümmern müssen, da die Bestellvorgänge noch weiter automatisiert werden: Der Verkäufer vor Ort entwickelt sich zum hinweisgebenden Prozessbegleiter. In ihrem Buch Touch.Point.Sieg. bemerkt die Marketing-Expertin Anne M. Schüller sinngemäß, dass das Marketing und der Vertrieb aus ihrem jeweiligen Silo-Denken herauskommen müssen, wenn Unternehmen in der neuen Business-Welt dauerhaft erfolgreich sein wollen. Und das unterschreibe ich sofort! Der Kunde von heute ist der alten Werbemethoden überdrüssig und durchschaut mehr und mehr, was falsche Versprechungen sind und welchen Herstellern er Vertrauen schenken kann. Die Zeiten des »Wir kreieren eine Marketing-Maßnahme und Ihr Verkäufer setzt das jetzt mal um« sind definitiv vorbei.
Digitales Lernen
Wenn wir noch einmal gemeinsam im Geiste nach Kalifornien ins Silicon Valley reisen, fangen wir an zu verstehen, dass sich gerade viele Dinge grundlegend verändern. Einer der Forschungspioniere dort ist – wie kann es anders sein – Google: Mit Milliarden von Dollar im Rücken, die ja irgendwo investiert werden müssen, arbeitet man an der Pole Position im digitalen Universum. Alle Daten, die unsere Lieblings-Suchmaschine gespeichert hat, werden nun nach und nach zusammengeführt, um den Menschen, um Sie und Ihr Gehirn und Ihr Verhalten, besser zu verstehen. Dass daraus dann weitere Maßnahmen zur Umsatz- und Gewinnsteigerung abgeleitet werden, versteht sich von selbst.
Ein kleines, aber sinnbildliches Beispiel ist die Wissenschafts-App Science Journal: Diese Anwendung macht sich zunutze, dass in den marktüblichen Smartphones zahlreiche Messgeräte integriert sind. Bislang kann sie die Beschleunigung in alle drei Richtungen des Raumes, den Schalldruck und die Lichtmenge messen. Die Zielgruppen dieser App sind wissenschaftlich und physikalisch interessierte Kinder und auch Schüler und Lehrer. Diese können nun einen eigenen Versuchsaufbau erstellen, zum Beispiel die Beschleunigung eines Körpers auf einer Rutsche, die sich nebenan auf dem Spielpatz befindet. Dass das Smartphone währenddessen natürlich unaufhörlich Daten auf die Google-Server weiterleitet, ist (leider) auch wahr.
Die schnellste Evolution aller Zeiten
Paul Otellini, bis 2013 einer der Intel-CEOs, sagte einmal sehr plastisch: »Wenn die Automobilindustrie sich so schnell entwickelt hätte, wie wir bei Intel Prozessoren in den letzten 30 Jahren, dann würde ein Auto etwa 750 000 km/h schnell fahren, man käme mit einem Liter 600 000 km weit und das Auto würde 2,5 Cent kosten.« Während deutsche und europäische Autohersteller noch immer so tun, als wenn das 3-Liter-Auto ein Ding der Unmöglichkeit wäre, und man überdies das Feld der Elektroautos bis auf wenige Ausnahmen dem US-amerikanischen Mischkonzern Tesla Motors überlässt, werden wir technologisch rechts und links überholt wie ein Kleinwagen mit Wohnwagen im Schlepptau, der mit 80 km/h auf der mittleren Spur fährt. Ob Otellinis Aussage verifizierbar ist, kann ich nicht beurteilen, aber eines steht fest: Die Geschwindigkeit, mit der sich die digitalen Evolutionen die Klinke in die Hand geben, ist uns allen in den bisher bekannten Wirtschaftszweigen noch nicht untergekommen.
Kommt unser Hirn da noch mit?
Facebook, der Laden mit dem 40 000 qm großen Großraumbüro, der von 1,5 Milliarden Menschen täglich mit Informationen gefüttert wird, arbeitet aktuell (2016) an der Entwicklung künstlicher Intelligenzen: So werden zum Beispiel circa zwei Mrd. Dollar in die Entwicklung einer Virtual-Reality-Brille investiert. Eine Brille, die uns eine eigene Welt vorgaukeln soll; eine Brille, die mittels Sensoren, die an bestimmten Stellen unseres Kopfes angebracht werden, Gefühlsregungen wahrnehmen und in die virtuelle Welt übertragen und mittels elektro-magnetischer Impulse Gefühlsregungen bei uns erzeugen soll. Wie auch immer das dann einmal aussehen mag, wenn es fertig ist: Ich finde es unerhört spannend und gleichzeitig auch ein wenig beängstigend. Denn: Wie reagiert unser Gehirn, und wie werden wir als Menschen auf diese Eindrücke und – ja, nennen wir das Kind ruhig einmal beim Namen – auf diese virtuelle Manipulation reagieren?
Wer zum Beispiel in den 1980er-Jahren ferngesehen hat, der weiß, was nach heutigen Gesichtspunkten Langsamkeit bedeutet: Da gingen in einem Film zwei Menschen minutenlang eine Straße hinunter. Ohne zu sprechen. Ohne dass irgendetwas explodierte oder implodierte. Einfach so. Wenn Sie eine solche Filmszene einem jungen Menschen präsentieren, der im Jahr 2000 geboren wurde, werden Sie als aktivste Reaktion einen verwunderten Gesichtsausdruck kassieren. Ich glaube, dass dieser junge Mensch, der an sehr viel schnellere Bildwechsel aus den aktuellen Action-Filmen und Games gewöhnt ist, einschlafen wird. Das Beispiel zeigt uns, dass unser Gehirn durchaus in der Lage ist, mehr aus sich herauszuholen und zu leisten, als es bislang leisten musste. Und das ist ja auch wissenschaftlich auch längst belegt. Unser 2000er-Baujahr-Mensch geht viel souveräner mit Multi-Tasking auf relativ hohem Niveau um als etwa die 1970er-Generation. Allerdings ist das, was wir bisher kennen, erst der Anfang der Möglichkeiten, der Anfang der Evolution unserer Gehirne.
Ziel: das digitale Gehirn
Wir werden in den kommenden Jahren unser Gehirn neu trainieren und justieren müssen. Die Art des Lernens, des Erfahrens und des Erlebens wird sich fundamental von unseren heutigen Gewohnheiten unterscheiden.
Das Gehirn muss auf Multi-Tasking programmiert werden, damit es die enormen Datenmengen verarbeiten und »menschgerecht« filtern kann.
Es wird spezielle Lernprogramme geben, um unsere Synapsen schneller und vielfältiger feuern zu lassen. Einer der Protagonisten im Silicon Valley träumt davon, dass sein Gehirn, ähnlich wie eine Kamera mit unendlichem Speichervolumen, alles aufzeichnet, was es erlebt und wahrnimmt, sodass er sein Leben bis ins Detail jederzeit wieder aufrufen kann, jede einzelne erlebte Sekunde. Ich finde, das ist ein sehr schräger Traum, spannend und beängstigend zugleich. Ich würde mich allerdings nicht wundern, wenn diese erlernte Fähigkeit irgendwann einmal Realität werden wird.
Bis es so weit ist, gibt es andere Möglichkeiten, die gerade entwickelt werden: Sogenannte Daten-Jongleure erwachsen zur neuen Schaltzentrale für unsere Bedürfnisse. Die Betreiber der bekannten Chatprogramme wie WhatsApp oder vor allem auch WeChat aus China planen, alles Wissen dieser Welt zu vereinen, sodass wir keine weiteren Apps auf unseren Smartphones benötigen. Durch unsere Sprachbefehle werden die jeweils gewünschten Dienstleister direkt angesteuert, ganz gleich, ob es um ein Reiseangebot, eine Flug- oder Zugverbindung oder einfach den nächsten Blumenladen geht. Den Anfang in der westlichen Hemisphäre macht einmal mehr Google: Die App Google Allo wirbt damit, dass die Nutzer noch emotionaler und noch viel toller als bisher bekannt chatten können, und bietet ganz nebenbei den Google Assistant an, den Sie alles fragen können, was das Herz begehrt, denn die weltgrößte Suchmaschine ist ja direkt angeschlossen. Wenn Sie den virtuellen Chatpartner @google zu Ihren jeweiligen Unterhaltungen hinzufügen, aktivieren Sie ein kleines Helferlein, das mitliest und ganz automatisch Antworten auf Ihre Chat-Fragen gibt, wie zum Beispiel »Wann fährt denn der Bus?« oder »Was kosten denn die Eintrittskarten?«. Toll, oder? Dass Google dann natürlich ebenfalls weiß, wo Sie wohnen, von wo genau aus Sie wegfahren und dass Sie zum wiederholten Male auf diese bestimmte Erotikmesse wollen, wird dabei nicht von jedem Nutzer bedacht. Entscheiden Sie selbst, ob Sie das gut finden.
Also, liebe Unternehmen, wenn Sie wollen, dass bei aufkommenden Fragen im Chat der Name Ihrer Firma fällt, dann schmeicheln Sie sich schon einmal bei den bekannten und vielleicht auch noch nicht so bekannten Chat-Betreibern ein, denn davon hängt ein nicht unerheblicher Teil Ihres zukünftigen Gewinns ab.
Estland – ein Land geht digital voran
Wem das alles geografisch noch zu weit weg ist, der kann gerne einen Blick in ein ganz besonderes Land innerhalb der EU werfen: Estland. Die Esten sind in Europa die Pioniere in Sachen Digitalisierung. Alles, wovon wir hier in Deutschland noch träumen oder auch gar nicht zu hoffen wagen, wird dort schon längst umgesetzt. Bereits im März 2015 berichtete die Zeitung DIE WELT ausführlich darüber, wie sich dieses kleine Land durchdigitalisiert hat. Ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang vorweg: Die Bevölkerung Estlands hat im Gegensatz zu den Menschen im deutschsprachigen Raum keinerlei Bedenken oder gar Ängste, dass mit den Daten, die sie preisgeben und die über sie gesammelt werden, Schindluder getrieben wird. Dort herrscht eine Philosophie des digitalen Vertrauens vor, die auch durch die Regierung und die Staatsorgane geschützt wird. Gut – Estland hat nur knapp 1,3 Millionen Einwohner, da ist einiges leichter zu organisieren und umzusetzen als in deutlich größeren Ländern. Trotzdem möchte ich Ihnen einige Beispiele näherbringen, die verdeutlichen, was definitiv auch auf uns zukommen wird – übrigens durchaus sinnvolle Entwicklungen, durch die unser Leben enorm erleichtert wird.
•Behördengänge: Wer kennt das nicht, das stundenlange Warten und Herumsitzen zum Beispiel im Bürgerbüro, wenn der Personalausweis verlängert werden muss oder wenn Sie sich im neuen Wohnort anmelden müssen? Diese Behördengänge können sich die Esten sparen, wenn sie wollen: Jeder Bürger hat die Möglichkeit, eine computerlesbare ID-Karte zu beantragen, die gleichzeitig als Personalausweis gilt. Mit dem integrierten Chip ist eine Identifizierung im Netz möglich, und es können auch digitale Signaturen geleistet werden. Mit dieser ID-Karte kann man dort auch virtuell zur Wahl gehen: Das sonntägliche In-Schale-Werfen, um zur nächsten Wahlurne in der Grundschule nebenan zu gehen, entfällt damit. Davon sind wir in Deutschland leider noch meilenweit entfernt.
•Datentransparenz: Jeder kann jederzeit die über ihn gesammelten Daten einsehen und Erklärungen verlangen, wenn ihm etwas auffällt, das eventuell nicht rechtens ist: Unerlaubte Dateneinsicht wird juristisch geahndet. Transparenz schafft Vertrauen, nicht nur beim Thema »Digitalisierung«, hierbei aber ganz besonders.
•Der Alltag: Was die hier vorgestellten Annehmlichkeiten anbetrifft, so sind wir zumindest in Deutschland langsam, aber sicher auf einem guten Weg. Allerdings: Bustickets und Parkgebühren zum Beispiel können in Estland schon längst bargeldlos über das Smartphone bezahlt werden, wohingegen hierzulande erst zaghafte Versuche laufen.
Big Data lebt
Was in Estland ebenfalls schon weiter entwickelt ist als hierzulande, ist die Art und Weise, wie Verkäufer arbeiten: Sie sitzen vor riesigen Bildschirmen und analysieren jede Menge Daten, die firmenintern bereits vorsortiert wurden. Im B2C- beziehungsweise Endkunden-Vertrieb ist es schon längere Zeit üblich, das Käuferverhalten zu untersuchen und daraus dann spezielle Aktionen zu entwickeln, die genau diesem Verhalten entsprechen. Wenn zum Beispiel die Altersgruppe der 16- bis 20-jährigen Konsumenten Produkt X mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem Samstagmittag kauft, so sind Promo-Aktionen, die genau zu diesem Zeitpunkt stattfinden, sinnvoll – und nicht an einem Freitagvormittag. Die Verkäufer dort machen sich dieses Wissen zunutze, um damit bei ihren Kunden zu punkten und entsprechende Aktionen vorzuschlagen und vorzubereiten. Irgendwie ist das eine tolle Sache, finde ich, aber auch hier behaupte ich:
Der Mensch ist vielfältiger als sein Algorithmus!
Die Gefahr, aufgrund einer ausgeklügelten Statistik den Menschen pauschal in eine Schublade zu stecken, ist enorm groß. Wir können die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufsabschlusses zwar erhöhen, sollten aber nicht die Person hinter der Statistik außer Acht lassen. Bei den Unmengen an Daten, die erzeugt und analysiert werden, kommt am Ende immer wieder der Mensch mit seinem Verstand und seinem Gefühl ins Spiel. Irgendwer muss diese Bits und Bytes zum Leben erwecken, sprich: in umsetzbare Handlungsweisen umwandeln, und das wiederum bedeutet, dass sich das Verkaufen zwar stark verändern, der Verkäufer an sich allerdings auf jeden Fall überleben wird.
Neue Konzepte können scheitern – und gelingen
Wir verabschieden uns von Estland. Wie es hierzulande ausschaut, zeigen die nächsten recht unterschiedlichen Beispiele.
Auf Wiedersehen, Tante Emma!
Dass nicht jedes hoffnungsvolle und disruptive Konzept funktionieren muss, belegt das Düsseldorfer Unternehmen »Emmas Enkel«. Die zwei jungen Gründer der Firma hatten die Idee, die alten Tante-Emma-Läden wieder auferstehen zu lassen und die altertümliche Gemütlichkeit des Einkaufens mit der neuen Welt des Online-Handels zu verbinden. Die Kunden hatten dabei verschiedene Möglichkeiten, um dort einzukaufen:
•entweder old-school im Geschäft, wobei es eine gute Tasse Kaffee gab, während man in einem gemütlichen Sessel darauf wartete, dass die ausgewählte Ware zusammengepackt wurde, oder anhand von QR-Codes, die draußen an der Scheibe klebten,
•oder internetaffin direkt über das Netz oder per App. Die Kunden konnten sich einen Zeitraum aussuchen, zu dem die Ware geliefert werden sollte.
Das Konzept hat tatsächlich funktioniert. Zumindest in den jeweiligen Stadtgebieten, aber es sollte ja noch weiterentwickelt werden. Dieses kleine Unternehmen wurde medial dermaßen gefeiert, dass es sich sogar einen Pressesprecher leisten konnte – beziehungsweise musste, um der Flut der Anfragen jeglicher medialer Couleur Herr werden zu können.
Dass diese innovative und sympathische Erfolgsgeschichte natürlich bei den Unternehmen Begehrlichkeiten weckte, die dieses Knowhow aus den verschiedensten Gründen nicht in ihren eigenen Reihen hatten, sich aber gegen die neue Konkurrenz mit Geld zu »wehren« und zu verteidigen wussten, ist logisch. Und so kam es, wie es kommen musste: Im Sommer 2016 übernahm der Handelsriese Metro die Mehrheitsanteile an Emmas Enkel, und die beiden Geschäftsführer stiegen aus dem Tagesgeschäft aus. Über deren Motivation zu diesem Schritt kann nur gemutmaßt werden. Es scheint allerdings klar zu sein, dass mit dieser Übernahme der muffig anmutende Wind der Old Economy durch die kleinen Läden geweht ist: Kaum war die Übernahme perfekt, wurden die Offline-Läden geschlossen, »da unsere Daten-Analysen klar gezeigt haben, dass online der erfolgversprechendste Kanal für Emmas Enkel ist – deshalb konzentrieren wir uns darauf«.
So ließ es jedenfalls Gabriele Riedmann de Trinidad verlauten, ihres Zeichens »Group Director Business Innovation« bei der Metro. Verzeihen Sie mir bitte diese vertrackten englischen Ausdrücke, aber erstens wird die Dame konzernintern so bezeichnet, und zweitens ist dieser ganze Vorgang leider auch bezeichnend: Da wird eine neue Idee, die sehr vielversprechend begann und vor allen Dingen auf Werten basierte, die jenseits des Shareholder-Value-Denkens ihren Ursprung hatten, mal eben durch den Reißwolf des Controllings gejagt – und heraus kommt die Schlussfolgerung, dass das Online-Geschäft die Marge optimiert und deshalb die Läden geschlossen werden müssen.
Dass hierbei die Seele des Geschäfts und damit die Tragfähigkeit für die Zukunft zerstört wird, ist in Big Data leider nicht vorgesehen.
Ich finde das sehr schade, zumal hier ein sehr originelles und meiner Meinung nach auch für den gesamten Einzelhandel tragfähiges Erfolgskonzept der reinen Margenoptimierung zum Opfer gefallen ist. Dieser Fall zeigt allerdings, dass die großen Konzerne händeringend den weltweiten Anschluss schaffen wollen. Wie und mit welchen Konsequenzen, ist scheinbar egal, Hauptsache es klingt digital.
Hallo, liebe Marktlücke »Sofortness«!
Dass es auch anders geht und es auch im deutschsprachigen Raum Unternehmen gibt, die mit ihrem disruptiven Geschäftsansatz Erfolg haben, beweisen unter anderem Restaurant-Dienstleister wie Booka-Table und OpenTable. Diese Firmen haben eine Marktlücke für sich entdeckt, die sowohl den Restaurantbesuchern als auch den Restaurantbetreibern nutzt: Über die jeweilige App oder auch über den PC können Sie sich ein schickes Restaurant aussuchen und direkt aus der Anwendung heraus Ihren Tisch reservieren. Nach dem Abschluss Ihrer Buchung bekommen Sie eine E-Mail oder eine SMS mit den Adressdaten des Restaurants, Ihren eingegebenen Daten wie Uhrzeit und Personenzahl, eine Anfahrtsbeschreibung und Hinweise auf Parkplätze, öffentliche Verkehrsmittel und noch einige Annehmlichkeiten mehr. Einfacher und bequemer geht es kaum. Für die Restaurantbetreiber bedeutet das natürlich eine höhere Auslastung und bessere Planbarkeit, was für jeden Unternehmer ein erstrebenswertes Ziel ist. Hier wird einerseits der Trend bedient, dass viele Menschen das Thema »Sofortness« auch und gerade im privaten Bereich ausleben und gleichzeitig sicherstellen wollen, dass sie nicht umsonst zu ihrem ausgesuchten Restaurant fahren müssen, weil kein Parkplatz mehr frei ist oder weil man eine Stunde auf den nächsten Tisch warten muss. Zudem bietet dieses System auch Unternehmen, die ihre Kunden zum Essen einladen wollen, eine einfach zu handhabende und verbindliche Buchungsplattform.
Hier ist die Verschmelzung zwischen On- und Offline-Welt bereits vorangekommen, und sie wird noch viel weiter fortschreiten. Wie wäre es denn mit einem Fitness-Armband, das spürt, wann Sie Nahrung zu sich nehmen sollten, und Ihnen darum Restaurants oder andere Verpflegungsmöglichkeiten anzeigt, die Sie dann über eben diese Plattformen buchen können? Der Gedanke ist bei den technischen Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt, gar nicht mal so abwegig: Die Fitness-Armbänder und die Reservierungsmöglichkeiten gibt es bereits, und der Rest ist nur noch eine Frage der Fantasie und der Programmierung – alles Weitere wird der Markt entscheiden.
Aber bevor der digitale Gaul vollkommen mit mir durchgeht, lassen wir doch einmal jemanden zu Wort kommen, der bereits mittendrin statt nur dabei ist: Daniel Simon ist Deutschland-Geschäftsführer der oben erwähnten OpenTable GmbH. Ich habe ihm ein paar Fragen zur digitalen Entwicklung in seinem Unternehmen gestellt, lesen Sie hier seine spannenden Antworten: