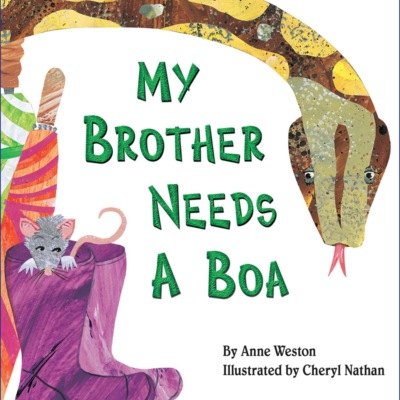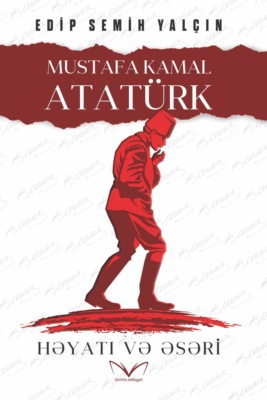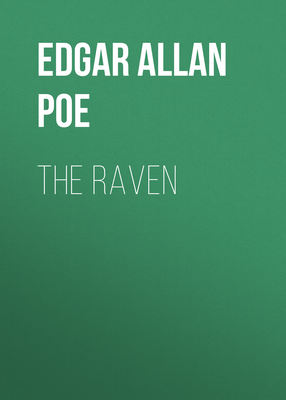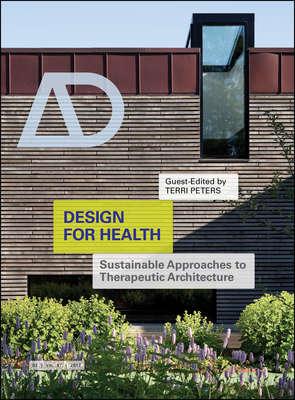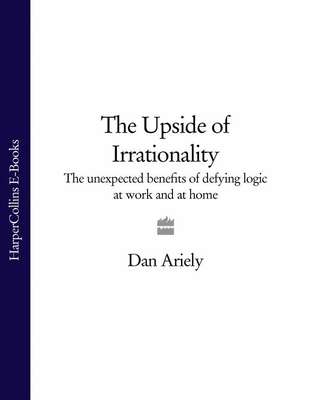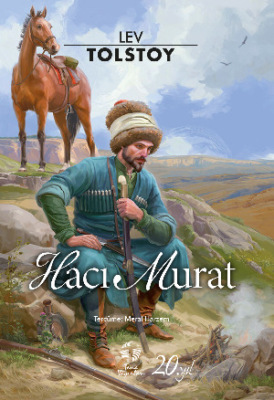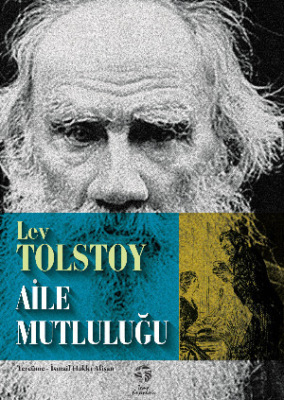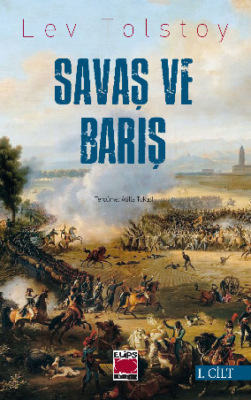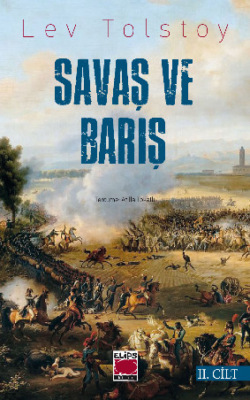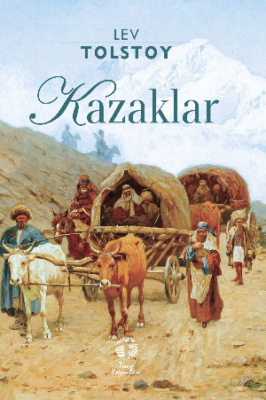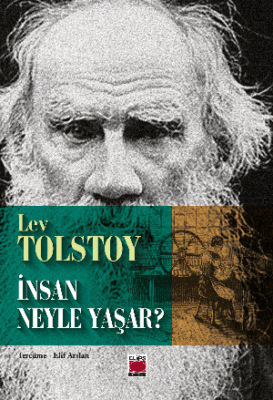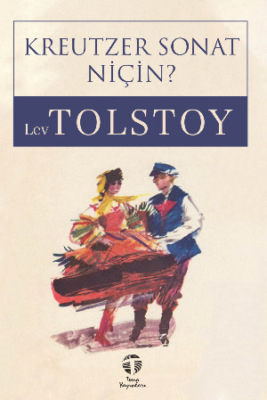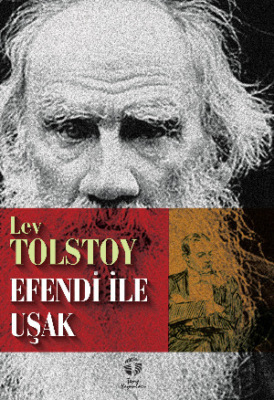Kitabı oku: «Anna Karenina, 1. Band», sayfa 45
14
Als Kity weggefahren und Lewin allein geblieben war, empfand dieser eine solche Unruhe in ihrer Abwesenheit, eine so unerträgliche Sehnsucht, so schnell als möglich die Zeit bis zum Morgen des anderen Tages hinzubringen, wo er sie wiedersehen sollte um sich für immer mit ihr zu vereinen, daß er vor den noch verbleibenden vierzehn Stunden, die ihm noch ohne sie bevorstanden, wie vor dem Tode erschrak. Er mußte um jeden Preis mit jemand sprechen, und um nicht einsam zu sein, um sich über die Zeit hinwegzutäuschen, wäre Stefan Arkadjewitsch für ihn der willkommenste Partner gewesen; aber dieser fuhr, wie er sagte, zu einem Abend, in Wirklichkeit jedoch nach dem Ballett. Lewin hatte ihm nur sagen können, daß er glücklich sei und ihn liebe und nie, nie vergessen werde, was er für ihn gethan. Der Blick und das Lächeln Stefan Arkadjewitschs bewiesen Lewin, daß jener dieses Gefühl verstehe, wie er es zu verstehen hatte.
„Nun, wäre es jetzt nicht Zeit zum Sterben?“ antwortete Stefan Arkadjewitsch, Lewin gerührt die Hand drückend.
„Nie!“ antwortete dieser.
Darja Aleksandrowna hatte ihn gleichfalls beim Abschied förmlich beglückwünscht, und gesagt: „Wie freue ich mich, daß Ihr wieder mit Kity zusammengetroffen seid; man muß eben alte Freundschaften hochhalten!“
Lewin waren diese Worte Darjas unangenehm gewesen. Sie konnte ja doch nicht verstehen, wie erhaben dies alles, wie unzugänglich es für sie war, und sie durfte daher nicht wagen, es zu erwähnen. Lewin verabschiedete sich, gesellte sich aber, um nicht allein sein zu müssen, zu seinem Bruder.
„Wohin fährst du?“
„In eine Sitzung.“
„Ich begleite dich – geht es?“
„Warum nicht? Komm mit,“ antwortete Sergey Iwanowitsch lächelnd, „was ist denn eigentlich heute mit dir?“
„Mit mir? Mit mir ist das Glück,“ antwortete Lewin, das Fenster des Wagens herablassend in welchem sie fuhren. „Fühlst du dich hier wohl? Es ist schwül. Mit mir ist das Glück. Weshalb hast du nie geheiratet?“ —
Sergey Iwanowitsch lächelte.
„Das freut mich sehr; sie scheint ein reizendes Mädchen“ – begann er.
– „Sprich nicht so, nicht so, nicht so,“ rief Lewin, ihn mit beiden Händen am Kragen seines Pelzes fassend. – „Ein reizendes Mädchen!“ – Das waren so einfache, prosaische Worte, so wenig seiner Empfindung entsprechend.
Sergey Iwanowitsch begann heiter zu lachen, was bei ihm selten der Fall war.
„Nun, aber ich darf doch sagen, daß ich mich sehr darüber freue.“
„Das darf man erst morgen, morgen; jetzt weiter nichts! Nichts, gar nichts; schweig also,“ versetzte Lewin, und fügte dann hinzu, „ich liebe dich sehr; werde ich denn der Sitzung mit beiwohnen können?“
„Versteht sich, kannst du.“
„Wovon ist denn heute die Rede?“ frug Lewin, der fortwährend lächelte.
Sie langten in der Sitzung an. Lewin hörte zu, als der Sekretär mit stockender Stimme das Protokoll verlas, welches er augenscheinlich selbst nicht verstand; doch bemerkte Lewin an den Zügen dieses Sekretärs, welch ein lieber, guter und prächtiger Mensch er war. Augenscheinlich wurde ihm das an der Weise, wie er, das Protokoll verlesend, aus dem Kontext kam und in Verwirrung geriet. Es begannen hierauf die Verhandlungen. Man debattierte über gewisse Summen und über die Aufführung einiger Essen. Sergey Iwanowitsch kritisierte beißend zwei Mitglieder der Sitzung und sprach lange und erfolgreich; ein anderes Mitglied, welches sich Notizen auf einem Papier gemacht hatte, geriet anfangs ins Schwanken, replizierte ihm aber dann sehr boshaft und gleichwohl freundlich.
Darauf sprach auch Swijashskiy – der gleichfalls hier war – gut und gediegen. Lewin hörte ihnen zu und erkannte klar, daß weder die besprochenen Summen und die Essen da wären, noch, daß die Sprecher wirklich in Erregung geraten wären, sondern alle so gut seien, so vorzügliche Menschen, und alles so gut und friedlich unter ihnen vor sich ginge. Sie selbst störten niemand und alle befanden sich wohl. Bemerkenswert erschien es Lewin, daß sie ihm alle jetzt durch und durch erkennbar waren; er erkannte an kleinen, früher unbemerkbar gewesenen Anzeichen den Geist eines jeden Einzelnen, und sah klar, daß sie alle gut waren. Insbesondere liebte heute jedermann Lewin ganz außerordentlich. Er nahm dies an der Art und Weise wahr, wie man mit ihm sprach, wie freundlich und liebevoll selbst die Unbekannten alle nach ihm blickten.
„Nun, was sagst du, bist du zufrieden?“ frug ihn Sergey Iwanowitsch.
„Sehr. Ich hätte nie gedacht, daß dies so interessant sein würde! Herrlich; sehr gut!“
Swijashskiy erschien jetzt bei Lewin und lud ihn zum Thee zu sich ein. Lewin vermochte nicht mehr zu begreifen, noch sich zu entsinnen, worüber er mit Swijashskiy unzufrieden gewesen war, und was er in demselben gesucht hatte. Er war doch ein ganz verständiger und wunderbar guter Mensch.
„Sehr erfreut,“ versetzte er und frug nach Gattin und Schwägerin. Durch einen seltsamen Gedankengang, indem nämlich in seiner Vorstellungskraft der Gedanke an die junge Schwägerin Swijashskiys sich mit dem an einen Ehebund verknüpfte, kam es ihm bei, daß er niemand besser von seinem Glück erzählen könne, als der Frau und der Schwägerin Swijashskiys, und so freute er sich darauf, zu diesen fahren zu können.
Swijashskiy erkundigte sich bei ihm über den Gang der Dinge auf dem Dorfe, wie stets so auch jetzt nicht die geringste Möglichkeit annehmend, daß man etwas erfinden könne, was in Europa noch nicht erfunden sei; aber dies war Lewin jetzt durchaus nicht unangenehm. Im Gegenteil empfand er, daß Swijashskiy recht habe, daß sein ganzes Unternehmen eitel sei, und erkannte die bewundernswerte Weichheit und Zartheit, mit welcher Swijashskiy die weitere Ausführung darüber, daß er eine richtige Anschauung vertrat, mied. Die Damen Swijashskiys waren ausnehmend liebenswürdig. Lewin schien es, als ob sie schon alles wüßten, und mit ihm empfänden, und nur aus Zartgefühl nicht davon sprächen. Er verblieb eine Stunde, zwei, drei bei ihnen, im Gespräch über verschiedene Dinge, und doch hatte er dabei immer das im Sinne, was ihm die Seele erfüllte, und er merkte nicht, daß er seine Umgebung entsetzlich langweilte und es längst die Zeit war, wo man sich zur Ruhe begab.
Swijashskiy begleitete ihn bis in das Vorzimmer, gähnend und verwundert über die seltsame Stimmung des Freundes. Es war zwei Uhr.
Lewin kehrte in das Hotel zurück und erschrak bei dem Gedanken daran, daß er jetzt allein mit seiner Ungeduld die ihm noch verbleibenden zehn Stunden werde ausfüllen müssen.
Der jourhabende Diener zündete ihm eine Kerze an und wollte gehen, aber Lewin hielt ihn zurück. Dieser Lakai, von dem Lewin früher nicht Notiz genommen hatte, er hieß Jegor, zeigte sich als ein sehr verständiger und angenehmer, und, was die Hauptsache war, guter Mensch.
„Es ist schwer, Jegor, wenn man nicht schlafen darf, he?“ —
„Was ist zu thun! Das ist einmal unsere Pflicht. Die Herren haben ja ein ruhigeres Leben; aber wir müssen rechnen.“
Es zeigte sich, daß Jegor Familie hatte; drei Knaben und eine Tochter, welche Nähterin war und die er an einen Commis in einem Kürschnergeschäft verheiraten wollte.
Lewin setzte hierbei Jegor seine Ansicht darüber auseinander, daß in einem Ehebund die Hauptsache die Liebe sei und man mit dieser stets glücklich sein werde, weil das Glück nur in sich selbst bestehe.
Jegor hörte aufmerksam zu; er verstand offenbar die Idee Lewins vollkommen, aber zu ihrer Bekräftigung machte er eine für Lewin unerwartet kommende Bemerkung, daß er, wenn er bei guten Herren gedient habe, stets mit seinen Herren zufrieden gewesen sei, und daß er auch jetzt mit seinem Herrn völlig zufrieden sei, obwohl derselbe ein Franzose wäre.
„Ein erstaunlich guter Mensch,“ dachte Lewin.
„Nun, und als du heiratetest, Jegor, hast du da dein Weib geliebt?“
„Wie hätte ich sie nicht lieben sollen?“ versetzte Jegor.
Lewin erkannte, daß Jegor sich ebenfalls in einem Zustande der Aufregung befand, und Lust hatte, ihm alle seine innersten Empfindungen mitzuteilen.
„Mein Leben ist gleichfalls wunderbar gewesen. Von Jugend auf,“ begann er mit glänzenden Augen und offenbar von der Aufgeregtheit Lewins angesteckt, so wie ja die Leute auch vom Gähnen angesteckt werden.
In dem nämlichen Moment ertönte indessen die Glocke; Jegor ging und Lewin blieb allein zurück. Er hatte fast nichts zu sich genommen bei dem Essen, den Thee und das Abendessen bei Swijashskiy zurückgewiesen, und mochte doch nicht an ein Abendbrot denken. Er hatte die ganze vorige Nacht nicht geschlafen, und mochte doch nicht an Schlaf denken. In dem Zimmer war es kühl, und doch war es ihm drückend heiß. Er öffnete beide Fenster und setzte sich auf den Tisch, den Fenstern gegenüber. Über einem mit Schnee bedeckten Dache war ein durchbrochenes Kreuz mit Ketten sichtbar und über demselben sich erhebend das Sternbild des Fuhrmanns mit der gelben, hellschimmernden Kapella. Er blickte bald nach dem Kreuz, bald nach dem Sternbild, sog die frische kalte Winterluft in sich ein, die gleichmäßig ins Zimmer hereinströmte, und hing wie im Traume den in seiner Vorstellungskraft aufsteigenden Bildern und Erinnerungen nach. Um vier Uhr vernahm er Schritte auf dem Korridor und schaute nach der Thür; ein ihm bekannter Spieler, Mjaskin, kam aus seinem Klub heim. Mißgestimmt, griesgrämig und hustend ging er vorüber.
„Armer Unglücklicher,“ dachte Lewin und Thränen traten ihm in die Augen in der Liebe und dem Mitleid mit diesem Menschen. Er wollte mit ihm sprechen, ihn trösten, aber indem er sich besann, daß er nur mit dem Hemd bekleidet sei, sah er davon ab und setzte sich wieder an das Fenster, um sich in der kalten Luft zu baden, und nach jenem seltsam geformten, schweigsamen, und für ihn doch so bedeutungsvollen Kreuz, sowie dem sich erhebenden, hellschimmernden Gestirn zu schauen.
Um sieben Uhr wurde das Geräusch der Fußbodenfeger vernehmbar, man schellte nach einer Dienstleistung; Lewin fühlte, daß es ihn zu frieren begann. Er schloß das Fenster, wusch sich, kleidete sich an und ging zur Straße hinab.
15
Auf der Straße war alles noch öde. Lewin begab sich nach dem Hause der Schtscherbazkiy. Die Hauptpforten waren geschlossen, alles schlief noch. Er kehrte um, ging wieder nach seinem Zimmer und bestellte Kaffee. Der jourhabende Lakai, nicht mehr Jegor, brachte ihm denselben. Lewin wollte ein Gespräch mit ihm anknüpfen, aber man schellte nach dem Diener und dieser ging. Er versuchte es nun, den Kaffee zu sich zu nehmen und Semmel in den Mund zu stecken, allein sein Mund wußte durchaus nicht, was er mit der Semmel beginnen sollte. Lewin spie sie wieder aus, legte seinen Paletot an und ging wieder fort. Es war zehn Uhr geworden, als er zum zweitenmal an der Freitreppe der Schtscherbazkiy ankam. Man war im Hause soeben wach geworden und der Koch ging gerade nach dem Küchenbedarf; es hieß also mindestens noch zwei Stunden warten.
Die ganze Nacht und den Morgen hatte Lewin vollständig ohne Bewußtsein verlebt und er fühlte sich auch gänzlich den Verhältnissen des materiellen Lebens entrückt. Den ganzen Tag hindurch hatte er nichts zu sich genommen, zwei Nächte nicht geschlafen, mehrere Stunden ausgekleidet in der Kälte zugebracht – und fühlte sich dennoch nicht nur frisch und gesund wie noch nie, – er fühlte sich gleichsam unabhängig von seinem Körper. Er bewegte sich ohne Anstrengung der Muskeln und empfand, daß er alles unternehmen könnte. Er war überzeugt, daß er in die Luft fliegen oder die Ecke eines Hauses vom Platze bewegen könnte, wenn es nötig gewesen wäre.
Während der ihm noch verbleibenden Zeit strich er in den Straßen umher, unaufhörlich nach der Uhr blickend und nach allen Seiten schauend.
Was er dabei sah, das hat er in der Folge nie wieder gesehen. Kinder, welche zur Schule gingen, blaue Tauben, welche von den Dächern auf den Trottoir herabgeflogen kamen, und Semmeln die mit Mehl bestreut, eine unsichtbare Hand auslegte, zogen ihn an.
Diese Semmeln, die Tauben und zwei Knaben waren für ihn überirdische Geschöpfe. Alles kam zu gleicher Zeit; ein Knabe lief nach einer Taube und blickte Lewin lächelnd an, die Taube schlug mit den Flügeln und flatterte davon, in der Sonne schimmernd und in den die Luft erfüllenden Schneekrystallen, und aus einem kleinen Fensterchen duftete es nach frischgebackenem Brot und hier wurden die Semmeln ausgelegt.
Alles das zusammengenommen war so außergewöhnlich lieblich, daß Lewin vor Freude lachen und weinen mußte. Nachdem er einen großen Bogen um den Gazetnyj-Pereulok und die Kislowka gemacht hatte, kam er endlich wiederum in seinem Hotel an und setzte sich nun, die Uhr vor sich hinlegend, nieder, um die zwölfte Stunde zu erwarten.
In dem Nebenzimmer sprach man über Maschinen und Schwindel, wobei Morgenhusten erschallte. Die da drüben wußten wohl noch gar nicht, daß der Zeiger bereits nach der Zwölf rückte. Der Zeiger war herangerückt und Lewin ging auf die Freitreppe hinaus. Die Kutscher wußten augenscheinlich alles; mit glücklichen Gesichtern umringten sie Lewin, ihm ihre Dienste um die Wette anbietend. Lewin wählte einen, versprach den übrigen, um ihnen nicht zu nahe zu treten, daß er sie ein andermal benutzen werde, und ließ sich zu den Schtscherbazkiy fahren. Der Kutscher sah vorzüglich aus in seinem weißen, aus dem Kaftan hervorstehenden, knapp am roten starken Halse anliegenden Hemdkragen. Der Schlitten dieses Kutschers war hoch, schlank; ein Schlitten wie ihn Lewin später nie wieder fuhr und auch das Pferd war gut und willig – kam aber nicht von der Stelle. —
Der Kutscher kannte das Haus der Schtscherbazkiy und nachdem er sich außerordentlich respektvoll zu dem Fahrgast gewendet und „tprru“ gemacht hatte, hielt er vor der Einfahrt still.
Der Portier der Schtscherbazkiy wußte augenscheinlich auch schon alles. Das war ersichtlich an dem Lächeln seiner Augen und an dem Tone, wie er sagte: „Recht lange nicht dagewesen, Konstantin Dmitritsch!“ Der wußte nicht nur alles, o nein, der triumphierte sogar schon augenscheinlich und bemühte sich nur, seine Freude zu verbergen. Als Lewin ihm in die alten guten Augen blickte, gewahrte er noch etwas ganz Neues in seinem Glück.
„Ist man schon aufgestanden?“
„Bitte, bitte! Bleibt nur hier!“ sagte er lächelnd, als Lewin umkehren wollte, um seinen Hut zu holen. Das hatte etwas zu bedeuten.
„Wem soll ich Euch melden?“ frug ein Diener.
Der Diener, obgleich noch jung und einer von den neuen Bediensteten und ein Fant, war dennoch ein sehr guter und ganz hübscher Mensch, und wußte jedenfalls auch schon alles.
„Der Fürstin, dem Fürsten, der jungen Fürstin,“ sagte Lewin.
Die erste Person, welche er erblickte, war Mademoiselle Linon. Sie schritt soeben durch den Saal und ihre Locken und ihr Gesicht glänzten. Er hatte kaum mit ihr zu sprechen begonnen, als plötzlich hinter der Thür das Rauschen eines Kleides ertönte und Mademoiselle Linon den Augen Lewins entschwand, während diesen selbst ein freudiger Schrecken über die Nähe seines Glückes überkam.
Mademoiselle Linon war fortgeeilt und hatte sich, ihn allein lassend, nach einer zweiten Thür begeben. Kaum war sie verschwunden, da ertönten schnell geflügelte Schritte auf dem Parkett, und sein Glück, sein Leben – er selbst – das Bessere seiner selbst, das, was er so lange gesucht und ersehnt hatte – schnell, schnell nahte es ihm. Sie kam nicht selbst, sondern mit unsichtbarer Macht ward sie zu ihm gezogen.
Er sah nun ihre klaren, treuen Augen, erschreckt von der nämlichen Freude der Liebe, die auch ihn und sein eignes Herz erfüllte. Diese Augen leuchteten näher und näher, sie blendeten ihn mit ihrem Liebesglanz. Dicht neben ihm blieb sie stehen, ihn berührend; ihre Arme hoben sich und schlangen sich um seine Schultern.
Sie hatte alles gethan, was sie thun konnte; sie war zu ihm geeilt und hatte sich ihm ganz gegeben, schämig, wonnevoll. Er umfing sie und preßte seine Lippen auf ihren Mund, der seinen Kuß suchte.
Auch sie hatte die ganze Nacht hindurch nicht geschlafen, und seiner den ganzen Morgen lang geharrt.
Vater und Mutter waren ohne Widerspruch einverstanden gewesen, glücklich in ihres Kindes Glück. Nun erwartete sie ihn; sie wollte als die Erste ihm ihr beiderseitiges Glück verkünden, und so hatte sie sich vorbereitet, ihn zu empfangen, und sich ihres Gedankens gefreut, obwohl sie schüchtern und verschämt werdend, selbst nicht recht wußte, was sie eigentlich thun sollte. Da hörte sie seine Schritte und seine Stimme, und wartete hinter der Thür, bis Mademoiselle Linon hinausgegangen sein würde, – und diese ging. Sie selbst aber, ohne sich zu bedenken oder sich selbst zu fragen nach dem Wie oder Was, eilte zu ihm und that was sie nun gethan hatte.
„Wir wollen zu Mama gehen!“ sagte sie, ihn am Arme nehmend.
Lange vermochte er nichts zu sagen; weniger deswegen, weil er fürchtete, mit einem Worte die Erhabenheit seiner Empfindung zu beeinträchtigen, als deshalb, weil er, sobald er etwas sagen wollte, statt der Worte Thränen der Glückseligkeit sich hervordrängen fühlte. Er ergriff ihre Hand und küßte dieselbe.
„Ist es denn wahr?“ sprach er endlich mit leiser Stimme, „ich kann es nicht glauben, daß du mich liebst.“
Sie lächelte bei diesem „du“, und über die Schüchternheit, mit welcher er sie anschaute.
„Ja,“ sagte sie dann, bedeutungsvoll und langsam; „ich bin so glücklich.“
Ohne seinen Arm loszulassen, trat sie in den Salon. Die Fürstin atmete bei dem Anblick der beiden schnell auf und brach sogleich in Thränen aus; sogleich aber begann sie auch zu lächeln, und trat ihnen mit so energischen Schritten, wie sie Lewin nicht erwartet hätte, entgegen, den Kopf Lewins umfangend, ihn küssend, und seine Wange mit ihren Thränen netzend.
„So ist denn alles gut! Wie freue ich mich! Liebe sie! Ich bin sehr glücklich – Kity!“
„Das hat sich ja recht schnell gemacht!“ sagte der alte Fürst, sich bemühend, unbewegt zu erscheinen, aber Lewin bemerkte doch, daß seine Augen feucht waren, als er sich zu ihm wandte. „Lange, immer habe ich dies gewünscht!“ sagte der Fürst, Lewin bei der Hand nehmend und ihn an sich ziehend, „schon damals, als jener Windbeutel dachte“ —
– „Papa!“ rief Kity, ihm den Mund mit der Hand verschließend.
„Nun, ich werde nicht plaudern,“ fuhr er fort: „ich bin sehr, sehr gl – ei, ei, was ich doch für ein Dummkopf bin“ —
Er umarmte Kity, küßte ihr Antlitz und ihre Hand, dann wiederum das Gesicht und segnete sie.
Lewin erfaßte ein neues Gefühl von Liebe zu dem Manne, der ihm fremd gewesen war – dem greisen Fürsten – als er gewahrte, wie Kity lange und innig seine fleischige Hand küßte.
16
Die Fürstin saß im Lehnstuhl, schweigend und lächelnd, der Fürst neben ihr. Kity stand an dem Sessel des Vaters, noch immer seine Hand nicht freigebend. Alle schwiegen.
Die Fürstin verlieh dieser Stimmung zuerst Worte und setzte alle Gedanken und Empfindungen in Lebensfragen um. Gleichwohl aber erschien dies ihnen allen seltsam und sogar unangenehm im ersten Augenblick.
„Wann wird es denn nun geschehen? Wir müssen die Verlobung feiern und bekannt machen. Und wann soll die Hochzeit sein? Wie denkst du, Alexander?“
„Hier ist er,“ antwortete der alte Fürst, auf Lewin zeigend, „die Hauptperson in dieser Frage.“
„Wann?“ frug Lewin, errötend. „Morgen. Wenn Ihr mich fragt, so könnten wir nach meiner Meinung heute einsegnen und morgen Hochzeit machen.“
„Genug, mon cher, das sind Dummheiten.“
„Also denn in acht Tagen?“
„Er ist ja wie verrückt.“
„Nun, weshalb denn?“
„Aber ich bitte Euch!“ fiel die Mutter ein, heiter lächelnd über diese Eilfertigkeit, „und die Aussteuer?“
„Muß da wirklich erst eine Aussteuer und anderes noch dabei sein?“ dachte Lewin voll Schrecken. „Indessen kann die Aussteuer oder die Einsegnung und alles übrige – etwa mein Glück zerstören? Nichts kann es zerstören!“ Er blickte Kity an und bemerkte, daß diese von dem Gedanken an die Aussteuer nicht im geringsten verletzt war; „wahrscheinlich muß es also so sein,“ dachte er nun.
„Ich verstehe allerdings gar nichts von solchen Dingen, und äußerte nur meinen Wunsch.“ sagte er, sich entschuldigend.
„So wollen wir also überlegen. Jetzt können wir die Einsegnung und die öffentliche Anzeige vornehmen.“
Die Fürstin trat zu ihrem Gatten, küßte ihn und wollte gehen, er aber hielt sie zurück, umfing sie, und küßte sie mehrmals zärtlich und lächelnd wie ein jugendlich Verliebter. Die beiden Alten gerieten offenbar einen Augenblick in Verwirrung und wußten nicht recht, ob sie wieder ineinander verliebt waren, oder ob nur ihre Tochter liebte. Als der Fürst und die Fürstin gegangen waren, trat Lewin zu seiner Braut, und ergriff sie bei der Hand. Er hatte jetzt seine Selbstbeherrschung wiedergefunden und konnte nun sprechen; er hatte ihr soviel zu sagen. Aber doch sagte er durchaus nicht das, was er hätte sagen sollen.
„Wie hätte ich ahnen können, daß es doch noch in Erfüllung gehen würde! Nimmermehr habe ich dies gehofft, aber in meiner Seele war ich stets davon überzeugt,“ sprach er, „und ich glaube, daß dies schon vorher bestimmt gewesen ist.“
„Und ich?“ versetzte sie, „selbst damals“ – sie stockte, fuhr aber dann fort, ihn mit ihren treuen Augen fest anblickend, „selbst damals, als ich mein Glück von mir wies, habe ich stets Euch allein geliebt, doch ich war verleitet. Ich muß es aussprechen – könnt Ihr vergessen?“
„Vielleicht ist es zum Glück gewesen. Ihr müßt mir viel vergeben. Ich muß Euch gestehen“ – er wollte das Eine von dem mitteilen, was er ihr mitzuteilen beschlossen hatte, und er hatte beschlossen, ihr von dem ersten Tage ab zweierlei mitzuteilen, das Eine, daß er nicht mehr so rein sei, wie sie; das Andere, daß er keinen Glauben habe. Es war dies peinlich, aber er hielt sich für verpflichtet, ihr dies und das andere zu sagen. „Doch nein; nicht jetzt, später!“ sagte er.
„Gut; also später; aber Ihr werdet es mir sicher sagen. Ich fürchte nichts. Ich muß alles wissen. Jetzt ist alles gut!“
„Gut geworden ist das, daß Ihr mich nehmt, wie ich auch sein mag, daß Ihr mich nicht von Euch weist; nicht wahr?“ ergänzte er.
„Jawohl!“ —
Das Gespräch wurde durch den Eintritt der Mademoiselle Linon unterbrochen, welche, obwohl verschmitzt, so doch zärtlich lächelnd kam, ihren geliebten Zögling zu beglückwünschen. Sie war noch nicht wieder hinaus, da kam schon die Dienerschaft zur Beglückwünschung. Dann erschienen die Verwandten und nun begann jener selige Taumel, aus dem Lewin nun bis zum nächsten Tage nach seiner Hochzeit nicht mehr herauskam. Ihm selbst war es dabei beständig unbehaglich, langweilig zu Mut, allein die Aufregung über sein Glück wuchs mehr und mehr. Er fühlte beständig, daß von ihm jetzt vieles gefordert würde, was er noch nicht kenne – er that alles, was man ihm sagte und dies alles verusachte ihm ein Gefühl des Glückes.
Er glaubte, daß sein Brautstand nichts Ähnliches mit demjenigen anderer haben würde, und die demselben sonst eigenen Umstände sein ganz besonderes Glück stören möchten; aber es kam so, daß er eben nur das Nämliche that, was alle anderen thun, und sein Glück wurde dadurch nur erhöht und gestaltete sich mehr und mehr zu einem ganz besonderen, das nichts Ähnliches je gehabt haben oder noch haben mochte.
„Nun wollen wir aber Konfekt essen,“ meinte Mademoiselle Linon und Lewin fuhr sogleich fort, um Konfekt einzukaufen.
„Ah, sehr erfreut über Euer Glück,“ sagte Swijashskiy, „ich rate Euch, die Bouquets bei Thomin zu holen.“
„Muß ich?“ und er fuhr zu Thomin.
Sein Bruder sagte ihm, daß er Geld werde aufnehmen müssen, da viel Ausgaben, Geschenke, nötig werden würden. „Geschenke sind erforderlich?“ frug er und eilte zu Fuld.
Und bei dem Konditor, wie bei Thomin und bei Fuld gewahrte er, daß man ihn erwartet habe, sich über ihn freue und über sein Glück frohlocke, wie es alle thaten, mit denen er in diesen Tagen zu thun hatte. Außergewöhnlich erschien ihm, daß jedermann ihn nicht nur liebte, sondern auch alle, die ihm früher nicht sympathisch gewesen waren, kühle und gleichgültige Menschen, von ihm entzückt waren, sich ihm in allem fügten, mit seinen Empfindungen zart und taktvoll umgingen und seine Überzeugung teilten, daß er der glücklichste Mensch auf Erden wäre, weil seine Braut noch mehr als die Vollkommenheit selbst sei.
Ganz das Nämliche empfand auch Kity. Als die Gräfin Nordstone sich erlaubte, Andeutungen zu machen, daß sie eigentlich etwas Besseres gewünscht hätte, geriet Kity in Zorn und legte ihr so eifrig, so überzeugt dar, daß es etwas Besseres als Lewin in der Welt nicht geben könne, daß die Gräfin Nordstone dies anerkennen mußte und in Gegenwart Kitys Lewin nicht mehr ohne ein Lächeln des Entzückens begegnete.
Die Erklärung, welche von ihm in Aussicht gestellt worden war, bildete das einzige Ereignis von Bedeutung in dieser Zeit. Lewin beriet sich mit dem alten Fürsten und übergab, nachdem er dessen Urteil gehört hatte, Kity sein Tagebuch, in welchem alles aufgezeichnet stand, was ihn bedrückte. Er hatte dieses Tagebuch eigens im Hinblick auf eine künftige Braut geschrieben. Zweierlei eben bedrückte seine Seele; er war nicht mehr unschuldig, und er glaubte nicht. Das Geständnis seines Unglaubens ging ungerügt vorüber. Kity war religiös, hatte nie an den Wahrheiten der Religion gezweifelt, aber sein äußerer Unglaube berührte sie dennoch nicht im geringsten. Sie kannte durch ihre Liebe seine ganze Seele, und in seiner Seele sah sie, was sie sehen wollte; daß aber sein seelischer Zustand noch ungläubig sein heißen könnte, war ihr gleichgültig. Das zweite Geständnis hingegen ließ sie in bittere Thränen ausbrechen.
Nicht ohne inneren Kampf hatte ihr Lewin sein Tagebuch übergeben. Er wußte, daß zwischen ihm und ihr kein Geheimnis bestehen könne und dürfe, und deshalb hatte er beschlossen, daß es auch so sein müsse. Doch gab er dabei sich selbst nicht Rechenschaft darüber, wie seine Handlungsweise auf sie wirken könne; er versetzte sich nicht in sie selbst. Als er indessen an diesem Abend vor dem Theater zu der Familie kam, in ihr Zimmer trat und das verweinte, durch das von ihm verursachte und nicht mehr gut zu machende Leid verzweifelnde, klägliche, liebe Gesicht erblickte, da erkannte er den Abgrund, der seine befleckte Vergangenheit von ihrer Taubenunschuld trennte, und er erschrak über das, was er gethan hatte.
„Nehmt sie, nehmt diese furchtbaren Bücher weg!“ sagte sie, die vor ihr auf dem Tische liegenden Hefte wegstoßend. „Weshalb habt Ihr sie mir gegeben? Aber nein; es ist besser so,“ fügte sie hinzu, Mitleid mit seiner verzweiflungsvollen Miene empfindend; „und doch ist es furchtbar, furchtbar!“ —
Er ließ den Kopf hängen und blieb stumm; er vermochte nichts zu sagen.
„Ihr verzeiht mir nicht,“ flüsterte er.
„Doch, ich habe vergeben – aber es ist furchtbar.“
Sein Glück war so groß, daß dieses Geständnis es nicht zerstörte, sondern ihm vielmehr nur eine neue Färbung verlieh. Sie hatte ihm vergeben, aber seitdem erachtete er sich ihrer noch viel weniger würdig, neigte er sich moralisch noch viel tiefer vor ihr, schätzte er sein unverdientes Glück noch viel höher.