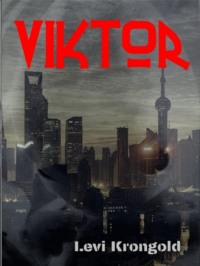Kitabı oku: «Viktor», sayfa 6
Das dumpfe Brummen von Kampfdrohnen war mir aus den Videosimulationen zwar bekannt, doch das durchdringende Dröhnen ihrer Sonotronenwerfer war derartig schmerzhaft, dass ich mir nach kurzer Zeit die Hände an den Kopf presste, weil ich befürchtete, er könne platzen. Die Infraschallwellen, die die zwei Kampfdrohnen aussendeten, die plötzlich über der Baustelle erschienen waren, können sogar Gewebe zerreißen und es sind nicht wenige Todesfälle bekannt, die von platzenden Hirngefäßen herrührten oder der Zerreißung von Lungengewebe. Ich sah noch, wie einige der Gestalten, die nicht schnell genug zurückgewichen waren, um sich hinter Mauern abzuschirmen, sich auf der Straße vor Schmerz zusammenkrümmten. Dann erfolgte eine heftige Explosion, die das AuTaX ein Stück zur Seite riss. Eine der Kampfdrohnen stürzte unweit von mir mit einem Krachen und zerbrochenen Rotoren auf die Straße. Steine spritzten umher, die Frontscheibe des AuTaX ging zu Bruch. Ich wurde hinausgeschleudert und landete unsanft auf dem Schotter. Eine weitere etwas fernere Explosion war zu hören, dann sank ein Teil des halb abgerissenen Hauses gegenüber in sich zusammen. Eine riesige Staubwolke wälzte sich heran und nahm mir den Atem. Das Dröhnen des Sonotrons der übriggebliebenen Drohne, die über mir schwebte, raubte mir nahezu den Verstand vor Schmerz. Ich stöhnte laut auf und versuchte irgendwie den Druck von meinem Kopf fernzuhalten, indem in mich wie ein Embryo zusammen krümmte.
»Komm, komm schnell!« Eine Hand hatte mich an der Schulter gepackt und zog mir den Arm vom Ohr weg.. »Komm, weg hier!« Irgendwer hatte mich gepackt und schleifte mich über das Straßenpflaster. Ich bemühte mich, auf die Beine zu kommen, um nicht zu Tode geschleift zu werden. Kurz vor einem Hauseingang schaffte ich es, mich halbwegs aufzurichten. Eine weitere Explosion ganz in unserer Nähe schleuderte uns die letzten Meter an die Hauswand. Steine prasselten auf uns herab. Ich hörte ferne Schreie, dann das pfeifende Warnsignal mehrerer Securityfahrzeuge, die sich näherten. »Komm, weiter!«, rief die Gestalt, die mich noch immer am Arm gepackt hatte, obwohl wir beide am Boden lagen. Sie trug eine Art Helm, wie sie für Motorräder oder schnelle Elektroscooter vorgeschrieben sind. Der massige Körper war mit einem roten Schutzanzug bekleidet. Wir rappelten uns wieder auf und er zog mich weiter in die Dunkelheit. Aber anstatt in den nächsten Hauseingang zu fliehen, zog er mich fort und wandte sich einer kleinen Metalltür zu, die in das Souterrain eines Wohnhauses in der Nähe führte. Als die Tür hinter uns zufiel, nahm das Dröhnen schnell ab, doch er ging weiter. In einem weiteren Raum brannte eine altertümliche Deckenlampe. Es schien ein Kellerraum zu sein, dem Gerümpel nach zu urteilen, welches sich in baufälligen Regalen türmte. Die Gestalt wandte sich mir zu. »Warte hier, bis es vorbei ist!« Es war eindeutig eine männliche Stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam.
»Wer sind Sie?«
»Tut nichts zur Sache!«, entgegnete er. »Warte einfach, bis es vorbei ist und jemand vorbeikommt, der dir hilft.«
»Jemand vorbeikommt?«, fragte ich entgeistert.
Er nickte in seinem Helm, so dass sich dieser ein wenig bewegte. Da er jedoch nicht das Visier öffnete, klang seine Stimme hohl und sein Gesicht war nicht zu sehen.
»Du wirst erwartet von... jemandem«, brummte er im Gehen. Er war gerade im Begriff, die Kellertür zuzuziehen, als ich ihm zurief. »Warten Sie! Was soll das heißen, ich werde erwartet? Wer sind Sie?«
Er zögerte, doch statt meine Frage zu beantworten, fügte er nur hinzu. »Da draußen ist gleich die Hölle los.« Dann verschwand er durch die Tür, die mit einem Krachen zufiel. Ich sprang auf und versuchte, ihm hinterher zu laufen, doch die Tür erwies sich als verschlossen. Ratlos schaute ich mich um. Aus der Ferne hörte ich das Donnern von Explosionen, die teilweise so heftig waren, dass selbst hier der Boden vibrierte. Ich ließ mich auf einer Tonne nieder, die umgedreht in einer Ecke stand. Meine rechte Schulter und meine Knie, auf die ich gestürzt war, schmerzten, in meinen Ohren dröhnte und pfiff es, als sei darin eine Bohrmaschine angeschaltet worden. Ich kam auf die Idee zu überprüfen, ob mein Arm-Pad hier drin Empfang hätte, musste jedoch mit Schrecken feststellen, dass es nicht mehr da war. Ich musste es draußen verloren haben! Entmutigt ließ ich mich zurücksinken. »Warte bis jemand vorbei kommt...« Wieso kam mir die Stimme trotz des Helms so vertraut vor? Ich starrte in die Deckenlampe, bis vor meinen Augen bunte Flecken tanzten. Derartige Lampen waren eigentlich seit Langem verboten!
»Warte, bis jemand vorbeikommt...« Ich fuhr plötzlich auf. Nein, das konnte nicht sein! Es musste eine Täuschung sein! Doch, ich war mir plötzlich sicher. Die Stimme des Mannes, ja die gesamte Statur waren mir bekannt. Wenn es nicht völlig abwegig wäre, hätte ich sicher sein können, dass es... Raskovnik war! Ach, unmöglich. Wieso hätte er gerade zur Stelle sein sollen, als ich in das Gefecht geriet? Woher hätte er wissen sollen, wo ich mich befand?
Unruhig lief ich im Raum auf und ab, rüttelte wieder und wieder an der Tür, die zwar in den Fugen knarzte, sich aber nicht öffnete. Wer sollte mich hier erwarten? Ich horchte mit dem Ohr an der Tür. Es war ruhig geworden. Die Explosionen hatten offenbar aufgehört. Sonst war jedoch nichts zu hören. »Sie werden von jemandem erwartet.« So ein Quatsch! Oder doch? Ich hielt einen Moment mit dem Auf- und Abgehen inne. Wenn mich tatsächlich jemand hier erwartete, dann konnte das nur heißen, dass das AuTaX nicht zufällig hierher gefahren, sondern absichtlich hierher gelenkt worden war. Das würde dann aber auch bedeuten, dass jemand mit meiner Ankunft gerechnet haben musste. Was wiederum hätte bedeuten können, dass Raskovnik sehr wohl hätte hier sein können. Doch wozu? Wieso hatte er sich dann nicht zu erkennen gegeben? Ich seufzte unzufrieden. Die ganze Grübelei brachte mich nicht weiter. Ich musste hier raus. »Hallo, hört mich jemand?«, schrie ich.
Es kam jedoch keine Antwort. Ich klopfte gegen die Tür, wieder und wieder, rief lauter, nahm mir den erstbesten Gegenstand aus dem Regal und klopfte damit lauter und ausdauernder. Wenn ich erschöpft war, horchte ich an der Tür. Ein Rumpeln hatte begonnen, ein fernes Geräusch. Ich lauschte konzentriert. Es schien, als wenn in rhythmischen Abständen ein dumpfer Knall ertönte. Für eine Detonation war er zu regelmäßig. Nach jedem Knall zitterten die Wände ein wenig. Dann wieder das dumpfe Rumpeln.
Pause.
Ein Knall.
Vibrieren der Wände. Das Licht flackerte.
Oh, mein Gott! Das konnte nur heißen, dass der Abrissbagger wieder seine Tätigkeit aufgenommen haben musste! Ich hämmerte verzweifelt gegen die Tür. Sie werden doch nicht auch das Haus abreißen, in dem ich nun sitze? Der nächste Knall ließ die Tür und die Wände heftig erzittern, das Licht flackerte noch einmal und verlosch dann. Absolute Schwärze umgab mich. Das Geräusch herabfallender Steine drang zu mir durch. Ich tastete mich zu der Türklinke und rüttelte heftig daran. »Hilfe!«, schrie ich in panischer Angst, lebendig verschüttet zu werden. Plötzlich ein knirschendes Geräusch, die Tür bewegte sich. Der Schein einer Lampe flackerte in den Raum. Der Lichtkegel erfasste mein Gesicht und blendete mich.
»Ah, gut, kommen Sie. Schnell!«, rief eine Frauenstimme.. »Schnell, das Gebäude stürzt gleich ein!« Sie griff mein Handgelenk und zog mich mit einem entschiedenen Ruck aus dem Raum. Ich stolperte hinter ihr her durch das Dunkel eines baufälligen Ganges, der teilweise nicht einmal einen aufrechten Stand erlaubte. Das Krachen und Ächzen des Bodens nahmen zu. »Bücken Sie sich!«, schrie sie durch den Lärm. »hier ist die Decke sehr niedrig!« Sie warf sich auf Hände und Knie und schob die Lampe vor sich her, die einen schmalen Lichtkegel in den engen, gewölbeartigen Gang warf. Leider bemerkte ich das Hindernis zu spät und schlug heftig mit der Stirn gegen die Steinmauer, die den Gang begrenzte. Hinter mir hörte ich das Brechen von Wänden, eine Staubwolke, die von hinten heran gefegt kam, machte mir klar, dass der Weg, den wir eben noch genommen hatten, eingestürzt sein mochte. Ich zitterte so stark, dass ich mich kaum weiterbewegen konnte. »Kommen Sie, kommen Sie! Gleich ist es geschafft!«, rief sie, bereits einige Meter entfernt von mir. Sie leuchtete hinter einer Ecke, die sie gerade genommen hatte, zurück zu mir. Als ich ihr folgte, beleuchtete der Lichtkegel kurz ihr Gesicht, das bisher durch die Dunkelheit vor mir verborgen geblieben war. Ein dreckverschmiertes Gesicht einer jungen Frau.
Ich erkannte sie gleich. Es war Suzanne Montenièr!
Mir stockte einen Moment ungläubig der Atem.
»Weiter, weiter!«, befahl sie. Vor uns drang Licht in den Schacht. Ein unregelmäßiges Loch in der Wand tat sich auf. Sie schlüpfte hinaus und reichte mir von außen die Hand. Geblendet trat ich ins Freie. Die trostlosen Ziegelmauern eines alten Hinterhofes ragten um mich herum auf. Nur oben ließen sie ein bisschen Platz für das Tageslicht. Es war hell? War ich so lange in dem Keller gewesen? Ich erinnerte mich noch genau, dass es bereits dämmerte, als ich aus dem AuTaX gestiegen war. Unschlüssig blieb ich stehen und schaute abwechselnd in den Himmel und auf die Montenièr, die in einer schäbigen Armeejacke vor mir stand.
»Was ist?«, fragte sie mich ungeduldig. »Wollen Sie hier anwachsen?«
»Wo kommen Sie her so plötzlich?«
»Oh, Sie bluten ja an der Stirn!«, rief sie statt einer Antwort. »Kommen Sie weiter, wir dürfen nicht lange ungeschützt hier bleiben, sonst werden sie uns finden!«
»Sie?«
»Kommen Sie weiter, ich erkläre Ihnen alles später! Kommen Sie!«
Sie drängte mich zu einer weiteren Tür am Ende des Hofes, direkt neben einer Reihe von alten abgelegten Monitoren und anderem Elektronikschrott, der offenbar auf die Abholung wartete. »Hier durch!« Unsicher folgte ich ihr. Es ging eine ganze Weile treppauf und treppab. Wir durchquerten mehrere Hausflure und Treppenhäuser, kamen durch Keller, verließen sie wieder. Einmal mussten wir uns sogar vorsichtig und schnell über eine kleine, wenig belebte Straße wagen, um uns gleich darauf erneut in ein Labyrinth von Gängen, Treppen und Fluren zu begeben. Endlich schien in einer verlassenen Einraumwohnung die Flucht vorläufig zu enden.
»Kommen Sie«, winkte sie mir zu, nachdem sie die Tür mittels eines altertümlichen Schlüssels geöffnet hatte.
»Sie sind Suzanne Montenièr, nicht wahr?«, fragte ich. Erschrocken fuhr sie herum. »Woher wissen Sie das?«
»Ich habe Sie erkannt, auf dem Foto. Raskovnik hat es mir geschickt.«
Sie zögerte einen Moment, dann atmete sie offenbar erleichtert aus. »Ja, dann!«
»Kennen Sie Raskovnik?«
Sie fuhr erstaunt herum. »Nein, nicht direkt, warum fragen Sie das?«
»Es schien mir so, dass Sie ihn kennen. Hat er Sie geschickt?«
»Viktor hat mich geschickt!«, antwortete sie vorsichtig.
»Viktor?«, fragte ich völlig verdattert.
»Wer sonst?«, antwortete sie irritiert.
»Entschuldigen Sie. Es ist alles so verwirrend«, stammelte ich.
»Lassen Sie mal sehen«, wechselte sie das Thema und betrachtete meine Stirn. Ich fasste an meine Schläfe und besah mir die Blutflecken, die dies an meinen Fingern hinterließ. Das Blut war jedoch schon fast wieder getrocknet.
Sie begutachtete die Schramme sorgfältig, was mir Gelegenheit gab, ihr Gesicht näher zu betrachten. Wenn man sich den Dreck wegdachte, ein sehr anmutiges Gesicht. Anders als auf dem Bild in der Akte, etwas älter, das Gesicht wies Zeichen vergangener Strapazen auf. Aber die ausdrucksvollen Augen strahlten eine warme Offenheit aus, die mir gut tat. »Sie sollten es besser auswaschen, damit es sich nicht entzündet.«
Auf meinen fragenden Blick hin wies sie mit dem Daumen hinter sich wortlos auf eine Tür, hinter der ich das Bad vermutete. »Ich kümmere mich erst einmal um Ihre Sicherheit. Haben Sie den Chip noch?«
»Den Chip, ja, das Arm-Pad ist mir aber verloren gegangen.«
»Besser so. Geben sie den Chip her, schnell!«
Ich nahm den Ring mit dem Chip vom Finger und reichte ihn ihr. »Was wollen Sie damit machen?«, wollte ich eigentlich fragen, kam jedoch nicht mehr dazu. Sie ergriff eine Zange, die auf einer klapprigen Kommode lag, legte den Chip zwischen deren Backen und drückte zu. Mit einem hässlichen Geräusch zerbarst das Gerät.
»Was tun Sie da?«, fragte ich fassungslos.
»Ihr Leben retten!«, grinste sie. »Nun machen Sie schon, waschen Sie ihre Wunde. Ich kümmere mich um den Rest. Beeilen Sie sich!« Wie in Trance drehte ich mich um und ging durch die angegebene Tür. Ein altes Waschbecken ohne jeglichen Netzanschluss und Komfort ragte halb schräg aus der Wand. Aus einem rostigen Wasserhahn tropfte platschend etwas Wasser in das Becken. In einer Ecke befanden sich die Reste einer alten Duscheinrichtung und einer altmodischen Spültoilette, wie man sie nur noch im Museum findet. Ich schüttelte den Kopf. Dass es so etwas noch real gab, hätte ich nicht gedacht. Vorsichtig fingerte ich an dem Wasserhahn herum, bis ich herausgefunden hatte, dass sich ein Knopf drehen ließ, um gleich darauf einen heftigen Wasserstrahl freizusetzen, dessen Spritzer mich über und über nass machten. Ich sprang fluchend zurück. Sie kam in den Waschraum, sah mich an und lachte lauthals los. »Ungewohnte Technik, was?«
Schnell drehte sie den Knopf bis das Wasser in einem einigermaßen gemächlichen Strahl in das Becken floss.
»Ist hier alles so.... wie früher?«, fragte ich verärgert.
»Ja, fast alles«, antwortete sie lachend. »Wenn Sie sich sehen könnten!«
Ich fand wenig Gefallen an meiner Situation, aber ich wunderte mich, wann ich zuletzt einen Menschen so herzhaft lachen gehört hatte.
Eines der auffälligsten Merkmale der heutigen Zeit ist die relative Gleichgültigkeit der Menschen. In unseren psychiatrischen Kreisen nannte man das früher Affektarmut, die Unfähigkeit Gefühle zu erleben. Nicht dass Gefühle wie Freude, Zorn, Begierde nicht vorhanden wären, aber die Intensität der Gefühle hatte mit der Zeit deutlich nachgelassen, oder der Stimulus musste wesentlich stärker sein, um diese Gefühle auszulösen. Eine Erscheinung, die in der Fachliteratur immer wieder beschrieben wurde. Allerdings war dies offenbar auch zu einem Massenphänomen geworden, was eine zeitlang Gegenstand von verschiedenen Forschungsarbeiten gewesen war, bis eines Tages alle Forschungsgelder für diesen Bereich gestrichen wurden. Am auffälligsten war der Mangel an Gefühlen bei der Ausprägung des Sexuallebens. Die Folge war eine rapide Abnahme der Geburtenrate, ein Effekt der durchaus nicht unerwünscht war, angesichts der explodierenden Weltbevölkerung und der Versorgungsengpässe mit Nahrungsmitteln. Andererseits führte dieser Zustand auch zu einer Abnahme an Konflikten im sozialen Bereich, wenngleich noch immer genügend Zwistigkeiten übrig blieben, ohne die die menschliche Natur offenbar nicht auskommen kann. Ein so herzliches offenes Lachen allerdings hatte ich lange nicht mehr vernommen und ich sah sie interessiert an. Es tat gut, einen Menschen so lachen zu hören.
»Oh, tut mir leid«, kicherte sie. »Jetzt sollten wir uns aber beeilen!«
Vorsichtig benetzte ich meine Hand mit kaltem Wasser. Auch das war eine neue Erfahrung für mich. Üblicherweise sendet die Firma, die das Wasser in den Sanitärbereich schickt, angenehm temperiertes Wasser durch die Leitung. Trotz des Schmerzes, der mich durchzuckte, als ich die Blutreste von der Stirn wusch, benetzte ich mehrfach die Stirn mit kaltem Wasser. Glücklicherweise stellte ich fest, dass es sich offenbar nur um eine unbedeutende Schramme handelte. Sie beobachtete mich halb belustigt, halb besorgt, auf jeden Fall jedoch ungeduldig.
»Kommen Sie, wir müssen jetzt den Applikator benutzen, sonst sind wir hier nicht sicher.«
Ich folgte ihr in den angrenzenden Raum zurück. Er enthielt eine abgenutzte Sitzgarnitur mit einem fadenscheinigen olivgrünen Bezug, einem wackeligen Tisch, der wohl noch aus echtem Holz hergestellt zu sein schien, einen monströsen, aber ebenso baufälligen Schrank an der gegenüber liegenden Wand. Von allen Wänden löste sich der Verputz ab und hinterließ unschöne Löcher, in denen Ziegelmauerwerk zu erkennen war. Das Haus musste über 200 Jahre alt sein, denn heute baut man nur noch aus Carbonfasergeflecht, was wesentlich stabiler ist und eine bessere Energiebilanz erzielt. Eine Beleuchtung fehlte, statt dessen drang Sonnenlicht durch milchglasfarbene zersprungene Scheiben. Sie machte sich an dem Schrank zu schaffen, was mir Zeit ließ, sie zu beobachten.
Wenn die Montenièr eine Schizophrene war, dann eine recht hübsche. Natürlich muss man bei psychotischen Menschen aufpassen, dass man sie nicht falsch einschätzt. Wie ich aus jahrelanger beruflicher Erfahrung weiß, wirken viele sehr offen im Gespräch, ja geradezu vertraulich. Man durfte nur nicht in den Fehler verfallen, ihre mit viel Enthusiasmus erzählten Geschichten für bare Münze zu nehmen. Meist ist es ein abstruses Sammelsurium aus Wahn, Phantasie und wirklichem Erleben. Andererseits neigen Psychotiker nicht dazu, andere Menschen zu retten oder soziale Verantwortung zu zeigen. Ich wartete also gespannt darauf, welche Regung und welche Geste mir bei der Montenièr Gewissheit in die eine oder andere Richtung geben würde. Immerhin mochte ich sie vom ersten Augenblick an und das wiederum ist eine Seltenheit bei meiner Klientel. Da zeigt mir üblicherweise ein gewisses Unbehagen, welches ich in der hinteren Nackenregion spüre, dass ich es mit einem psychisch kranken Menschen zu tun habe. Allerdings sind die meisten auch durch Medikamente beeinträchtigt, die sie zu. »Therapie« erhalten oder besser gesagt zur Ruhigstellung. Die Montenièr stand mit Sicherheit nicht unter Medikamenteneinfluss. Ihre Mimik war zu lebhaft, die Bewegungen ihrer schlanken Gestalt zu fließend. Allerdings brauchte ich nicht lange zu warten, bis etwas so Ungewöhnliches geschah, dass sich mein berufsbedingtes Misstrauen wieder meldete. Sie entnahm nämlich dem Schrank einen kleinen kopfhörerartigen Gegenstand, auf dem eine Art Metallspirale montiert war.
»Sind Sie geimpft?«, fragte sie.
»Natürlich!«, antworte ich entrüstet.
Sie rümpfte verstimmt die Nase. Dann drehte sie an irgend einem Knopf an der Seite der Vorrichtung, wartete offenbar auf das Signal einer Kontrollleuchte, nickte zufrieden und reichte mir den Gegenstand. Ich schaute sie verständnislos an.
»Was soll ich damit machen?«, fragte ich sie unsicher.
»Das sollen Sie sich auf den Kopf setzen, sehen Sie, so!«
Sie nahm einen zweiten gleichartigen Gegenstand aus dem Schrank und setzte ihn sich selbst auf. Ich musste unwillkürlich lächeln. Derartig. »Geräte« waren mir bei meinen Patienten wohl vertraut. Manche versuchten sich sogar mittels umgedrehter Stühle vor fremdstrahliger Beeinflussung zu schützen. Und richtig, der nächste Satz zeigte mir, dass es auch hier nicht anders zu sein schien. »Das schützt Sie vor der Erkennung durch die Detektoren«, sagte sie im Brustton der Überzeugung.
»Mhmm«, brummte ich und zog mir das Gerät über den Kopf. Sie zögerte und in ihren Augen begann es böse zu funkeln.
»Sie sind sicher, dass dieser Raskovnik Sie geschickt hat?«
»Ja natürlich, ich sollte Sie in der Nähe vom ‚Fleur' treffen. Leider kam mir dort ein recht bösartiger Koch in den Weg, der dies wohl zu verhindern trachtete.«
Sie zuckte zusammen. »Dann waren Sie..?« Sie betrachtete mich nochmals, so als habe sie mich vorher gar nicht richtig gesehen. Dann begann sie zu kichern. »Oh, mein Gott. Dann waren sie der Arme, den Claude so vermöbelt hat?«
»Claude?«
Sie hielt sich die Hand vor den Mund wie ein kleines Mädchen, das einen kleinen bösen Streich ausgeheckt hat. »Mir scheint, sie sind ein wahrer Pechvogel!«
Ich war verstimmt, denn genau das fühlte ich auch so.
»Es tut mir so leid!«, sagte sie plötzlich sehr mitfühlend.
»Viktor war stinkesauer, als er das erfuhr.«
Ich checkte gar nichts mehr. Wer war dieser Viktor? Wahrscheinlich sah ich sie so zornig an, dass sie plötzlich voller Mitgefühl fortfuhr. »Sie glauben mir nicht, nicht wahr?«
»Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich noch glauben soll, außer dass ich mich in einer völlig beschissenen Situation befinde.«
»Fürwahr, da haben Sie recht!«, antwortete sie ernst. »Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie recht haben!«
»Erklären Sie es mir?«
»Später, wir müssen jetzt hier weg. Die Wohnung ist nicht völlig sicher, wissen Sie?«
Ich nickte, obwohl ich ehrlich gesagt gar nichts verstand und sich in meinem Gehirn eine Unsumme von unbearbeitetem Stoffwechselmüll zur Klärung des Informationsüberschusses angehäuft hatte, so dass dort jeden Moment der Zusammenbruch drohte.
»Ich will Ihnen erst einmal zeigen, wozu der Applikator gut ist.«
Damit begaben wir uns aus dem Haus und ohne jede Deckung auf eine mittelmäßig belebte Straße und endeten vor der besagten Tankstelle, an der einige altertümliche Pkws, die immer noch mit Gas fuhren, betankt werden. Wir setzten uns auf eine kleine niedrige Betonmauer gut sichtbar für Überwachungskameras und vorbeifahrende Passanten, so dass ich jeden Moment erwartete, durch eine Ordnungskraft abgeholt zu werden. Doch nichts dergleichen geschah.
Es geschah jedoch etwas anderes, was mich auch gegenwärtig noch bewegt. Ich spürte mich, kurz nachdem ich den ‚Applikator‘ aufgesetzt hatte, seltsam euphorisch. Ein Gefühl, welches mich an meine Kindheit erinnerte und wenn ich die Montenièr ansah, spürte ich das Verlangen, sie zu beeindrucken, sie näher kennen zu lernen, sie für mich zu gewinnen, als Mensch und als ...Frau!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.