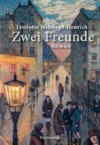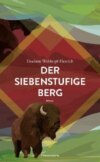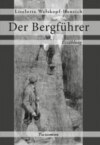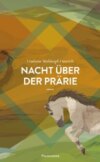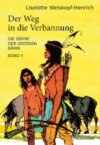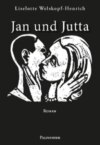Kitabı oku: «Zwei Freunde», sayfa 12
»Die Rosen sind eine große Aufmerksamkeit gewesen, Herr Dr. Wichmann. Ich habe mich darüber gefreut und danke Ihnen dafür.«
Wichmann begriff nach diesen Worten, daß der Logenschließer geplaudert hatte. Der Regierungsassessor wurde rot wie ein ertappter Primaner, und da er diese Art und Weise seines Körpers, eine wortlose Beschämung zu gestehen, albern fand, errötete er nur noch mehr. Marions Gatte verzog leicht die Mundwinkel mit ein wenig Verstehen und ein wenig Spott. Wichmann fühlte sich ihm einen Augenblick unterlegen, zugleich besiegt und lächerlich. Er wand sich innerlich in diesem unerträglichsten aller Gefühle vor der bewunderten Frau.
Marion aber war bei ihrem Dank ernst geblieben. In ihren Augen lag wieder das Schimmern brauner Moorseen, die in einsamer Stille brüten. Mochte der Gatte lächeln, Marion schämte sich der Rosen nicht. Wichmann sah das Diadem in ihrem Haar, den einfachen Platinreif mit dem Diamanten, aus dem tausend Feuer spielten. Es war das kostbarste aller Geschenke, das sie hatte erhalten können, aber wenn sie es mit unvergleichlicher und scheinbar unnahbarer Grazie trug, so schlossen sich ihre Hände doch weich und zart um die lebenden Rosen.
»Gnädige Frau, ich bin sehr glücklich über Ihren Dank.«
Wichmann fühlte die Blicke der Herren und Damen auf sich gerichtet. Sein Nacken hob sich, und seine Lippen schlossen sich fester in Abwehr gegen die Neugier.
»Wir haben eben über die Oper als Kunstform gesprochen, Herr Wichmann« – Grevenhagens Stimme ging so leicht und schmiegsam wie ein feingeschliffener Stahl. »Wie denken Sie darüber?«
»Schon, daß die Frage aufgeworfen wird, zeigt, daß die Oper eine Krise durchmacht …›durchmacht‹ ist schließlich ein Wort, das schon zuviel für den Ausgang Partei nimmt – es kann sein, daß die Oper als Kunstform in dieser Krise unter geht – oder daß sie sich entwickelt.« Auch Wichmann bemühte sich, in einem beherrschten und zugleich unbeschwerten Ton zu sprechen.
»Es ist ja hübsch … aber eigentlich ist es doch komisch, daß Menschen einander ansingen«, sagte die junge Dame mit dem Pagenkopf. »Herr Musa nannte kürzlich die Oper einen elenden Ausdruck bourgeoiser Prunksucht und hysterischer Übertreibung. Wie denken Sie darüber, Herr Dr. Wichmann?«
»Meine minder kämpferischen und genußfreudigeren Ansichten, gnädige Frau, gestehen immerhin zu, daß unsere Oper nur die Kunst einer bestimmten Gesellschaftsschicht und einer bestimmten Zeit ist – welche Kunst wäre das nicht mehr oder minder? Aber vielleicht macht sie durch die Zusammenfassung so vieler Ausdrucksformen, des Wortes, des Klanges, der Farben, nach unserem Empfinden besondere Ansprüche und stößt doch weniger tief durch zu den Wahrheiten der Seele und des Alls, als es der grandiosen Fülle und Technik ihrer Ausdrucksmittel entsprechen müßte. Dadurch wird das Aufgebot ihres Sinnenreizes für uns fraglich in seiner Berechtigung. Wir empfinden auch das Mißverhältnis in der scheinbaren Einheit, die Vergewaltigung des Wortes zugunsten der Musik, die Ablenkung vom reinen Ton durch die Schau der Farben und Körper. Was das Vollkommenste sein sollte durch die Vereinigung der Künste, wird auf einmal ein hinkendes Monstrum, das zu verspotten billig ist. Die Wurzel des Versagens ist vielleicht wirklich in der geistig-seelischen Lage der Gesellschaft zu suchen, die die Oper hervorbringt. Bei höchster Ausbildung des Technischen, bei der Herrschaft über alle Mittel fehlt uns doch der große Gegenstand, dem sie dienen könnte, und die Mittel verwirren sich dadurch in unseren Händen.«
»Sie sind also auch ein Gegner der Oper?« Die Dame mit dem Pagenkopf schien von den Ausführungen ihres Diskussionspartners befriedigt zu sein.
»Ich kann mich auch in einen Gegner meiner eigenen Beweisführung verwandeln. Wir Deutsche gehen mit zu viel Philosophie, zu viel schneidender Sachlichkeit an ein schönes Spiel heran. Die italienische Oper, auch einige unserer Mozartopern sind nun einmal dieses Spiel, das nicht mit Begriffen genossen werden kann, das Spiel einer heiteren Menschengesellschaft …«
»Wir wollen uns heute zwei Erstickende im Steingrab ansehen, Herr Doktor.«
»Das doch eigentlich nicht – wir wollen das Duett der Leidenschaft unter den Harfenklängen priesterlicher Strenge hören …«
»Nennen Sie das einen heiteren Gegenstand?«
»Sie haben mich auf einer Ungenauigkeit – einer Unvollständigkeit ertappt, gnädige Frau. Die Gesellschaft spielt nicht nur in Anmut, sie spielt auch mit der Leidenschaft, und das tut der südliche Mensch sicher unbeschwerter, unbefangener, als wir es vermögen. Darum ist die Oper in stärkerem Maße sein Element, der echte Ausdruck seiner Lebensfreude, einer Freude, zu deren Fülle auch die Anschauung vom Kampf und Tod gehört. Auch das noch in dem Spiel gelöst …«
»Also unwahr …«
»Sie werden wieder zu sachlich, gnädige Frau. Das Volk hat seinen Liebesschmerz noch immer auch im Lied hinausgesungen. Die Oper ist keine schlichte Melodie dafür, sie ist ein sehr raffiniertes und wahrscheinlich vergängliches Werk aber sie stammt doch aus demselben bleibenden Triebe.«
»Sie machen Kompromisse …«
Wichmann zuckte. »Es kann sein, daß das mein Fehler ist.«
Frau Anna Maria hatte die Diskussion mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
»Sie werden von allen diesen Bedenken nicht beschwert, gnädige Frau?« fragte Grevenhagen sie freundlich.
»Ha nei. Ich freu’ mich einfach, weil’s mir so gut g’fällt und weil alles so b’sonders und feschtlich ischt.«
Das frische Geständnis fand allseitiges Wohlwollen und schloß die Debatte.
Die Gruppe begann sich zu bewegen und wieder in den allgemeinen Strom einzuschalten. Wichmann war für eine sehr kleine Spanne Zeit an Marions Seite; er roch den herben Duft ihres Haares und den süßen der Rosen.
»Ich glaube, daß es gleichgültig ist, was man singt oder tut wenn es nur das Ungewöhnliche ist.« Ihre Stimme war leise, ihre Lippen waren voll und schön geschwungen.
»Sie selbst sind das Ungewöhnliche, gnädige Frau, das die Sehnsucht bis zur Verzweiflung an sich zieht …«
»Ja …?« Das war wieder dieses »Ja« mit dem ausschwingenden Klang, der die Notwendigkeit alles Sprechens in Zweifel zog.
Die Klingel schrillte.
Oskar Wichmann beugte sich zum Abschied über die Hand und küßte sie ohne Scheu.
Weiter wußte er von dem Weg bis zu seinem Platze nichts mehr.
Parkett und Ränge füllten sich wieder mit Gemurmel, mit den schön gekleideten Menschen. Köpfe beugten sich, um Nummern zu suchen, zahlreiche Operngläser suchten nach Bekannten und besonderen Toiletten. Das Orchester stimmte die Instrumente für den nächsten Akt. Die Lichter verloschen, grün schimmerte der Nil in der Nacht. Amonasro suchte seine Tochter. Die Luft wehte kühl von der geöffneten Bühne in den heißen Zuschauerraum.
Oskar Wichmann fühlte die Pracht um sich, die Wärme der Menschen, das Geheimnis des Dunkels, das Singen und Klingen, aufrauschende Hochzeit der Töne. Seine Hände lagen auf der sammetbezogenen Brüstung, seine Augen faßten den Zauber der nächtlichen fremden Landschaft, schillernde Wellen, den Ausdruck der Qualen der Liebenden und drüben, fern und doch erreichbar, den Schatten Marions.
Ihre Lippen hatten »ja« gesagt. Was mehr? Was war gewesen, was sollte sein? Nichts. Nichts war als sie und dieser Augenblick. Nie sollte es enden, der Dämmerschein sollte bleiben, die Stille der Menschen, das Fliegen und Schmelzen der Töne, der Traum ohne Zeit und ohne Wirklichkeit, »… in den Schluchten von Napata …«
Verräter geworden, todgeweiht, Radames …
Wichmann verließ in der zweiten Pause seinen Platz nicht mehr. Den Kopf in die Hand gestützt, alles Äußere von sich wegschließend, wartete er, bis die Klingeln die Zuschauer zurückriefen und das Dunkel sie wieder zu Schatten werden ließ. Auch Marion war in der Loge geblieben … Felonie … Felonie.
Die Priester hatten gesprochen. Unter gleichmütigen Säulen, heiß leuchtendem Himmel, unter den Klängen der Harfen lag das Grab dunkel, aber es erstickte nicht den Sieg der Leidenschaft.
Als ein nur schwer Erwachender nahm Wichmann das Ende seines Traumes wahr. Die Stürme des Beifalls brausten, fluteten, ebbten ab und schwollen wieder an. Der Tenor dankte, er rief seine Mitspieler, der Name des Dirigenten hallte durch den Raum, und der schwarz gekleidete Mann mit den zarten Händen erschien zwischen Radames und Aida auf der Bühne und dankte mit ihnen. Die Türen der Ränge und des Parketts waren schon geöffnet. Begeisterte kamen in Hut und Mantel zurück, um sich noch einmal in den Chor des Beifalls einzumischen.
Endlich sank der eiserne Vorhang.
Das Spiel war aus.
Benommen noch von dem Festrausch dieses Abends, schritten Wichmann und seine beiden Gäste die Treppe hinab. In den Vorraum strömten kalte Winde durch die Türen, die auf- und zugingen. Die Kasse hatte verdunkelt. Die Damen nahmen die Pelze fester um sich, die Herren hatten die Handschuhe angezogen. Draußen hupten die Autos und ließen ihre Lichter spielen. Märchenhaft teure und elegante Wagen nahmen ihre Besitzer in sich auf und rollten ab.
Das Mietauto brachte drei Menschen, die noch stumm waren unter ihren Eindrücken, vor das Restaurant Hattig. Wichmann zahlte dem Chauffeur Preis und Trinkgeld. Er geleitete Frau Anna Maria und seinen Freund Casparius durch die Doppeltür, an dem von Repräsentationsbewußtsein getränkten Pförtner vorbei und hinauf in den ersten Stock. Die Eintretenden empfing gedämpfte Musik einer nicht sichtbaren Kapelle. Wenige Tische mit damastglänzenden Decken standen zur Wahl; der Kellner hielt sich in der lässig-dienstbereiten Haltung eines verkleideten Prinzen zur Verfügung. Er erkannte sofort Wichmann als den Dirigierenden und reichte ihm die Speisen- und die Weinkarte. Der Assessor nannte die Gerichte und Marken und verschwieg die Preise. Es kam eine kleine ausgewählte Speisenfolge mit Hummer und Kaviar zustande. Teller, Gabeln, zu seltsamen Blüten geformte Servietten erschienen lautlos, wie unter einem Zauberstab.
»Eugen – da ischt es aber arg fürnehm. Da müssen wir hochdeutsch schwätzen«, flüsterte Frau Anna Maria, als der Ober mit der überlegenen Miene sich entfernt hatte.
»Bitte, gnädige Frau, bleiben Sie doch bei Ihrem schwäbischen Mutterlaut. Für mich ist das, als ob ich ein Vögelchen sein Lied singen höre, wie Gott es ihm gegeben hat.«
»Sie sind aber ein arger Schmeichler, Herr Wichmann. Wenn Sie immer so schmeicheln?! Es ist doch wüscht, wie ich schwätz’! Können Sie sich vorstelle, daß Frau Grevenhagen so schwätze würd’?«
Wichmann lachte. »Nein, aber sie ist auch eine ›Sumpfblüte‹, wie Ihr Gatte einmal festgestellt hat, und Sie sind ein Heckenröschen.«
»Sumpfblüte? Das hat er g’sagt? Ha gewiß, ein bißle unheimlich ischt sie scho, weil mer nicht schlau aus ihr wird. Aber apart, so apart und interessant! Ihr Mann gefällt mir auch sehr gut, weil er so was Stolzes an sich hat und dabei freundlich – ich beneid’ dich, Eugen, daß du alle Tage zu dem hingehen darfscht.«
»Gehe nie zu deinem Fürscht – wenn du nicht gerufen würscht. Ich dräng’ mich da gar net so arg vor, mein Herzlieb. Und so sind die Gaben und Möglichkeiten eben meischtens falsch verteilt.«
Frau Anna Maria aß den Hummer mit Geschick. Die drei Speisenden waren die einzigen im Raume, bis eine weitere Gesellschaft von Gästen eintrat. Die junge Dame war darunter zu erkennen, die mit Wichmann über die Oper diskutiert hatte, auch Herr von Linck war den Freunden bekannt. Man grüßte sich.
»Die mag ich net, die ischt so eingebildet mit Ansichten, die sie sich gar net selber ausgedacht hat. Aber wissen Sie, Herr Wichmann, was mir für ein Gedanke gekommen ischt, wie Sie da so hohe Sache erzählt habe, für die ich viel zu dumm bin?«
»Nein?«
»Wir lebe doch eigentlich ein sehr künschtliches Leben – mir esse den Hummer, den mir in der Nordsee g’fange habe, und trinken den Wein, der im schnöden Frankreich wächst, und dazu gibt’s ein bißle Kaviar von der fernen Wolga und einen Strauß von Rose für die Dame mitten im Winter. In der Oper singt ein italienischer Tenor, und ’s grüne Wasser fließt wirklich auf der Bühne – und wir wisse, wie’s im alten Ägypten vor fünf- oder vor zehntausend Jahr zugange ischt oder zugange sein soll. Es ischt doch alles arg kompliziert, und mir denke bloß, es wär’ so selbstverständlich.«
»Da haben Sie recht, Frau Anna Maria. Wenn ich Ihre Gedanken weiterspinnen darf, es gibt auch Menschen, die künstlich geworden sind und ohne das Komplizierte gar nicht mehr dasein können. Es gibt auch Bücher und gibt auch Opern, bei denen das der Fall ist – dann gibt es wieder andere Menschen und Werke, die sind so natürlich und kräftig geblieben oder so weit ins einfache Innere der Dinge vorgestoßen, daß sie immer und überall zu leben vermögen, auch wenn der französische Wein ausbleibt und die Rosen im Winter erfrieren. Unter den Menschen gibt es sogar nicht wenige, die das noch vermögen, wenn sie eben müssen. Das hat der Krieg gezeigt.«
»Ah … ja … wissen Sie, jetzt denk’ ich grad, ob die Dame da drüben, die die Opern abschaffen möcht’, eigentlich so was sein könnt’ im Ernscht – ich glaub’s beinahe net. Und dann – ja – das ischt eigentlich interessant, daß mer seine Mitmenschen auch einmal so einteilt – können Sie sich Frau Grevenhagen als Bäuerin vorstellen?«
Wichmann sah auf das weiße Tischtuch und die roten Hummerscheren und hörte die Klänge der verdeckten Kapelle, in denen das Erleben des Abends ausschwingen konnte. »Als Bäuerin – nein – aber …«
»Aber?« bohrte Casparius.
»Als Druidenpriesterin oder so etwas.«
»Mach dir keine Illusionen, Wichmann, sie kann net hexe. Aber das Weib eines Salonanarchischte sein … des ging’ vielleicht. Kann sein, daß ihr des ungewöhnlich genug wär’.«
Wichmann wurde feindselig. »Musa, meinst du?«
»Ha nei … bloß allgemeine Theorie.«
»Was hascht du denn bloß gegen die Frau, Eugen? Wenn eine Frau einen solchen Mann hat wie die, braucht sie keinen Anarchischten mehr. Er wirkt so kühn und ritterlich und trägt sie gewiß auf Händen …«
»… und kauft ihr ein Diadem für 28ooo Mark!«
»Ha, des war des? Das ischt auch wirklich wunderschön und paßt so ganz zu ihr.«
Wichmann vermochte seiner stillen Erregung nicht Herr zu werden. Was hatte Casparius von seinem Gespräch mit Marion gehört? War Kaspar der einzige Unberufene gewesen, der das kurze Verstehen zweier Menschen erlauschte? Und was wußte er von Musa?
Wichmann leerte sein eben eingeschenktes Glas Burgunder auf einen Zug.
»Kaspar … grad heraus … wie bist du auf diesen Anarchisten gekommen?«
»Jetzt laß mich bloß zufrieden. Ich werd’ doch nicht den Heiligenschein der Gemahlin unseres Chefs antasten. Ich mein’ bloß so im allgemeinen, ihr Typ, der will immer was Besonderes habe. Ob’s ein Großfürscht ischt oder sein Attentäter, das ischt dann wurscht, ’s tut’s auch einmal ein Ministerialrat und Herrenreiter …«
Wichmann sah unbefriedigt über den Freund weg. Er konnte Frau Anna Maria jetzt verstehen. Es war wirklich zum Wildwerden mit des Eugen Casparius unaufhörlichen philosophischen Witzen. Casparius mußte irgendeinen Verdacht haben. Es mußte irgendein Geschwätz umgehen. Hätte er damals nur diesen Brief aufgerissen und gelesen! Was hätte der Postbote schon anders machen wollen als schelten? Aber er, Wichmann, war ein ewig Zaudernder. Er wollte die Fäden endlich zerreißen, die ihn hinderten, und nach der Einzigen fassen.
Nach ihrem »Ja« mußte er wissen, ob sie ihn wirklich liebte, Gedanke des Himmels, oder ob sie nur mit ihm spielte. Er konnte nicht mehr sein ohne die Entscheidung.
Frau Anna Maria plauderte, und Wichmann lächelte, ohne sie recht zu hören. Casparius stand mit dem Hummer auf dem Kriegsfuß und hielt sich an den Wein.
Als es ein Uhr geworden war, brach man auf. Trotz der beißenden Kälte empfanden alle den Wunsch, ein Stück zu Fuß zu gehen. Frau Anna Maria hatte sich von dem eleganten Ober den Heckenrosenstrauß in Papier binden lassen, damit er nicht Schaden nahm. Sie lief jetzt vergnügt zwischen ihren beiden Kavalieren.
»Guck … Heckenrösle … nei, nix sage, Wichmann … da vorn im Schein der Bogenlampe, wie g’falle dir die zwei?«
»Net schlecht. Zwei so stattliche Menschen und gut angezoge. Viel mehr kann ich von der Rückansicht her net erraten.«
»Des ischt das vielbesungene Fräulein Hüsch.«
»Ach so? Des würd’ mich interessieren, die kennezulerne … Wer ischt denn der Herr? Ischt der auch aus eurem Minischterium?«
»Net aus unserem. Des ischt doch der Regierungsrat Schildhauf, wenn mich net alle Auge täusche? Jetzt nehme die zwei sich ein Taxi.«
»Das machen wir auch bald, Kasper, eh uns die Nasen erfrieren.«
Als man mit dem von Wichmann vorgeschlagenen Gefährt die Wohnung des Ehepaars Casparius erreichte, wurde Wichmann noch zu einem Mokka eingeladen.
»Es war ein wunderbar schöner Abend! Von dem Abend erzähle’ noch unsre drei Töchter, wenn sie groß sind. Das habe mir Ihne zu verdanke, lieber Herr Wichmann. Und eigentlich – ja eigentlich möcht’ ich jetzt wisse«, sagte Frau Anna Maria, während sie das duftende Gift einschenkte und ihr Gatte die Zigaretten anbot, »ob ein Mann oder eine Frau heutigentags noch so lieben könnt’ wie der Radames und die Aida … so ganz wahnsinnig. Wie ich in der Oper g’sesse bin, ischt es mir so vorkomme, und selbscht bei meinem guten Eugen spür’ ich noch so einen Schwung.« Sie lachte liebenswert, und Eugen schmunzelte.
Wichmann versuchte zu denken. Es war vergeblich. So ganz wahnsinnig? Wer wußte es denn? Er wußte nur, daß etwas geschehen mußte, wenn er nicht zugrunde gehen sollte in dem Strom seines Gefühls, dessen Ziel er selbst nicht kannte. Aber was? Was wollte er? Sie an sich reißen? Die Augen schließen, nichts mehr wissen, nichts mehr fühlen als sie, ihren Leib, das Klopfen ihres Blutes, und ihr Geheimnis in sich hineindrücken!
Als diese Nacht zu einem frostigen Morgen erwachte, hatte Oskar Wichmann die Augen noch immer offen. Aber der Gedanke, wie er Marion finden und wie er Marion prüfen könne, war zu keinem Ende gekommen. Er hatte nur ihre weißen Hände gesehen, die sich um Rosen legten, und die schwere Musik ihrer Stimme gehört, als sie ein »Ja« sprach.
6
Zwei Tage vergingen, an denen Oskar Wichmann nicht als er selbst gelebt zu haben glaubte. Das Dienstzimmer, die Akten, die geheimrätliche Wohnung sah er nur durch einen dichten Schleier. Melodien wehten um ihn her, unwirkliche Bilder hielten ihn gefangen. Aida hatte sich auch für ihn verwandelt. Sie ging in schwarzer Spitze, durch die ihre elfenbeinfarbene Haut schimmerte, biegsam war ihre Gestalt, ihre Augen waren Erinnerung und Sehnsucht nach einer fernen, unbekannten Heimat. Marion, Marion …
Wichmann erschrak, als er auf einsamen Parkwegen den Namen laut vor sich hin gesprochen hatte. Warum waren ihre Lippen müde gewesen, als sie durch den Morgen ritt? Drüben wohnte sie in dem Hause hinter dem Ahornbaum. Der Verzauberte schaute hinüber und sah sie nicht. Wann ging sie ein? Wann aus? Er wußte es noch immer nicht.
Er hatte in der Nacht am Schreibtisch gesessen und hatte an sie geschrieben und hatte gewußt, daß er alle seine Briefe wieder zerreißen werde, ehe sie ein andres Auge sah. Torheit! Aber die Messer des Verstandes wurden schartig an der sturen Wiederholung, mit der das Gefühl seine Wünsche vorbrachte.
Dann war der Brief gekommen.
Martha hatte ihn gebracht. Pünktlich wie an jedem Tag, an dem der Regierungsassessor zum Dienst ging, stellte sie das Frühstück auf den Tisch am Fenster und legte die beiden Zeitungen und die eingegangene Post auf den Schreibtisch des verstorbenen Geheimrats. Flüchtig wie in all dieser Zeit nahm Wichmann die eingegangene Korrespondenz auf, um an der Schrift den Absender zu erkennen.
»Herrn Dr. Wichmann …«
Das hatte sie geschrieben.
Wichmann hielt den weißen Umschlag in der Hand, einen Umschlag, wie er ihn schon einmal zwischen den Fingerspitzen gefühlt hatte. Der Absender war nicht angegeben. Die Adresse war mit dünnen, weit gezogenen Buchstaben geschrieben.
»Herrn Dr. Wichmann …«
Der Federhalter, der dies schrieb, hatte in ihrer Hand gelegen. Wann? Warum? Was war das für eine Stunde gewesen, in der Marion, die Gattin des Justus Grevenhagen, den Namen Wichmann schrieb?
Der Empfänger nahm das Briefmesser und öffnete schnell, fast gewaltsam. Er las mit einem Schimmer vor den Augen, in dem die Buchstaben verschwammen. Dann stieß er einen lachenden, heiseren Ton aus.
»Sehr geehrter Herr Dr. Wichmann!
Für den Fonds, der zur Unterstützung bedürftiger Studenten der Rechtswissenschaft bestimmt ist und den ich im Auftrag der Stifter mit verwalte, erlaube ich mir, auch Sie um eine Spende zu bitten, deren Höhe Sie bitte selbst bemessen mögen. Ich danke Ihnen heute schon im Namen der Empfänger, deren Würdigkeit, wie ich Ihnen versichern kann, streng geprüft wird. Marion Grevenhagen«
Marion! Ja gewiß, Leute, die den ersten Rang in der Oper bei erhöhten Preisen bezahlen, die ein Dutzend Rosen schenken und bei Hattig essen, solche Leute gehören ja zu den Kreisen, in denen man Spendenlisten mit der Hoffnung auf erhebliche Beiträge versenden kann.
Ach, Marion, ist das der gleiche Brief, mit dem du Herrn Dr. Musa beglückt hast?
Die Liste der Spender und Spenden lag bei. Sie enthielt den Namen des Herrn von Linck … 300 RM, Regierungsrat Schildhauf … 50 RM, Fräulein Ramlo – das war ja wohl die Dame mit dem Pagenkopf – 100 RM. Dr. Musa – ah, Musa! – 20 RM. Es folgte ein unbekannter Name: 250 RM. Wichmann lachte hell hinaus. Die Befreiung von dem Alpdruck Musa gab ihm eine übermütige Stimmung. Er holte den Füllhalter aus der linken Brusttasche und schrieb: Dr. O. Wichmann: 300 RM.
Bist du jetzt zufrieden, Marion? Der Regierungsassessor hatte damit sein Konto angegriffen, dessen Zinsen sein Gehalt aufbesserten. Aber warum nicht? Er mußte ein andermal sparen. Ein andermal. Nicht an deinen Wünschen, Marion!
Wichmann las sechsmal die Liste durch.
Außer ihm und Musa war niemand von den Herren des Ministeriums darauf zu finden.
In der linken Schublade des Schreibtisches lag das beste Briefpapier.
Wichmann holte es hervor.
»Sehr verehrte gnädige Frau!
Es ist mir eine große Freude, für einen Zweck, den Sie fördern, einen Beitrag leisten zu können.
In Ergebenheit …
2 Anlagen«
Der Schreiber knickte den Bogen, legte den ausgeschriebenen Scheck und die Spendenliste, die er schon auswendig wußte, bei und schloß den Umschlag.
Es war zehn Minuten vor neun Uhr. Wichmann fuhr in den Mantel und verließ das Haus. Den Brief, den er frankiert hatte, warf er gegenüber in den Empfangskasten am Gartenzaun der Kreuderstraße 3.
Er wagte nicht zu hoffen, daß er mehr als einen vorgedruckten Dank erhalten werde.
Die Tage verstrichen wieder ohne Ereignis. Wichmann empfand, wie seine Vorstellung von der Geliebten blasser wurde und wie seine Sehnsucht nach ihr wuchs. Die unaufhörliche und fruchtlose Beschäftigung seiner Phantasie machte ihn gereizt und launisch. Mehr als einmal sah er Blicke der Kollegen und sonstigen Mitarbeiter auf sich gerichtet. Sein Verhältnis zu Grevenhagen wurde noch kühler. Er selbst fühlte sich nicht glücklich. Daß er sich nicht überwinden konnte, die Kreuderstraße zu verlassen, war ihm ein Stachel, der seine Selbstachtung verletzte. Die Untätigkeit, in der er verblieb, peinigte sein Herz und brachte ihn zu den wütendsten Ausfällen gegen die eigene Entschlußlosigkeit. Dennoch blieb er auch am folgenden Donnerstag dem Haus im Garten fern.
Der Winter begann um diese Zeit endlich seine Kraft zu verlieren. Der Frost brach sich, die Schneemassen schmolzen grau und schmutzig dahin. Im Park wurde die Schlittschuhbahn gesperrt, das Eisloch für die Enten vergrößerte sich auf natürliche Weise. Von den Bäumen tropfte es, die Parkwege weichten auf. Vögel begannen schon zu singen. Zum Reiten kam Wichmann nicht mehr so häufig wie im Winter. Herr von Schilling, der Besitzer des Fuchses, nahm sein Tier jetzt selbst in Anspruch, und Mietgäule durch den Park zu treiben, spürte Wichmann wenig Lust. Im Ministerium herrschte ein großer Arbeitseifer vor dem Abschluß des Rechnungsjahres am 31. März, und der Assessor fügte sich dem Zwang, Dienst zu tun. Das neue Bücherverzeichnis, zu Händen von Fräulein Hüsch, hatte er nebenbei fertiggestellt. Die Gerüchte der mittäglichen Tafelrunde überstürzten sich, ohne daß Wichmann recht auf sie hinhörte, er begriff nur, daß die Ernennungen in kurzem vollzogen werden sollten.
Einmal hatte er den Nachmittag des »jour fix« benutzt, um das Haus Grevenhagen wieder aufzusuchen. Er fand Marion verändert. Sie sprach mehr und bewegte sich schneller, als werde sie von einer Unruhe getrieben. Manchmal zuckten ihre Hände. Dr. Alfons Musa stand am Kamin neben dem Flackerfeuer; Marion sprach ihn nicht ein einziges Mal an, und er sah nicht nach ihr. Stets war sie in einem Kreise von Herren und Damen, der sich bald löste, bald neu füllte. Sie trug ein schwarzes Kleid wie immer. Neben der stolzen Mutter Grevenhagens schien sie wie ein verirrter Vogel, dessen buntes Gefieder in der Gefangenschaft verborgen wird. Als Wichmann sich verabschiedete, begegnete sie ihm mit einem so schmerzlichen Blick, daß er Qualen empfand, sie nicht in den Arm nehmen und in ihrer Trauer trösten zu dürfen. »Verfügen Sie über mich«, murmelte er. Ihre Augen verrieten ihm, daß sie verstanden hatte.
Der Wunsch, für Marion immer erreichbar zu sein, hielt Wichmann in den folgenden Tagen für jede freie Minute im Hause fest. Er verzichtete darauf, mit den sportlustigen seiner Kollegen am Sonnabend nachmittag zum Waldlauf zu gehen. Am Sonntag stand er früh auf und verließ um acht Uhr das Zimmer, damit es um neun gereinigt und geordnet sein konnte. Er setzte sich ans Fenster und versuchte zu lesen, aber nichts konnte seine Gedanken fesseln. Er beobachtete die Meisen, die durch die Zweige des Ahornbaumes huschten, er sah den taunassen Gartenweg, den braungrünen Rasen, der unter dem Schnee hervorgekommen war. Das eine Fenster der Gartenvilla, das ihm sichtbar war, blickte hellblau im Widerschein des Himmels. Ein Gären und Drängen lebte in der Luft, die sich mit Feuchtigkeit und erster Frühlingswärme gesättigt hatte.
Frau Geheimrat von Sydow verließ das Haus. Ihr Untermieter sah, wie sie mit wuselnden Schritten, im weiten Mantel, das Gesangbuch in der Hand, der Stadt zuging. Unter dem Hutrand lagen wohlgeordnet die grauen Löckchen.
Komm, Marion. Es ist Frühling.
Wie im Traum, in dem das geschieht, was heimlich sich öffnende Schichten des Herzens erwartet haben, oder auch wie ein Kind, das noch Wunder erlebt, nahm der Wartende eine Frauengestalt wahr. Sie kam mit ihren Schritten, die der Erde nicht weh taten, über den Gartenweg der Kreuderstraße 3. Die Vögel sangen über ihr in den Zweigen, und der Himmel war matt und hell, voll Abschied und Werden. Die Rosenknospe des Tores gab sich in Marions Hand, das Tor ging auf und zu, Wichmann hörte sein leises Klicken durch die Sonntagsstille. Frau Grevenhagen trug ein schwarzes Tuchkostüm, der Kragen der englischen Bluse schloß sich um ihren Hals. Die behandschuhte Rechte trug eine sehr kleine Tasche.
Wichmann hörte das Klopfen des eigenen Blutes, das ihm durch die Adern schlug. Als die Klingel der Wohnung schellte, war er aufgestanden. Er stand mitten im Zimmer, ohne mehr etwas zu sehen. Aber sein Gehör war scharf geworden, wie das des Tieres, dessen Leben vom Erlauschen des Geschehens abhängt.
Er vernahm Marthas flinkes Laufen, das Öffnen der Sicherheitsschlösser – ein Eintreten – den Klang einer Stimme – und Schritte – wieder eine Tür, nahe der seinen – auch diese öffnete und schloß sich.
Martha klopfte und kam in das Zimmer des Assessors herein, im Satinkleid, mit weißer steifer Zierschürze. Ihre Augen blickten erregt, sie überreichte die Karte.
»Frau Ministerialrat Grevenhagen – Frau Geheimrat ist leider ausgegangen – Frau Grevenhagen bittet in diesem Fall, Herrn Dr. Wichmann zu sprechen …«
Wichmanns Füße setzten sich mechanisch in Bewegung. Martha wich aus. »Im Salon der gnädigen Frau …«
Wichmann wußte es längst.
Er ging hinüber wie ein Junge in das Weihnachtszimmer. Mephisto ging neben ihm her … »Schafft mir die Dirne …«
Frau Marion Grevenhagen saß auf einem steifen, mit hellgelber Seide bezogenen Empiresesselchen. Auf ihrem Schoß lag die kleine eidechsenlederne Tasche. Sie hatte den rechten Handschuh ausgezogen und reichte ihre Hand.
»Gnädige Frau?«
»Darf ich Sie um einen kleinen Dienst bitten, Herr Dr. Wichmann? Ich habe Verwandten der Frau Geheimrat von Sydow versprochen, einen Gruß persönlich zu überbringen.« Die Tasche öffnete sich, Frau Grevenhagen überreichte ein Kuvert, das einen Briefbogen, vielleicht eine Photographie, zu enthalten schien. »Sie sind so freundlich, die Übermittlung zu übernehmen? Ich glaube, daß Frau von Sydow aus dem Begleitschreiben alles ersieht. Es handelt sich wohl um eine alte Photographie, ein Andenken. Mein Gatte und ich haben das Ehepaar, um das es sich handelt, bei einer unserer letzten Wochenendtouren zufällig getroffen, dabei kam die Rede auf Frau von Sydow.«
»Ich werde den Brief gern übermitteln, gnädige Frau.«
Wichmann zog die Brieftasche und legte den Umschlag hinein. Dort war der Brief neben einem kleinen Zettel verwahrt: »Boston nach der Pause. M. G.«
Oskar Wichmann stand vor der Geliebten und sah sie an.
Seine Augen konnten nicht mehr schweigen, und die Frau wich der Sprache seiner Blicke nicht mehr aus. In dem Alleinsein mit dem Weib schüttelte ihn die Leidenschaft. Die Zucht überkommener Vorstellungen spannte ihn auf die Folter.
»Sie waren lange nicht bei uns, Herr Doktor. Auf einmal sind Sie wiedergekommen. Warum?«
Die Frage, die den Konversationston zu durchbrechen schien, riß das Schloß auch von Wichmanns Zunge.