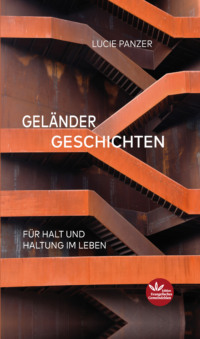Kitabı oku: «Geländer Geschichten», sayfa 2
Dein Wille geschehe
Die Welt ist nicht das Paradies – leider. Menschen behandeln einander wie Raubtiere, viele werden zu Opfern und erleben unglaubliches Leid. Und auch die Naturgewalten schaffen Opfer, wenn es Erdbeben gibt, Wirbelstürme, Tsunamis oder Dürreperioden.
Andererseits beten wir Christen seit Jahrhunderten: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“ Und ich frage mich manchmal: Kann das, was geschieht, der Wille Gottes sein – Leid, Unrecht, Gewalt? Manche meinen, gerade auch die schlimmen Erfahrungen seien von Gott geschickt, als Strafe für die Menschen, die Böses tun. Aber erleiden müssen es alle, auch „Unschuldige“. Kann das Gottes Wille sein, Leiden und Tod für Säuglinge und Kinder? Oder sind das die gewalttätigen Fantasien von Menschen, die so denken?
Ich bezweifle, dass die schlimmen Erfahrungen Gottes Wille sind. Wieso ich darauf komme? Weil Jesus gesagt und gezeigt hat, was Gott will. Dazu ist er in die Welt gekommen. Von ihm höre ich: „Seid barmherzig miteinander!“ – denkt also nicht immer gleich an Strafe, sondern überlegt, wie es besser gehen kann. Jesus hat auch gesagt: „Schafft Frieden“ – seid bereit, den ersten Schritt zu tun, auch wenn das für euch vielleicht erst einmal nach Schwäche aussieht. Ich glaube, so hat Jesus beschrieben, was Gottes Wille ist. Und wie die Welt erst noch werden muss.
Er hat aber auch Ja gesagt zu unserer Welt, die schon zu seiner Zeit nicht das Paradies war. Als die Mächtigen seiner Zeit ihn verfolgt haben, hat er gebetet, dass ihm das Schlimmste erspart bleiben möge. Und dann trotzdem Ja gesagt zu seinem Schicksal. „Dein Wille geschehe!“, hat Jesus gebetet. Er hat sich Gott anvertraut, auch im Leiden.
Ich finde das nicht leicht, sich mit dem Bösen abzufinden, das geschieht. Gottes Wille ist das bestimmt nicht. Aber die Menschen sind frei, zu tun, was sie wollen. Kann ich Gott deshalb Vorwürfe machen? Es sind doch die Menschen, die nicht tun, was gut wäre! Und die Naturkatastrophen? Auch der Natur lässt Gott ihren Lauf. Vieles ist unfassbar schön – und manchmal gibt es Schreckliches. Vielleicht sehe ich das Schöne nur, weil ich auch das Schreckliche kenne?
Ich wünsche mir, dass diese schöne Welt erhalten bleibt für meine Kinder und Enkel, bis die Welt Gottes da ist, in der es das Schreckliche nicht mehr geben wird. Deshalb bete ich auch weiter: „Dein Wille geschehe“. Und ich will dafür tun, was ich kann, damit Gottes Wille geschieht – auch auf Erden.
Das tägliche Brot
„Unser tägliches Brot gib uns heute“, beten wir Christen im Vaterunser. Nicht etwa, weil wir denken, wir könnten uns damit Arbeit und Mühe ersparen. Beten ist kein Zauberspruch. Warum beten wir dann überhaupt dafür? Martin Luther hat eine Anleitung für die Bildung der Christenmenschen geschrieben. In diesem kleinen Katechismus hat er erklärt, wie die Bitte um das tägliche Brot zu verstehen ist: „Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte …; aber wir bitten in diesem Gebet, dass er’s uns erkennen lasse und wir es mit Dank empfangen.“ Gott ist großzügig, steckt für mich darin. Er gibt Lebensunterhalt für alle, auch wenn man nicht betet. Wenn das, was er gibt, am Ende nicht für alle reicht – dann müssen wir Menschen nach den Ursachen bei uns selbst suchen. Reichen würde es für alle, wir müssten es nur besser verteilen.
Gott will, dass alle Menschen täglich ihr Brot haben – deshalb beten wir ja auch: „unser tägliches Brot“. Nicht nur ich oder meine Familie und meine Freunde sollen genug haben, nicht nur die Menschen in meinem Land. „Unser tägliches Brot“ meint: Alle Geschöpfe Gottes sollen satt werden. Und die Wissenschaftler sagen: Sie könnten alle satt werden – wenn wir nur richtig wirtschaften.
Die Bitte um tägliches Brot meint nämlich auch: „Acker, Vieh, gutes Wetter, Geld und Gut, gute Regierung, gutes Wetter, Frieden, Gesundheit“ und dergleichen mehr, hat Martin Luther in seinem Katechismus erklärt. Heute würde er wohl hinzufügen: zeitgemäße und umweltschonende Anbaumethoden; gerechte Weltwirtschaftsordnung, faire Löhne und Preise, bezahlbarer Wohnraum. Dass das gelingt, dafür gebe Gott seinen Segen.
Gottes Segen und menschliche Arbeit – wenn beides zusammenkommt, dann haben alle ihr tägliches Brot. Genau das wird zum Beispiel in Stuttgart einmal im Jahr gefeiert. Da findet neben dem Cannstatter Volksfest auf dem Wasen alle zwei Jahre das landwirtschaftliche Hauptfest statt. Vor über zweihundert Jahren hat König Wilhelm I. es eingesetzt, aus Dankbarkeit und Freude, weil damals, 1818, nach Jahren mit verheerenden Missernten und Hunger endlich wieder eine ausreichende Ernte eingefahren werden konnte. Zugleich hat der König das öffentliche Wohlfahrtswesen aufgebaut, die Leibeigenschaft aufgehoben, die landwirtschaftliche Schule in Hohenheim gegründet und Preise ausgesetzt für Entwicklungen und Erfolge in der Landwirtschaft.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ – ich glaube, wer so betet, wird auch erfolgreich dafür arbeiten, dass alle genug zum Leben haben. Nicht nur Brot.
Und vergib uns unsere Schuld
Schuldgefühle können einen fix und fertig machen. Sie drücken einen nieder, und man ist wie gelähmt. Ich habe einen Fehler gemacht, nicht zum ersten Mal. Das hatte Folgen, und ich kann mir das nicht verzeihen. Andere werden es erst recht nicht verzeihen können, denke ich mir. Schon gar nicht vergessen. Also bin ich am besten ganz still und halte mich im Hintergrund, damit mich keiner bemerkt. Menschen mit Schuldgefühlen leben im Schatten. Dort, wo keiner sie wahrnimmt.
Es gibt noch andere Strategien, mit Schuldgefühlen umzugehen. Man kann auf andere schieben, was passiert ist. Versuchen, es wegzulügen: „Ich war das nicht!“ Oder es beschönigen: „Wo ist das Problem? Nun stellt euch mal nicht so an!“ Eines bleibt bei all diesen Strategien aber immer gleich: Man ist wie gelähmt, weil man so sehr damit beschäftigt ist.
Von Jesus wird eine Geschichte erzählt, wie man da herauskommen kann. Vier Männer bringen einen fünften zu Jesus. Weil er gelähmt ist, müssen sie ihn auf einer Trage transportieren. Und weil es um Jesus herum so voll ist, lassen sie ihn durchs Dach zu ihm herunter (Mk 2,3–12). Als sie das geschafft haben und Jesus den Mann sieht, sagt er zu ihm: „Deine Schuld ist dir vergeben!“ Anscheinend hat er erkannt, was dem Mann fehlt: Seine Schuldgefühle lähmen ihn. Und als die Umstehenden meinen, das sei doch keine Hilfe für den Mann auf seiner Trage, sagt Jesus noch: „Steh auf und geh nach Hause!“ Da steht der Mann auf und geht. Er hat gehört: Deine Schuld ist vergeben. Sie bedrückt ihn nicht länger. Der Mann kommt wieder auf die Beine.
Schuldgefühle sollen einen nicht fix und fertig machen. Jesus hat Schuld vergeben, im Namen Gottes. Und seinen Schülern und Nachfolgerinnen hat er gesagt: Darum könnt ihr auch bitten, „Vergib uns unsere Schuld!“. Das ist lebenswichtig. Deshalb kommt es im Vaterunser gleich nach der Bitte um das tägliche Brot.
„Vergib uns unsere Schuld.“ Für mich heißt das: Nicht nur ich mache Fehler. Ich bin nicht die Einzige, der das passiert. Aber Gott will nicht, dass wir uns quälen mit unseren Schuldgefühlen. Er vergibt, so wie Jesus das mit diesem gelähmten Mann gemacht hat. Das heißt nicht, dass alles unter den Teppich gekehrt wird. Gott schafft auch nicht einfach aus der Welt, was ich vielleicht angerichtet habe. Aber ich kann aufstehen und versuchen, es wiedergutzumachen. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich kann mit meiner Schuld leben, weil Gott mich mit meiner Schuld bestehen lässt. So kann ich neu anfangen.
Sorry
„Sorry seems to be the hardest word“ – „Entschuldigung scheint das schwierigste Wort zu sein“. Dieses Lied von Elton John ist schon viele Jahre alt. Und noch immer wird es gespielt, und viele nicken mit dem Kopf, wenn sie es hören. Wer einen Fehler gemacht, vielleicht sogar anderen geschadet und wehgetan hat, der weiß das: Ich kann nicht zugeben, dass es falsch war. Und mich schon gar nicht entschuldigen.
Warum ist es so schwer, sich zu entschuldigen? Ich glaube, weil es noch schwerer ist, zu vergeben. Viele können nicht gut verzeihen. Oft wollen sie das auch gar nicht. Weil sie so verletzt sind oder so empört. Oder, weil sie damit den anderen in der Hand haben, der einen Fehler gemacht hat. Das kann man ja immer wieder hervorholen: „Ich weiß noch gut, was du damals getan hast. Da komme ich nicht drüber weg.“ So kann man andere immer wieder kleinmachen und beschämen, ihnen etwas vorwerfen. Ein bisschen kann man sich dann wie Gott fühlen, der den Daumen hebt oder senkt und über den anderen urteilt. Und das immer wieder aufs Neue. Aber so funktioniert Zusammenleben nicht.
Ich glaube: Wenn jemand nicht verzeihen kann, dann kann er auch nicht um Entschuldigung bitten. Daran erinnert das Vaterunser, wenn gleich nach dem „vergib uns unsere Schuld“ der Nachsatz kommt: „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. Im Vaterunser bitten Menschen Gott um Entschuldigung, weil sie wissen: Nur, wenn mich die Vergangenheit nicht mehr belastet und lähmt, kann ich aufrecht stehen und das Leben neu angehen. Nur so kann ich leben – wenn die Vergangenheit mich nicht festhält. Genauso funktioniert auch das Zusammenleben zwischen Menschen nur, wenn sie einander vergeben können. Erst dann können Beziehungen wieder lebendig werden, die erstarrt waren in Angst und Beschämung und Wut und Ärger.
Vergeben, weil Gott vergibt und wie Gott vergibt – das heißt nicht, alles zu vergessen und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Das kann kein Mensch, glaube ich. Aber ernst nehmen, dass es dem anderen leidtut, dass er sich ändern will, und auf Vorwürfe verzichten, das kann man schon. So macht es Gott. Und im Vaterunser sagen wir: So wollen wir es auch machen. Wir verzichten darauf, es dem anderen heimzuzahlen. Wir wollen es gut sein lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse gut sein, was der andere getan hat. Dann kann man neu anfangen.
Versuchskaninchen?
„Und führe uns nicht in Versuchung“ – viele können und wollen sich das nicht vorstellen. Gott, der es gut mit mir meint, sollte mich absichtlich in Versuchung führen? Gewissermaßen lächelnd zuschauen, wie ich einen falschen Weg gehe? Das ist sicher nicht richtig übersetzt, sagen manche dann. Wahrscheinlich muss es heißen: „Führe mich in der Versuchung“ oder „Lass uns nicht in Versuchung geraten“. Das hat sogar der Papst neulich vorgeschlagen.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Gott mich wie ein Versuchskaninchen behandelt und auf falsche Wege führt, bloß um zu sehen, was ich dann tue. Und schon die ersten Christen fanden das anscheinend undenkbar. In der Bibel ist der Brief eines Jakobus aufbewahrt, der hat geschrieben: „Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen: Es ist Gott, der mich in Versuchung führt! Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu“ (Jak 1,13f). Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt, heißt es dann noch.
Dass Gott einen in Versuchung führt, mir scheint immer, dieser Gedanke ist irgendwie eine Ausrede. Ich bin schwach geworden, ich habe mich hinreißen lassen – aber ich kann ja gar nichts dafür. Gott hat mich in Versuchung geführt! Er ist schuld. Er hat mein Leben so gemacht, dass ich gar nicht anders konnte. So kann man sich die Einsicht vom Hals halten, dass man selbst zu gierig war. Zu unbeherrscht. Zu bequem.
„Führe uns nicht in Versuchung!“ – ich finde diese Bitte realistisch. Gerade weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Gott ist, der mich in Versuchung führt. Denn diese Bitte rechnet damit, dass ich verführbar bin. Ich weiß, dass ich gern den bequemen Weg nehme. Dass ich schon auch mal zuschlage, um mich abzureagieren. Dass ich nehme, was ich kriegen kann, ohne an andere zu denken. Aber es ist nicht Gott, der mich verführt. Ihn kann ich bitten: „Führe mich nicht in Versuchung!“ Erinnere mich zur rechten Zeit an das, was gut ist. An das, was Jesus uns gelehrt hat: nicht zurückschlagen, sondern den anderen ohne Gewalt zur Vernunft bringen. Es dem anderen nicht heimzahlen, sondern vergeben. Verzichten und teilen, damit für alle reicht, was da ist.
Ich bin verführbar. Ich weiß das. Und es bleibt mir nichts anderes, als zu beten: „Und führe uns nicht in Versuchung!“, sondern hilf mir, verantwortlich zu leben.
Verstrickt
„Der ist ganz der Vater“, sagt man manchmal von einem kleinen Jungen oder von einem Mädchen: „ganz die Mutter“. Ein anderer, heißt es, hat den Starrsinn vom Opa. Oder die schönen Locken von der Oma. Vieles, was in mir steckt und sich im Lauf der Jahre ausbildet, kommt irgendwoher. Das Gute: die schlanke Figur, die Freude an der Musik oder die Begabung für Mathe. Das Schlechte aber auch: die unreine Haut, das aufbrausende Wesen, die Bequemlichkeit.
Es ist nicht immer die biologische Vererbung, es sind nicht immer die Gene, die das ausmachen, wie ich mich verhalte und was ich tue. Es sind auch die Lebensbedingungen, die Umwelt, die Erziehung. Eine Mutter macht mit ihrem Bedürfnis nach Ordnung die ganze Familie verrückt. Manchmal merkt sie es selbst und würde es gern ändern. Aber so ist sie erzogen worden. Sie kann nicht anders. Was das wohl mit ihren Kindern macht? Ein Vater wäre selbst gern Fußballer geworden. Jetzt macht er seine Kinder nach dem Match fertig, wenn sie nicht gut genug gespielt haben. Hinterher tut es ihm leid. Aber es steckt in ihm. Er kann nicht anders. Wie lange die Kinder wohl noch Spaß am Sport haben?
Ich bin verstrickt in das, was vor mir war und um mich herum ist. Ich kann da nicht raus. Niemand kann in seinem Leben bei einem perfekten Punkt Null anfangen. Es ist immer schon etwas da, Gutes und Böses. Und ich gebe das weiter. Ich kann auch nicht anders.
Es gibt Menschen, die versuchen mit großem Aufwand, da herauszukommen. Sie bemühen sich, ökologisch tadellos zu leben, sie sind bedingungslose Pazifisten, erziehen ihre Kinder aufmerksamer und besser als andere. Meinen sie jedenfalls. Aber wenn ich mein Kind mit hohem Aufwand in die pädagogisch hochgelobte Reformschule schicke statt in die Stadtteilschule mit ihren Problemen, wer weiß, was ihm fehlt, wenn es die Kinder in der Umgebung nicht kennt und keine Spielkameraden hat? Es gibt keinen Punkt Null, an dem man neu anfangen kann.
„Erlöse uns von dem Bösen“, beten wir Christen im Vaterunser. Ich glaube, damit ist genau diese Verstrickung gemeint. Und vor allem die Hoffnung, dass das aufhört, dass ich wirklich neu anfangen und alles gut machen kann. Das gibt es höchstens nach dem Tod, sagen viele. In einer anderen Welt. Manche sagen: „im Himmel“. Aber das Vaterunser redet eigentlich immer von dieser Welt. Auch „auf Erden“ soll nach Gottes Willen alles gut werden, wenn Gottes gute Zukunft da ist. Und bis dahin? Bis dahin will ich genau hinschauen. Wahrnehmen, wo ich verstrickt bin in Dinge, die nicht gut sind. Dann kann ich es vielleicht doch anders probieren. Nicht überall. Aber hier und da. Das wären erste Schritte.
Tischgebet
„Es war einmal ein Krokodil“, so fängt der Tischspruch an, den Matthis im Kindergarten gelernt hat. Sie sagen das vor dem Essen alle zusammen, damit alle dann auch miteinander anfangen. So geht der Spruch weiter: „Es war einmal ein Krokodil, das fraß und fraß und fraß so viel, es schlürfte und schmatzte, bis es endlich platzte!“ Anschließend klatschen alle laut in die Hände und sagen „Guten Appetit“. Dann geht’s los, am liebsten mit Spaghetti und Tomatensoße.
Ich finde das gut, dass sie lernen, zusammen anzufangen. Und weil Matthis das im Kindergarten gelernt hat, machen sie es zu Hause auch so. Aber manchmal sagt er: „Ich will beten.“ Meistens, wenn die Oma zu Besuch ist. Dann sagen sie: „Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümchen trinkt von dir, hast auch unser nicht vergessen, lieber Gott, wir danken dir.“ Ich finde es auch gut, dass Matthis beides lernt: Zusammen anfangen und beten. Ich finde das gut, dass seine Eltern das ernst nehmen, wenn er Beten vorschlägt, selbst wenn sie sonst vielleicht nicht beten. Und vor allem finde ich gut, dass Matthis als Erstes danken lernt. Er lernt nicht: Ich will dies und ich möchte das. Matthis lernt danken, dass er froh sein kann, dass es genug zu essen gibt. Und dass das nicht selbstverständlich ist.
Natürlich weiß ich, dass es auch andere Erfahrungen gibt. Längst nicht alle Kinder haben genug zu essen. Sie verhungern, selbst heute noch, obwohl das eigentlich nicht nötig wäre. Unsere Welt könnte sie ernähren. Blümchen verdorren, weil es immer wärmer wird auf der Erde. Das wird Matthis leider alles auch noch lernen, wenn er größer wird. Aber erst einmal lernt er zu begreifen, wie gut es ihm geht. Dass er sogar teilen kann mit dem kleinen Bruder, ohne dass er Angst haben muss, dass es nicht reicht. Wie schön, wenn das Leben so anfangen kann: mit Dankbarkeit. Ich glaube, dass so ein Anfang ein Leben prägt. Man muss nicht immer nur auf sich selbst sehen, wenn man Grund hat, dankbar zu sein.
Irgendwann wird Matthis hoffentlich begreifen, dass der Spruch vom Krokodil etwas anderes ist als das Dankgebet zu Gott. Irgendwann wird er hoffentlich mehr von Gott hören und lernen, zum Beispiel, dass man sich auf ihn verlassen kann. Nicht bloß, wenn es einem gut geht, sondern auch, wenn man traurig ist. Dann hilft Gott, das auszuhalten. Ich hoffe, dass Matthis das lernt. Von seinen Eltern und Großeltern vor allem. Manchmal übrigens betet Matthis selbst. Dann sagt er: „Lieber Gott, segne flott!“ Das hat auch Tradition in der Familie.
Glaubwürdig
Im Internet wird vieles behauptet, das sich hinterher als haltlos herausstellt. Ängste werden geschürt, Empörung wird erzeugt – und dabei geht es doch nur darum, die eigenen Interessen durchzusetzen oder Geld zu verdienen. Am Ende wird man grundsätzlich misstrauisch. „Die belügen uns doch alle“, sagen inzwischen viele.
Solche Verunsicherung ist überhaupt nicht neu. Der Prophet Jeremia, ein Gottesmann, hat schon vor mehr als zweitausendfünfhundert Jahren gegen Lügenpropheten gekämpft. „Sie betrügen euch“, hat er gesagt. „Sie sprechen nur von ihren eigenen Träumen und Befürchtungen (Jer 23,16). Sie reden von dem, wie sie sich die Zukunft vorstellen, damit ihr Angst kriegt und heute schon so handelt, als ob das alles wahr wäre, was sie sagen.“
Aber, gibt Jeremia zu bedenken, wahre Propheten sagen nicht die Zukunft voraus. Sie beurteilen die Gegenwart. Sie decken auf, was heute geschieht. Und dabei haben sie nur einen Maßstab: Entspricht das Handeln der Menschen dem, wie Gott sich die Menschen vorstellt? Was heute geschieht – ist das gerecht? Barmherzig? Kommen die Armen zu ihrem Recht? Werden die freundlich aufgenommen, die flüchten mussten? Wahre Propheten helfen, heute das Richtige zu tun. Sie helfen dabei, heute für eine Welt einzutreten, in der alle Menschen angstfrei leben können. Nur so kann auch die Zukunft gut werden, weil so Vertrauen wächst und Solidarität unter den Menschen.
„Na gut“, sagen Sie jetzt vielleicht noch einmal. „Aber wem soll ich denn trauen? Jeder sagt etwas anderes. Jeder schlägt eine andere Lösung vor.“ Jeremia hat damals Merkmale genannt, an denen man sich orientieren kann. Erstens, sagt er: Reden die Menschen von Gott? Von der Gerechtigkeit für alle, für die unser Gott steht? Oder sprechen sie von anderen Göttern (Jer 23, 27) – von nationaler Identität vielleicht, von „mia san mia“ und „das Boot ist voll“? Geht es also um ihre eigenen Ideologien, die sie predigen, oder um die Umkehr zu Gott, der Leben für alle will?
Gott will, dass alle leben können. Ich glaube: Wer sich daran orientiert, der vertraut auf den richtigen Weg.
Christusglaube – nicht Bibelglaube
„Was für die Katholischen der Papst sein sollte, das ist für euch Evangelische die Bibel: unfehlbar!“ Das hat mir eine Frau geschrieben, weil ich in meinen Radiobeiträgen immer wieder auf biblische Geschichten hinweise. Die Frau war ein bisschen genervt: „Wie kann man sich so kritiklos auf ein so altes Buch verlassen? Ich kann nicht mehr alles glauben und für wahr halten, was in der Bibel steht. Da wissen wir heute einfach mehr.“
Hat die Frau Recht? Glauben wir Evangelische an die Bibel? Unbeirrt und unkritisch? Ich finde es tatsächlich wichtig, deutlich zu sagen, woher ich meine „Morgengedanken“ und „Anstöße“ im Radio nehme. Für so weise halte ich mich nicht, dass ich da einfach sagen könnte, was mir selbst richtig und wichtig scheint für unsere Zeit. Und ich finde, das sollen meine Zuhörer auch wissen, dass ich aus der Bibel lerne.
Aber ich glaube nicht an die Bibel. Christen glauben an Jesus Christus. In ihm, glauben wir, hat Gott sein Gesicht gezeigt. In ihm hat Gott sich den Menschen liebevoll zugewendet, damit sie gut leben können. Davon ist an vielen Stellen in der Bibel die Rede. Und genau deshalb darf man eben nicht kritiklos alles übernehmen, was dort steht. Nicht mal Martin Luther hat das getan, sondern alles daran gemessen, ob da von Christus die Rede ist. Oder, besser gesagt: von dem, was dem Geist und dem Reden und Handeln Jesu entspricht. Deshalb ist es wichtig, immer wieder zu fragen: Stimmt denn das, was ich an einer Stelle in der Bibel lese, mit dem zusammen, was von Jesus erzählt wird? Da wird sich dann zeigen, dass manches nicht zu dem Jesus passt, der zum Beispiel Männer und Frauen gleich behandelt hat und der zu dem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden ist, gesagt hat: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“ Daran kann ich beurteilen, was im Einzelnen in der Bibel steht. Und dann manchmal sagen: Ich glaube, Jesus hätte das anders gesehen. Deshalb sehe ich das auch anders.
Manches, was in der Bibel steht, ist zudem gar nicht so wichtig, da kann ich ruhig bejahen, was die Wissenschaft inzwischen anders sieht. Aber dass Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, damit wir Menschen gut leben können, das ist für mich wichtig. Das, scheint mir, ist keine veraltete und überholte Geschichte, „nicht Lesewort“, hat Martin Luther gesagt: „Nicht Lesewort … sondern Lebewort … nicht zum Spekulieren und Grübeln, sondern zum Leben und Tun.“ Die Geschichte von Jesus hat Konsequenzen. Und ich finde: Darüber sollten meine Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser selbst nachdenken können. Deshalb erzähle ich Geschichten aus der Bibel.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.