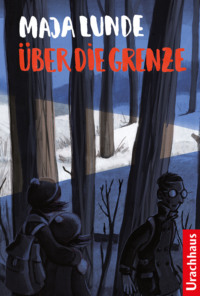Kitabı oku: «Über die Grenze», sayfa 2

Der Geisterjunge
Klara hatte schon Feierabend und war nach Hause gegangen. Wir hatten unsere Pyjamas angezogen, Hafergrütze gegessen und uns schlafen gelegt – Otto mit gefalteten Händen auf der Bettdecke, seine Brille zusammengeklappt auf dem Nachtschrank. Ich lag zusammengerollt wie ein Würstchen im Schlafrock in all dem Bettzeug.
Ich träumte von Graf Schwarzblut. Wir fochten einen wackeren Schwertkampf. Er stieß sein Schwert gegen meines.
Ich sprang herum, um ihm zu entkommen, aber er folgte mir. Also musste ich die Beine in die Hand nehmen und Deckung suchen.
Füße hämmerten gegen den Boden. Graf Schwarzblut war direkt hinter mir. Ich lief so schnell ich konnte, doch er holte auf. Ich hörte nur meine Schritte.
Dann erwachte ich jäh. Ich hatte das Gefühl, immer noch zu laufen, denn das Laufgeräusch war mir aus dem Traum gefolgt. Aber – ich lag doch in meinem Bett? Trotzdem hörte ich die Schritte auf der Erde.
Dunk, dunk, dunk. Dann wurde es ganz still. Schließlich folgte ein weiteres schweres Dunk.
Ich stand auf. Das Geräusch kam von draußen. Otto hörte offensichtlich nichts. Er schlief mit friedlichem Gesicht.
Ich schlich mich ans Fenster und spähte hinaus. Der Mond erleuchtete den Garten. Zwischen den Apfelbäumen konnte ich eine weiß gekleidete Gestalt erkennen, die dort entlanglief. Dann sprang sie ab, flog durch die Luft und landete etwas weiter entfernt mit einem geräuschvollen Dunk.
Seltsam.
Ich öffnete das Fenster und kletterte hinaus. Von unserem Zimmer aus führte eine Feuerleiter hinunter in den Garten. Otto benutzte sie nie. Sobald er sich mehr als zehn Zentimeter über dem Erdboden befand, begann er nämlich zu schwanken, wahrscheinlich, weil er eine Memme war. Ich dagegen benutzte die Leiter ständig.
Ich schlüpfte hinunter und schlich zu den Johannisbeerbüschen. Von hier hatte ich einen guten Blick.
Die Gestalt war ungefähr so groß wie ich. Sie fuhr fort, zu laufen und durch die Luft zu fliegen – mehrere Male. Das war das Merkwürdigste, was ich je gesehen hatte. Ein Gespenst, das durch unseren Garten flog?
Ich schlich näher.
Plötzlich drehte sich das Gespenst um, starrte mir direkt ins Gesicht und blieb wie angewurzelt stehen. Es war ein Junge. Ein blasser, dünner Junge mit schwarzen Haaren. Und ziemlich hübsch.
Er sah mich an, und ich sah ihn an.
So standen wir eine ganze Weile. Mit einem Mal drehte er sich um und lief weg. Vorbei an den Apfelbäumen, den Blumenbeeten mit den Kartoffeln und um die Hausecke. Ich lief ihm nach. Als ich um die Ecke kam, war dort niemand – aber die Haustür stand offen. Er musste ins Haus geschlüpft sein.
Ich betrat den Flur, machte die Tür hinter mir zu, legte die Sicherheitskette vor und sperrte ab. Unser Haus lag groß und still da. Ich blieb mitten im Flur stehen und überlegte. War er in den Keller hinuntergegangen?
Vielleicht war es seine Stimme gewesen, die ich früh am Tag dort unten gehört hatte? Ich ging zur Kellertür, aber plötzlich drang aus der Küche ein leises Geräusch. Aha! Dort hatte er sich also versteckt. Jetzt hatte ich ihn!
Aber ich hatte ihn nicht. Denn im selben Augenblick geschah etwas draußen auf dem Hof.
Scheinwerferlicht glitt durch das Fenster und über die Wände des Flures. Eine Reihe von Autos raste donnernd auf unseren Hof. Türen wurden geöffnet, und schwere Stiefelschritte stürmten auf das Haus zu.
Dann klingelte es. Ungestüm und lang anhaltend. Und jemand rief und hämmerte gegen die Tür.
»Doktor Wilhelmsen!«
Irgendjemand wollte etwas von Papa – mitten in der Nacht. Manchmal passierte es, dass nachts Patienten vor der Tür standen, aber nie so viele auf einmal.
»Doktor Wilhelmsen! Machen Sie die Tür auf!«

Verstecken – aber nicht zum Spaß
Der Erste, der in den Flur hinunterkam, war Otto. Seine Haare standen nach allen Seiten ab, und er blinzelte, während er seine Brille aufsetzte.
Dann waren auch Mama und Papa da, in Nachthemd und Pyjama. Sie sahen auf einmal ganz klein aus. Beide zitterten in ihrem Nachtzeug.
»Geht nach oben«, sagte Papa leise zu mir und Otto. Es war etwas Blankes und Dunkles in seinen Augen, etwas, was ich noch nie gesehen hatte. Auch ich zitterte in meinem Pyjama.
Normalerweise hätte ich mich geweigert, aber nun tat ich, was er sagte – wegen dieser Augen. Otto und ich gingen nach oben, aber nicht in unser Zimmer. Stattdessen hockten wir uns auf die oberste Treppenstufe und sahen hinunter auf all das, was passierte.
»Wilhelmsen! Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit! Machen Sie die Tür auf!«, schrien die da draußen.
Papa warf Mama einen schnellen Blick zu. Sie nickte unmerklich. Dann ging er zur Tür, nahm die Sicherheitskette ab und drehte den Schlüssel herum. Sekunden später rauschte ein ganzer Haufen Polizisten herein. Es waren so viele, dass ich sie auf die Schnelle nicht zählen konnte – vielleicht waren es zehn.
Sie liefen an Mama und Papa vorbei, teilten sich auf und verstreuten sich im ganzen Haus. Ein paar kamen die Treppe herauf.
Warum waren sie hier? Hatte vielleicht jemand herausgefunden, dass ich an die Rückseite unseres Einkaufladens »Lehrer Knutsen ist eine Kackawurst« geschrieben hatte – war das der Grund? Aber die Polizei nahm ja keine Kinder fest. Das war zum Glück verboten.
Und ganz offensichtlich war es nicht wegen »Lehrer Knutsen ist eine Kackawurst«, denn die Polizisten liefen an Otto und mir vorbei. Es war ganz klar, dass sie irgendetwas suchten. Oder irgendjemanden.
Sie waren überall zur gleichen Zeit. Einige liefen in unser Zimmer, andere auf den Dachboden, wieder andere in Mamas und Papas Schlafzimmer. Sie guckten in absolut jeden Verschlag und jeden Kleiderschrank und warfen und wühlten alles fürchterlich durcheinander. Es war fast, als würden sie Verstecken spielen – aber nicht zum Spaß. Denn immerzu schrien und brüllten sie mit gellenden Stimmen: »Keiner da! Die Küche ist klar! Dachboden ist leer!« Und solche Sachen.
Papa stand untätig herum und zitterte in seiner Pyjamahose. Auch Mama stand einfach da und sah zu, obwohl diese Leute mehr Unordnung machten als ich es je gemacht hatte, und Unordnung machte sie normalerweise ziemlich böse.
Dann verschwanden die Polizisten im Keller.
Mama griff nach Papas Hand. Ich bekam Herzklopfen, als ich die beiden Hände sah. Warum sagten sie nichts? Warum standen sie da und hielten einander an den Händen, während unser Haus auf den Kopf gestellt wurde? Und warum blieb die Polizei so lange im Keller?
Ich konnte hören, wie sie dort unten herumlärmten.
Lange.
Dann fielen mir plötzlich der Schrank und die Stimmen ein, die ich vor Schreck vergessen hatte. Und ich hoffte, hoffte mit meinem ganzen zehnjährigen Herzen, dass sie den Schrank nicht bewegen würden und dass die, die sich dort versteckten, ruhig waren.
Endlich kamen die Polizisten wieder herauf.
»Der Keller ist leer«, sagte einer von ihnen.
Ich atmete erleichtert auf.
Mama ließ Papas Hand los, weiter geschah nichts.
Die Polizisten bildeten einen Ring um sie.
Ich erkannte einen der Polizeibeamten. Er war bestimmt der Chef des Ganzen. Vor dem Krieg hatte er auf dem Marktplatz die Rede zum 17. Mai, unserem Nationalfeiertag gehalten. Da war er froh gewesen und hatte eine wehende Fahne in die Sonne gehalten. Nun war er einfach nur wütend.
Vor dem Krieg sagten die Erwachsenen, dass die Polizei auf uns aufpasste und Diebe einsperrte, damit wir in unserem Vaterland Norwegen sicher leben konnten. Aber das galt nicht mehr. Nun war die Polizei meist damit beschäftigt, das zu tun, was die Deutschen und die Nationale Sammlung bestimmten.
Der Polizeichef sah Mama und Papa einfach nur an, als würde er sie etwas mit den Augen fragen. Es war ohrenbetäubend still.
»Wo sind sie?«, fragte er plötzlich.
»Wer – sie?«, fragte Papa.
»Ich glaube, Sie wissen, von wem die Rede ist. Die jüdischen Kinder, die Sie verstecken.«
»Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen.«
Ja, natürlich hatte er das nicht. Alles war ein Missverständnis. Ganz klar. Es gab doch wohl keine Kinder, die bei uns versteckt wurden! Bald würden die Polizisten ihrer Wege fahren, und wir konnten ins Bett gehen und weiterschlafen. Oder vielleicht konnten wir zusammen in der Küche Kakao trinken. Das wäre gemütlich. Und morgen würde alles wieder so sein wie immer.
Aber da war dieser Schrank. Und das Reden im Keller … Ich wusste ja, dass mit unserem Haus und mit Mama und Papa zurzeit irgendetwas nicht ganz stimmte.
Plötzlich war es, als würde der Polizeichef hören, was ich dachte, denn er hob den Kopf und starrte mich und Otto an. Dann stieg er ein paar Treppenstufen hoch. Er zog die Lippen auseinander, als versuchte er zu lächeln.
»Kinder … Ihr wisst doch, dass man nicht lügen darf?«
»Halten Sie die Kinder da raus!«, rief Papa von unten.
Aber der Polizeichef fuhr fort, uns anzustarren.
»Habt ihr in letzter Zeit hier im Haus irgendwelche merkwürdigen Geräusche gehört oder etwas Seltsames gesehen?«
Otto kniff mich fest in den Arm. Das hieß wohl, ich sollte nichts sagen. Und das hatte ich schon lange begriffen.
»Nein, wir haben in letzter Zeit KEINE merkwürdigen Geräusche gehört oder etwas Seltsames im Haus gesehen«, erwiderte ich mit einer Stimme, von der ich hoffte, dass sie sehr sicher klang. Und dann schüttelte ich energisch den Kopf, um noch sicherer zu wirken.
Es hätte gutgehen können, aber ich konnte nichts für meinen Blick. Den hatte ich nicht im Griff. Ich konnte es nicht lassen, zur Kellertür hinzusehen. Denn ich wusste ja, dass dort unten jemand war. Der Polizeichef starrte mich an. Dann drehte er sich um und folgte meinem Blick.
»Dreht noch eine Runde im Keller«, sagte er zu seinen Leuten.

Handschellen
Sie liefen hinunter in den Keller. Ich hielt die Luft an, und ich glaube, Otto auch. Mama griff wieder nach Papas Hand.
Zunächst war es völlig still. Dann hörte man das Geräusch eines Möbelstücks, das über den Boden geschoben wurde. Holz scharrte auf Holz. Und dann rief eine Stimme: »Öffnen!«
Sie machten da unten ziemlich viel Lärm – hämmerten und schlugen gegen die Tür hinter dem Schrank.
Plötzlich gab es einen lauten Krach. Das musste die Tür gewesen sein, die nachgegeben hatte.
»Macht das Licht an«, rief jemand.
Wieder wurde es ganz still. Vielleicht fanden sie nichts?
Dann polterten die Polizisten wieder die Treppe hoch. Sie schüttelten den Kopf: »Sie sind hier gewesen, aber jetzt sind sie weg.«
Mama warf Papa einen schnellen Blick zu, als würde sie irgendetwas nicht ganz verstehen. Aber sie lächelte fast unmerklich.
Der eine Polizist hielt eine Puppe in der Hand. Sie gehörte weder mir noch Otto. Ich hatte sie noch nie zuvor gesehen.
Er warf die Puppe in eine Ecke.
»Also, Doktor Wilhelmsen – wo haben Sie sie versteckt?«, fragte der Polizeichef. »Sie kommen besser weg, wenn Sie die Wahrheit sagen.«
»Wie gesagt – ich weiß nichts.«
»Aber wir sehen doch, dass sie jemanden versteckt haben.« Der Polizeichef überlegte einen kurzen Moment, bevor er fortfuhr: »Dann müssen Sie eben mitkommen.« Mama schluchzte auf.
»Aber was ist mit Gerda und Otto?«
»Daran hätten Sie ein bisschen früher denken sollen – statt an fremde Kinder.«
»Sie können uns nicht einfach mitnehmen! Sie haben keinerlei Beweise!«, rief Papa. Ich hatte ihn noch nie zuvor so gesehen. Ach, doch, ein Mal. Als ich ausgerissen war, in den Wald, und erst abends nach Hause gekommen war. Da war er so gewesen – richtig wütend und gleichzeitig voller Angst.
»Das liegt nicht in meiner Verantwortung«, sagte der Polizeichef. »Das entscheiden nicht wir.«
»Ach, dann steckt Dypvik also dahinter?«, fragte Papa. Seine Stimme war scharf.
Der Polizeichef zuckte ein bisschen zusammen und verlor irgendwie den Schwung.
»Fühlt es sich gut an, dem Feind zu helfen?«, fuhr Papa fort.
»Ich tue nur meine Pflicht«, sagte der Polizeichef leise. »Die NS hat einen Hinweis bekommen – Dypvik hat mich gebeten, dem Hinweis nachzugehen. Ich kann mich nicht verweigern, das wissen Sie.«
Dann wandte er sich an zwei der Polizisten.
»Bringt sie ins Auto. Und gebt Dypvik Bescheid. Er will das Haus bestimmt selbst kontrollieren.«
Und dann geschah das, was ich nie vergessen werde – auch nicht, wenn ich hundertzwanzig Jahre alt werde.
Zwei Polizisten nahmen Mama und Papa fest am Arm, legten ihnen Handschellen an und schoben sie aus der Tür. Papa schaffte es gerade noch, sich zu mir umzudrehen.
»Geht nirgendwohin. Wartet auf Klara. Sie kommt wie immer morgen früh«, sagte er mit seiner feinen, guten Papastimme.
»Aber … Wohin fahrt ihr?« Ich wollte hinter ihnen hergehen, aber der Polizeichef stellte sich mir in den Weg.
»Wir nehmen sie nur mit hinunter zum Bahnhof. Von dort werden sie vielleicht in ein paar Tagen ins Konzentrationslager nach Grini gebracht«, sagte er leise und sah dabei aus wie ein verlegener Hund.
»Nach Grini!« Endlich gab Otto einen Ton von sich.
Der Polizeichef nickte und verschwand hinter Mama und Papa. Sie wurden über den Hofplatz geführt und dann in ein großes Auto geschubst.
Otto legte einen Arm um mich. Zusammen standen wir in der Tür.
Die Motoren starteten.
Aber ich konnte nicht länger still stehen. Ich schüttelte Ottos Arm ab und lief hinterher.
»STOPP!«, brüllte ich.
Ich würde sie aufhalten – und wenn ich mich auf den Weg legen müsste und überfahren würde.
Aber es war zu spät. Das Auto mit Mama und Papa entfernte sich immer schneller. Ich schaffte nicht, es einzuholen, obwohl ich so schnell lief, dass meine Füße kaum den Boden berührten.
In diesem Auto saßen unsere Eltern, auf dem Weg ins Gefängnis. Und das war meine Schuld – weil ich zur Kellertür hingesehen hatte.

Wilde Tiere
Otto weinte. Aus seinen Augen rannen dicke Tränen. Er stand aufrecht wie ein Pfeiler und weinte nur.
In mir waren keine Tränen. Stattdessen war da anderes, das an mir riss und zerrte, fast wie wilde Tiere. Ich wusste nicht, was ich mit all diesen Tieren tun sollte, aber ich schaffte es jedenfalls nicht, ruhig zu bleiben. Ich zog die Tür zu und stieß das Tischchen, an dem ich gerade vorbeikam, gegen die Wand, sodass ein Blumentopf kaputtging und eine Kerze zerbrach. Aber das half überhaupt nicht. Die Tiere waren noch ebenso wild.
Ich musste etwas tun. Wir konnten damit anfangen, den Keller zu untersuchen. Was befand sich hinter der verschlossenen Tür? Was hatte die Polizei gefunden?
Ich öffnete die Kellertür, und wir schlichen die Treppe hinunter. Der Schrank stand mitten im Raum. Die Tür zum Kartoffel- und Marmeladenraum war offen. Ein großes schwarzes Loch in der Wand.
Wir traten über die Schwelle.
Der Raum war stockfinster. Otto machte das Licht an, und eine funzelige Glühbirne erhellte das Wenige, das da war.
Auf dem Boden lagen zwei Matratzen und zwei Decken. In einer Ecke stand ein Rucksack. Otto zog einige Kinderklamotten daraus hervor. Mädchen- und Jungenkleidung. Aber nicht unsere.
Wir suchten weiter, aber mehr fanden wir nicht.
Ich sah mich um. Hatte hier jemand gewohnt? Hier geschlafen und gegessen und ausgeharrt? Was für ein trauriges kleines Zimmer! Eng und dunkel, und zudem roch es nach Keller.
Plötzlich entdeckte ich etwas. Unter einer der Decken lag etwas Flaches. Ein Buch. Ich hob es auf. Es war Die drei Musketiere. Nicht meines, denn das lag oben in der Stube, aber dieselbe Geschichte und dasselbe Bild von den drei stattlichen Kerlen mit Degen, Umhängen und riesengroßen Hüten. Ich legte es vorsichtig zurück – vielleicht war es irgendjemandem ans Herz gewachsen.
Wir setzten uns in die Küche. Besser gesagt: Otto setzte sich. Ich schaffte es nicht, auch nur eine Sekunde still zu sitzen. Es waren viel zu viele Bären und Wölfe und Luchse in mir.
Also ging ich hin und her. Hin und her. Hin und her. Otto bat mich, mich zu beruhigen, aber das war ganz und gar unmöglich.
»Ich kann doch nicht still sitzen und nichts tun, wenn Mama und Papa nach Grini gebracht werden!«
»Aber Gerda, dagegen können wir nichts tun.«
»Wir müssen sie retten! Wir könnten zum Beispiel einen Tunnel graben!«
Ich hatte mal ein Buch gelesen von einem Mann, der im Gefängnis saß und einen unglaublich langen Tunnel grub, um auszureißen. Er hieß der Graf von Monte Christo. Für ihn war es gut ausgegangen mit dem Tunnel. Warum sollten wir es nicht auch schaffen?
»So etwas machen Leute nur in Abenteuergeschichten«, sagte Otto.
Schon war ich kurz davor zu antworten. Verstand Otto denn nicht, dass wir etwas tun MUSSTEN, weil es meine Schuld war, weil ich es gewesen war, die zum Keller hingesehen hatte? Aber das wusste er ja nicht. Und ich konnte es ihm auch nicht erzählen, denn dann würde er bestimmt so wütend werden, dass es rauchte.
Plötzlich wurden wir abgelenkt – wir hörten etwas. Ein gedämpftes Geräusch aus der Wand.
Abrupt stand Otto auf. Ich blieb stehen.
Wir standen beide wie festgenagelt.
Da war es wieder – ganz leise. Und ich hatte es schon einmal gehört. Es war ein Weinen, dasselbe Weinen wie im Keller.
Aber dieses Mal kam es aus der Luke in der Wand, aus dem Speisenaufzug.
Ich sprang vor und öffnete die Luke.
Leer. Ich sah direkt auf die Wand dahinter, denn der Aufzug war nicht da. Er befand sich offensichtlich zwischen Keller und Erdgeschoss – von oben konnte ich ihn erspähen.
Ich beugte mich in den Schacht vor und lauschte. Es gab keinen Zweifel, da weinte jemand. Und das kam aus dem Aufzug.
Ich begann, an dem Seil zu ziehen, aber es war schwer wie Blei. Otto stand da wie eingefroren und tat nichts.
»Hilf mir doch!«, sagte ich.
Und glücklicherweise tat er das auch. Er griff nach dem Seil und zog mit mir zusammen im Takt.
»Und eins – und zwei – und eins – und zwei.«
Langsam, langsam bewegte sich der Aufzug auf uns zu. »Eins – und zwei – und eins – und zwei.«
Wir mussten all unsere Kraft aufbringen. Keiner von uns hätte es allein geschafft, aber gemeinsam gelang es uns. Der Aufzug schob sich über die Kante. Wir konnten einen Blick auf irgendetwas erhaschen. Beziehungsweise auf irgendjemand.
Wir zogen weiter. Endlich war er oben.
Im Aufzug saßen zwei Kinder. Das eine war ein kleines Mädchen. Das andere ein Junge, der es fest im Arm hielt. Es war der Gespensterjunge aus dem Garten.
Sie sahen uns an, und wir sahen sie an.
Dann streckte ich die Hand aus und flüsterte ihnen zu: »Ihr könnt herauskommen. Die Polizei ist weg.«

Daniel und Sarah
Die zwei Kinder waren keine Gespenster, denn Gespenster müssen sich nicht in Speisenaufzügen verstecken. Die können ja durch Wände gehen und überhaupt wohin sie wollen.
Und Gespenster müssen auch nicht essen. Aber das taten diese zwei. Sie fragten nach etwas zu essen, und weil ich selbst Hunger hatte, aßen wir alle ein bisschen. Brot, Butter und Marmelade. Zu essen fühlte sich normal und alltäglich an. Es half ein bisschen gegen die wilden Tiere. »Habt ihr auch Ziegenkäse?«, fragte das Mädchen plötzlich.
»Aber Sarah!«, sagte der Bruder und stieß sie unsanft in die Seite. Er fand bestimmt, sie sei etwas unhöflich.
»Nein, den gibt es bei uns nicht mehr so oft«, antwortete ich. »Wegen des Krieges.«
Wir aßen weiter.
»Seid ihr Juden?«, fragte ich schließlich.
Und das waren sie.
Ich wusste nicht so viel über Juden. Sie glaubten an Gott, aber nicht an Jesus. Und dann war es so, dass Hitler, der Chef der Nazis, nicht mehr wollte, dass die Juden mit den anderen Leuten zusammenlebten. Deshalb nahm er sie gefangen und schickte sie weg. Was danach mit ihnen geschah – ich hatte keine Ahnung.
Aber nun saßen zwei von ihnen vor uns. Sie hießen Sarah und Daniel. Sie war sieben Jahre alt, er zehn, genau wie ich. Und sie waren zwei völlig normale Kinder. Ihr Vater war Lehrer, die Mutter war schon vor langer Zeit gestorben. Sie wohnten mitten in Oslo, in Sankt Hanshaugen, direkt am Bislett-Stadion.
Sie hielten sich seit vier Tagen in unserem Keller versteckt. Mama und Papa hatten sie mit Essen versorgt. Es waren also Daniel und Sarah, die unsere Lebensmittel bekommen hatten. Eigentlich sollten sie bald weiter nach Schweden – ein paar Erwachsene sollten ihnen dabei helfen. In Schweden war kein Krieg. In einer Stadt direkt an der Grenze wartete ihr Vater auf sie. Er war bereits im Oktober geflohen, als die Polizei damit begonnen hatte, erwachsene jüdische Männer gefangen zu nehmen. Seitdem hatten Sarah und Daniel bei einem Nachbarn gewohnt, aber vor einer Woche hatte dieser Nachbar entschieden, dass sie zu ihrem Vater fliehen mussten, denn es ging das Gerücht, dass die Nazis nun auch jüdische Kinder mitnehmen wollten.
Nun saßen sie in unserer Küche und aßen Brote, und es gab niemanden, der ihnen über die Grenze helfen konnte.
»Ihr könnt hier nicht länger bleiben. Ihr müsst jetzt sofort gehen«, sagte Otto plötzlich. Es war das Erste, was er sagte.
Ich sprang von meinem Stuhl hoch: »Hä? Wo sollen sie denn hin?«
Otto starrte auf die Tischdecke.
»Der Polizeichef hat gesagt, dass der Vater von Johan, Dypvik, kommt, um weiterzusuchen, vielleicht schon heute Nacht«, sagte er. »Wenn er sie findet, dann ist allen klar, dass Mama und Papa schuldig sind, und dann werden wir sie nie mehr sehen. Dann schickt man sie ganz sicher nach Grini.«
Daniel nickte, als habe er verstanden, stand schnell auf und streckte die Hand nach Sarah aus.
»Komm. Wir sollten besser Erwachsene suchen, die wir um Hilfe bitten können.«
»Welche Erwachsenen denn?«, fragte Sarah.
»Hier gibt es keine«, sagte ich. »Es gibt nur uns. Und unsere Küchenhilfe, aber die kommt erst morgen früh.« In meinem Inneren begannen wieder die Tiere herumzuwüten. Ich begriff plötzlich, was los war und dass Otto recht hatte. Sarah und Otto waren der Beweis für das, was Mama und Papa getan hatten. Wenn der Polizeichef und der widerliche Dypvik sie fanden, würden Mama und Papa ernste Schwierigkeiten bekommen.
Und es war meine, ganz allein meine Schuld, dass Mama und Papa im Gefängnis saßen oder vielleicht nach Grini gebracht wurden, diesem Häftlingslager da in Bærum.
Es war also folgendermaßen: Ich musste wieder in Ordnung bringen, was ich angerichtet hatte. Dann würden Mama und Papa freigelassen werden. Im Übrigen gab es niemand anderen hier, der Sarah und Daniel in diesem Augenblick helfen konnte – nur Otto und mich.
»Wir helfen euch«, sagte ich.
Otto verschlug es die Sprache.
»Nein, Gerda. Das ist gefährlich!«
Ich hörte nicht auf ihn, sondern sah Daniel und Sarah an. »Wir schaffen das. Wir gehen nach Halden. Das ist ziemlich in der Nähe von Schweden, glaube ich.«
Otto stand so schnell vom Stuhl auf, dass dieser polternd zu Boden fiel.
»Das geht nicht, Gerda! Da sind überall Soldaten, und wir sind nur Kinder!«
Daniel nickte langsam.
»Wäre es nicht besser, wenn wir irgendwelche Erwachsene fragen?«, sagte er.
»Das machen wir doch! Unser Tante Vigdis wohnt in Halden. Sie ist erwachsen und kann uns helfen. Kommt, wir müssen packen!«
Denn nun begriff ich plötzlich, dass wir wenig Zeit hatten. Wir konnten nicht einmal mehr das Frühstück abräumen. Vier Milchgläser und vier Teller blieben auf dem Tisch stehen. Klara würde bestimmt ärgerlich werden, wenn sie das sah, aber das war nicht zu ändern.
Es gab noch einen Grund, warum wir unsere Milchgläser und Teller lieber hätten wegräumen sollen. Aber das verstanden wir erst später. Und da war es zu spät.
Ich lief hoch in unser Zimmer und holte meinen Rucksack hervor. Was brauchte man eigentlich, wenn man weglaufen wollte? Jetzt im November war es kalt, deshalb packte ich Kleidung ein. Einen warmen Pullover, ein extra Paar Strümpfe, Mütze und Schal. Und eine Decke.
Dann machte ich mein Sparschwein kaputt, das eigentlich eine Sparente war. Sie hieß Quack. Ich rieb zum Abschied meine Nase an ihren Schnabel, bevor ich sie auf den Boden fallen ließ, wo sie in tausend Scherben zerbrach. Zwischen den Scherben fand ich Geld – nicht viel, aber besser als nichts.
Essen brauchten wir auch. Ich war mir nicht sicher, wie lange die Tour dauern würde, also packte ich alles, was ich an Brot finden konnte, ein. Ganz unten in einer Schublade stand eine Zuckertüte. Die nahm ich auch mit, auch wenn Klara wahrscheinlich wütend werden würde. Aber man floh ja auch nicht alle Tage vor den Nazis.
Als ich fertig war, ging ich in den Flur, um meine Schuhe zu suchen. Dort stand Otto – wie angenagelt und ohne Winterzeug.
Ich warf ihm einen Anorak zu: »Zieh dich an!«
Aber er bewegte sich nicht.
Im selben Augenblick kamen Daniel und Sarah aus dem Keller herauf. Sie hatten ihre Sachen gepackt und waren fertig.
»Beeil dich!«, drängelte ich.
Denn nun mussten wir uns wirklich beeilen. Draußen auf dem Hof hörten wir nämlich wieder Autos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.