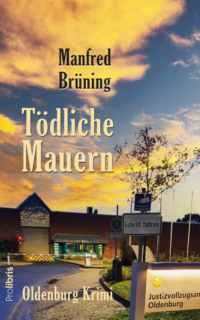Kitabı oku: «Tödliche Mauern»
Inhalte
1 Titelangaben
2 Prolog
3 Montag, 8. Dezember
4 Dienstag, 9. Dezember
5 Mittwoch, 10. Dezember
6 Donnerstag, 11. Dezember
7 Freitag, 12. Dezember
8 Samstag, 13. Dezember
9 Sonntag, 14. Dezember
10 Montag, 15. Dezember
11 Dienstag, 16. Dezember
12 Mittwoch, 17. Dezember
13 Donnerstag, 18. Dezember
14 Freitag, 19. Dezember
15 Samstag, 20. Dezember
16 Sonntag, 21. Dezember
17 Nachwort
18 Literatur
19 Danksagung
20 Info
Manfred Brüning
Tödliche Mauern
Oldenburg-Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie des Autors. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind Institutionen, Straßen und Schauplätze in Oldenburg und Umgebung, die in diesem Roman vorkommen.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2021
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelbild: © Manfred Brüning
Schriften: Linux Libertine
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-236-2
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-225-6
Der Autor
Manfred Brüning wurde 1944 in Bad Salzuflen geboren. Der gelernte Schlosser wurde später Diakon, arbeitete siebenundzwanzig Jahre als Pastor einer Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Ostfriesland und erlebt jetzt seinen Ruhestand im Ammerland. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Nachdem er mehr als eintausend Predigten geschrieben hat, legte er mit „Gnadenlose Engel“ den Grundstein für die Krimireihe mit dem Protagonist Adi Konnert, der in diesem Buch seinen dritten Fall löst.
Wer von euch ohne Schuld ist,
der werfe den ersten Stein.
Johannes 8, 7
Prolog
1971
Der Junge drehte ihnen den Rücken zu. Wie ein Kater hatte er sich zusammengerollt und umklammerte die Knie mit seinen sehnigen Händen. Er hielt die Augen geschlossen, war aber wach. Der diensthabende Klinikarzt und ein Pfleger hatten ihm eine Trainingshose für Erwachsene über die Windel gezogen. Er hatte sich nicht gewehrt. Trotzdem war es schwierig gewesen, ihm auch noch das Oberteil anzuziehen und die dünnen Arme durch die Ärmel zu stecken.
»Kein Wort hat er bisher gesagt. Nicht mal geweint«, sagte der Pfleger. »Er zuckt nur jedes Mal zusammen, wenn man ihn anrührt.«
»Er steht unter Schock«, antwortete der Arzt. »Wir haben für seine blutende Wunde getan, was möglich war. Hoffen wir, dass die Therapeuten und die Zeit seine Seele heilen werden.«
Das Bett neben dem Jungen war leer. Blut klebte auf dem Laken.
2014
Seit siebzehn Monaten trug er wieder Windeln. Breitbeinig stand der schlanke Mann auf dem überdachten Balkon seiner Villa und krallte die Finger um die Mahagoniauflage der Brüstung. Mit den Augen folgte er einem Motorboot, das gegen die Strömung der Weser ankämpfte.
»Tschabo, ich bitte dich.« Seine Frau trat hinter ihn und berührte zärtlich seine Schulter. »Ich bitte dich zum hundertsten Mal, lass dich noch einmal operieren.«
Er schüttelte ihre Hand ab und rückte einen Schritt zur Seite.
Ein Containerschiff schob sich ins Blickfeld. Das Motorboot richtete sich in der Bugwelle des Frachters auf und sackte gleich wieder ins Wellental hinunter.
»Entschuldige, Liebes«, murmelte der Mann und sah weiter auf die Weser. »Lass mich bitte allein.«
»Du kannst diese Entscheidung nicht ohne uns fällen. Sie betrifft auch das Leben deiner Familie. Wir wollen dir doch nur helfen. Bitte!«
Tschabo Dumitrescu wandte sich um und sah seine Tochter in der Tür stehen.
»Es geht um meinen Arsch«, presste er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich sage auch Bitte. Bitte lass mich in Ruhe! Ich habe Nein gesagt. Dabei bleibt es.«
Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen und schlich ins Haus. Sein Kiefer mahlte.
Nach wenigen Minuten griff er zum Telefon auf seinem Stehpult und wählte eine sechsstellige Nummer. Als die Verbindung zustande kam, raunte er: »Es bleibt alles wie besprochen. Es gibt keine Veränderungen.« Dann hörte er aufmerksam zu und beendete das Gespräch.
Montag, 8. Dezember
Kriminalhauptkommissar Adi Konnert musste ins Gefängnis. Er hatte einen Termin in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Vom Lidl-Parkplatz aus schaute er auf die blaue Pforte des gegenüberliegenden Neubaus. Nicht nur wegen des nasskalten Wetters fühlte er sich beklommen. Die Haftanstalt erinnerte ihn für den Bruchteil einer Sekunde an den Keller seiner Kindheit. Unwillkürlich zog er den Kopf zwischen die Schultern.
Ausnahmsweise war er einmal zu früh dran. Er wollte aber auf keinen Fall im Warteraum auf- und abgehen müssen. Mit dem Rücken an den Mittelholm seines Wagens gelehnt, rauchte er lieber. Er wärmte die Hände an einer Dunhill Big Ben Pfeife und kaute auf dem Mundstück herum. Er blickte sich um.
Beim Discounter war Weinwoche. Konnert überlegte, ob er gleich einen ganzen Karton für gemütliche Winterabende besorgen sollte, entschied sich aber dagegen.
Umständlich knöpfte er seinen Mantel auf und suchte in der rechten Hosentasche seine Uhr. Ihm fiel dabei ein, dass er sich von einem seiner Kinder oder Enkelkinder ein neues Armband als Weihnachtsgeschenk wünschen könnte.
Es war immer noch eine Viertelstunde Zeit bis zum Termin. Konnert paffte weiter. Die Qualmwolken kräuselten senkrecht in die nasskalte Winterluft.
Er dachte zurück an die Stunden im verriegelten elterlichen Keller. Die Dunkelheit hatte ihm nichts ausgemacht. Aber er hatte dort die Freiheit lieben gelernt. Das war gut vierzig Jahre her. Er schaute hinüber zur Haftanstalt. Freiheitsentzug ist Strafe genug, stellte er fest.
Aus der Innentasche seines Jacketts holte er den Brief des Gefangenen heraus, den er gleich treffen sollte. Konnert faltete den Bogen auseinander und las zum ungezählten Mal: »Jetzt ist immer.« Die drei Wörter packten ihn. Er las die davon abgesetzte Nachricht: Besuch genehmigt. Montag, 16:30 Uhr. Unterschrift Sascha Knieling.
Vor vier Jahren hatte er ihn verhaftet. Verschiedene Vorstrafen, eine Einbruchserie, wiederholte Hehlerei, dann ein missglückter Banküberfall und, im Zusammenhang damit, eine Geiselnahme brachten ihn hinter Gitter. Der alleinstehende Arbeitslose hatte Konnert leidgetan. Mehr als andere Straffällige. Da hatte er ihm spontan versprochen: »Wann immer Sie mich brauchen, ich bin für Sie da.« Und jetzt war immer. »Dann muss ich mein Wort wohl halten. Das gehört sich so«, hatte er gemurmelt, als das karierte Briefpapier am Samstag bei ihm auf dem Küchentisch lag.
Sorgfältig steckte er den Brief zurück in den Umschlag.
Ich muss ins Gefängnis. Obwohl er Polizist war und oft mit Gefangenen zu tun hatte, ließ ihn der Gedanke zögern. Heftig saugte er an seiner Pfeife und blies den Qualm von sich. Nur für einen Besuch, sagte er sich und versuchte, seine Nerven zu beruhigen.
Nur für einen Besuch.
Mit einem Ruck setzte er sich in Bewegung und überquerte die Cloppenburger Straße. Er musterte die meist rückwärts eingeparkten Autos der Vollzugsbeamten auf dem Parkplatz. Im Licht der Laternen entdeckte er drei ältere Modelle und einen silbernen Audi A8 L auf dem grauen Verbundsteinpflaster. Angehörige und Anwaltsbesuch, vermutete er. Die Rasenstreifen vor der Parkplatzumzäunung waren frei von Laub.
Konnert erreichte den Besuchereingang und blieb noch einen Augenblick vor der Tür mit Elementen aus schusssicherem Glas stehen. Sie hatte keine Klinke, nur einen runden Knauf. Raus kommt hier niemand. Aber auch nicht so einfach rein. Wie oft hatte er das vor dieser Tür schon gedacht?
Geduldig wartete er, bis das Schnarren des elektrischen Türöffners zu hören war. Er zog die schwere Tür auf und trat in einen taghell beleuchteten Windfang. Hinter ihm schloss sich die Pforte. Er war im Gefängnis. Er wandte sich nach links. Hinter einer Panzerglasscheibe saß eine blonde Frau in der Dienstkleidung der Justizvollzugsbeamten. Sie lächelte ihn an.
»Legen Sie bitte Ihren Personalausweis in die Schiebemulde.« Konnert kannte das Prozedere und befolgte die Anweisung. Routinemäßig verglich die Beamtin sein Gesicht mit dem Passbild.
Er erwartete eine Bemerkung darüber, dass er seit dem Ausstellungsdatum ein paar Pfund zugelegt hatte. Seine Kollegen würden sich einen Kommentar niemals verkneifen. Nein, sie blieb ernsthaft und suchte seinen Namen auf der Besucherliste.
»Ihre Dienstpistole, Herr Kommissar?«
»Die liegt im Waffenschrank der Polizeiinspektion. Ich bin kein guter Schütze, wissen Sie. Und bevor ich ...«
Ohne weitere Erklärung bekam er einen Besucherausweis an einem roten Band zugeschoben, den er sich um den Hals hängte.
»Sie sind heute privat hier. Sie müssen sich durchsuchen lassen. Tut mir leid. So sind die Vorschriften. Ihr Handy müssen Sie diesmal auch einschließen.« Die Tür zum Warteraum schnarrte genauso wie die Außentür. Konnert drückte sie auf, trat hindurch und deponierte seinen Mantel in einem Schrankfach. Dann musste er sich doch noch gedulden und in dem abgeschlossenen Raum auf- und abgehen.
Eine Männerstimme forderte ihn über einen Lautsprecher auf, in den Durchsuchungsraum zu kommen.
»Bitte leeren Sie Ihre Taschen und legen auch Ihr Jackett, Ihre Schuhe und den Gürtel in den Plastikkorb auf dem Fließband.«
Konnert staunte über das, was aus den Tiefen seiner rechten Hosentasche zum Vorschein kam. Als ein glatter, mehrfarbiger Halbedelstein, eine Unterlegscheibe, ein Nagel und ein Markstück auf seiner Handfläche lagen, schmunzelte er. Wenn er auf der Straße Krimskrams fand, musste er ihn einstecken.
Der Korb verschwand im Röntgengerät.
»Kommen Sie zu mir!«, befahl der Beamte.
Konnert passierte die Sicherheitsschleuse, die ihn an Kontrollen auf Flughäfen erinnerte. Ein durchdringender Alarm piepte.
»Tragen Sie eine Halskette?«
Kopfschütteln war die Antwort.
»Wenn Ihre Taschen leer sind, sehen Sie bitte im Hosenaufschlag nach.«
Er krempelte den Stoff um. Eine Büroklammer fiel zu Boden.
»Auch die dürfen Sie nicht mit hereinbringen. Sicherheitsrisiko. Sie verstehen?« Der Beamte verzog keine Miene.
Nachdem Konnert den Gürtel wieder durch die Schlaufen gezogen und Schuhe an den Füßen hatte, telefonierte der Bedienstete. Kurz darauf öffnete sich mit Schlüsselklappern eine Tür, und ein weiterer Mitarbeiter erschien.
»Guten Tag, Herr Kommissar. Diesmal durch den Besuchereingang?« Er trat zur Seite. »Bitte.« Sie passierten die nächste Stahltür und standen zwischen der Außenschleuse und den Zellenblocks im Freien. Halogenstrahler beleuchteten den gepflasterten Weg und die Fronten mit den gitterlosen Fenstern.
»Nach Ihnen«, sagte der Beamte und deutete mit der Hand an, dass Konnert vorgehen sollte.
Konnert nahm an einem der quadratischen Buchentische im Besucherraum Platz. Scheiben aus bruchsicherem Glas in einem Holzrahmen ersetzten einen Teil der Tischplatte. Über ihr schimmerte das Fischauge einer Überwachungskamera. Er sah sich um. Die Wände waren hell gestrichen worden. An ihnen hingen von Gefangenen gemalte Bilder. Yuccapalmen vor den Fenstern gaben dem Raum etwas vom Charakter eines Wohnzimmers. Für Kinder hatte man eine Spielecke abgetrennt. Erhöht hinter einem Tresen saß ein Vollzugsbeamter. Zwei Bildschirme waren zu erkennen. An zwei anderen Tischen unterhielten sich wartende Familienangehörige. Konnert meinte, eine Atmosphäre von Angst und enttäuschten Hoffnungen wahrzunehmen. Oder spürte er nur seine eigenen Gefühle? Er wartete und legte die Hände übereinander. In Gedanken formulierte er ein Gebet für das Gespräch mit Sascha Knieling.
Schlüsselklappern unterbrach ihn. Die Gefangenen wurden in den Raum geführt. Als Letzter trat ein hagerer Mann ein. Die dunkelbraune Cordhose schlabberte um seine langen Beine. Über dem karierten Hemd trug er eine beige Strickjacke mit Lederflicken an den Ellenbogen. Das kräftige Kinn war sauber rasiert, die Haare exakt geschnitten. Kratzstellen auf der geröteten Haut an der Stirn und auf der linken Wange fielen Konnert sofort auf. Rosazea heißt die Hauterkrankung, wusste er und erinnerte sich, dass Stress ein Auslöser der schuppigen Entzündungen sein kann. Die Brille passte mit ihren übergroßen Gläsern nicht zum schmalen Gesicht.
Konnert hatte Knieling anders in Erinnerung. Als er ihn damals in einer Waldarbeiterhütte aufgespürt hatte, waren drei Tage nach dem Überfall vergangen. Konnert hatte sich gegen die Geisel austauschen lassen und, wie schon einmal, den Einsatz des SEK zurückgewiesen. Er war zweieinhalb Tage Gefangener des Bankräubers gewesen, bevor der aufgegeben hatte. Insgesamt waren das fast sechs Tage ohne fließendes Wasser für den Entführer gewesen. Auch zum Prozess vor dem Landgericht war er mit zerzaustem Bart und in billigen Klamotten erschienen.
Das Gefängnis schien ihm gutzutun. Zur Begrüßung stand Konnert auf und reichte eine Hand über den Tisch.
Sie setzten sich. Beim Geräusch der hinter Konnert ins Schloss fallenden Tür und dem Klappern der Schlüssel zuckte er leicht.
»Sie sind gekommen. Danke.« Knielings Worte kamen schleppend über seine dünnen Lippen. Jedes Wort formulierte er zögernd und sprach es überdeutlich aus. Zwischen den Satzteilen entstanden Pausen. Es klang so, als müsste er jeweils entscheiden, ob er weitersprechen wollte. »Ich war mir nicht sicher, ob Sie damals wirklich meinten, was Sie mir versprochen haben.«
»Ihnen scheint es gut zu gehen.«
»Bis vor einem halben Jahr ging es mir sogar sehr gut. Aber ...« Knieling brach ab und lehnte sich über den Tisch. »Ich muss hier raus. Helfen Sie mir, hier rauszukommen. Bitte!«
Konnert suchte Blickkontakt mit dem Mann, der wieder aufrecht auf seinem Stuhl saß. »Ich kann Ihnen unmöglich zur Flucht verhelfen. Das wissen Sie doch.«
»Keine Flucht. Es geht um eine sofortige Verlegung in ein anderes Gefängnis.«
Konnert runzelte die Stirn.
»Und warum sprechen Sie darüber nicht mit Ihrem Abteilungsleiter?«
Knieling kratzte eine Pustel über der linken Augenbraue auf.
»Von außerhalb der Anstalt habe ich so gut wie keinen Einfluss auf die Abläufe hier drinnen«, sagte Konnert.
Einige Sekunden beobachtete Knieling den Beamten hinter den Monitoren. Zum zweiten Mal beugte er sich vor und winkte Konnert heran. »Dann müsste ich begründen, warum ich verlegt werden will.«
»Es hört uns keiner zu, Herr Knieling. Das Gespräch ist absolut vertraulich.«
»Ich werde bedroht. Man will mich fertigmachen und umbringen. Und wenn ich das einem Beamten sage, verlegen sie mich auf eine Gemeinschaftszelle. Zu Ihrer Sicherheit argumentieren sie dann. Da drehe ich durch. Mit einem furzenden oder ständig wichsenden oder rauchenden Kerl in einer Zelle werde ich verrückt.«
Er ließ sich mit leerem Blick an die Stuhllehne zurückfallen.
Konnert blieb stumm und wartete, wie so oft, wenn er den Eindruck hatte, dass sein Gegenüber noch Informationen zurückhielt.
»Das macht auch mein Herz nicht mehr mit. Wenn ich hierbleiben muss, bin ich so oder so tot. Ich muss in ein anderes Gefängnis.«
Konnert fasste die Nasenwurzel zwischen Daumen und Zeigefinger und dachte nach. »Wenn ich mit der Anstaltsleitung spreche, muss ich ebenfalls einen Grund für Ihre Verlegung nennen. Was soll ich Direktor Koop sagen?«
»Das weiß ich nicht. Ich muss weg von hier. Sie sind die letzte Hoffnung, die ich habe. Finden Sie keinen Ausweg, verlasse ich die Anstalt in einem Zinksarg.«
Erschrocken stand Konnert auf und tigerte zwischen der Spielecke und dem Tisch hin und her. Der Vollzugsbeamte behielt ihn im Auge. Nur eine Ermittlerfrage kam ihm in den Sinn. Er setzte sich wieder. »Wie haben Sie die Drohung erhalten?«
»Irgendwer hat mir einen Zettel in die Jackentasche gesteckt.«
»Wann war das?«
»Am Dienstag.«
»Was genau stand darauf?«
»Noch eine Woche.« Knieling senkte den Kopf.
»Nur diese Worte?«
»Noch eine Woche. Dann wirst du dich bücken. Danach machen wir dich weg.«
Konnert kannte sich mit der Knastsprache aus. Leise, wie aus weiter Ferne, klang das Gemurmel von anderen Besuchern herüber. Er stand auf und ging zum Getränkeautomaten an der gegenüberliegenden Wand und kam mit zwei Kaffeebechern zurück.
Knieling gab ein erbärmliches Bild ab.
»Eher bringe ich mich um.« Die Pausen zwischen den Satzteilen wurden länger. »Ich mache das alles nicht noch einmal durch ... Mir bleibt kein anderer Ausweg.«
»Bewahren Sie den Zettel irgendwo auf?«
»Wo denken Sie hin? Den habe ich nicht mal durch die Toilette gespült. Geschluckt habe ich den.«
»Eine Woche«, überlegte Konnert laut und stützte beide Hände auf der Tischplatte ab. »Heute ist schon Montag.«
»Ich werde mich umbringen. Wenn ich hierbleiben muss, dann ist Schluss. So oder so.«
»Wer ist Ihr Anwalt?«
»Den können Sie vergessen. War nur ein Pflichtverteidiger, der nach der Gerichtsverhandlung kein Wort mehr mit mir gesprochen hat.«
»Sagen Sie mir bitte trotzdem den Namen.«
»Enno Keil aus Wardenburg.«
Erneut verstrich eine Minute, bevor Knieling sich aufrichtete und flüsterte: »Die Zeit vergeht ruck, zuck. Bis der Antrag für Ihren Besuch genehmigt war, vergingen schon drei Tage. Das ging sogar schneller als üblich. Drei von sieben Tagen.«
Und dann musste der Brief von der Post befördert werden, machte sich Konnert klar. Also konnte erst für heute der Besuchstermin anberaumt werden. Die Bediensteten wussten ja nicht, was für Knieling auf dem Spiel stand.
»Tag und Nacht war nur ein Gedanke in meinem Kopf. Welche Möglichkeiten bleiben mir?«, fing der Gefangene noch mal an. »Ich dachte zum Beispiel daran, zu randalieren. Dann komme ich in die Beruhigungszelle. Aber nur so lange, bis ich mich beruhigt habe. Und dann? Wie viele Stunden muss ich dann toben, um mich zu retten? Außerdem nimmt mir kein Bediensteter Aggression ab.«
»Warum nicht?«
»Ich verhalte mich hier von Anfang an genau nach Vorschrift. Wir haben doch darüber gesprochen. Ich soll jedem Streit aus dem Weg gehen. Daran halte ich mich. Ich bin sogar ins PC-Schulungsprogramm aufgenommen worden. In knapp zwei Jahren kann ich bei guter Führung vorzeitig entlassen werden. Danach will ich mich für den Rest meines Lebens sozial engagieren. Vielleicht kann ich etwas wiedergutmachen von dem, was ich angerichtet habe. Das kann ich alles vergessen, wenn ich auffällig werde.«
Sascha Knieling sah mit stumpfem Blick zu Konnert auf.
»Könnten Sie sich krankmelden? Wären Sie auf der Krankenstation in Sicherheit?«
»Vielleicht. Für ein paar Tage. Und danach?«
»Wir hätten Zeit gewonnen.« Konnert registrierte, dass er wir gesagt hatte. »Ich werde mit Ihrem Anwalt sprechen. Eventuell hat er eine Lösung. Mehr fällt mir nicht ein. Es tut mir leid.«
Nachdem er an der Außenpforte seine Papiere zurückerhalten hatte, sagte die Beamtin: »Sie müssen Ihren Ausweis verlängern lassen. Er ist schon im September ungültig geworden. Wenn ich Sie nicht von früheren Einsätzen kennen würde, wären Sie hier nicht hereingekommen.«
»Vielen Dank.«
Die Ausgangstür ließ sich aufstoßen. Konnert trat hindurch und wandte sich noch einmal um, bevor er die Cloppenburger Straße überquerte. Er war zurück in der Freiheit, konnte gehen, wohin er wollte, jederzeit mit seiner Familie oder Freunden sprechen oder ein Glas Wein trinken, wann immer ihm danach war. Für einen Teil der Männer hinter den Mauern war schon seit 15:30 Uhr Stationseinschluss in ihren Haftraum. Erst morgen um 6:30 Uhr würde die Zelle wieder geöffnet werden. Fünfzehn Stunden allein hinter verschlossenen Türen.
Ein Schauder durchlief Konnerts Körper.
***
Als Sascha Knieling den Flur zu seiner Zelle entlangging, stieß sich ein junger Kerl von der Wand ab, um neben ihm herzugehen. Er raunte: »Du triffst dich also mit einem Bullen und quatschst mit dem. Hatte mir immer schon gedacht, dass du so ein Arschloch bist und mit den Wachteln zusammenarbeitest.«
»Lass mich in Ruhe.«
»Pass bloß auf, dass du nicht mal stolperst und mit dem Kopf gegen die Wand knallst.«
Schweigend schloss Knieling seine Zelle auf, trat ein und zog die Stahltür hinter sich zu.
***
Im dritten Stock der Polizeiinspektion am Friedhofsweg verließ Konnert den Fahrstuhl und betrat das Großraumbüro seiner Abteilung FK1, Straftaten gegen Leben und Gesundheit, Sexualstraftaten und Rotlichtkriminalität. Viele Schreibtische waren schon aufgeräumt. Am Glasausschnitt der Tür zu seinem separaten Büro klebten drei Post-it-Zettel und eine Postkarte. Er pflückte sie ab und las den ersten Zettel, bevor er die Tür öffnete. Habe Bereitschaft. Bin zu Hause zu erreichen. Venske.
So ist er, dachte Konnert und betrat sein Büro. Bernd Venske, Kriminaloberkommissar und stellvertretender Leiter des Kommissariats. Konnert schätzte an ihm seinen Fleiß und seine Gradlinigkeit. Er gibt sich, wie er ist, und sagt, was er denkt. Das macht ihn bisweilen zu einem schwierigen Typen mit gelegentlich vorschnellen Urteilen. Aber alles in allem ein guter Polizist. Nicht umsonst schon Oberkommissar, dachte Konnert anerkennend. Bringt aber in diesem Winter nicht die gewohnte Leistung. Fühlt er sich nicht wohl?
Er schüttelte seinen Mantel einseitig von der Schulter. KOR hat angerufen und bittet um Rückruf, war die nächste Mitteilung. Er wechselte die Notizen in die andere Hand und zog den Mantel ganz aus. Er wählte die Nummer von Kriminaloberrat Werner Wehmeyer, dem Leiter der Dienststelle Zentraler Kriminaldienst.
»Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dich heute noch meldest. Komm morgen mal zu mir rauf. Es gibt da ein Problem, das würde ich gern mit dir unter vier Augen besprechen.«
»Jetzt ginge es auch.«
»Lassen wir es bei morgen, Adi. Schönen Feierabend.«
Konnert legte auf.
Die dritte Nachricht war eine Terminänderung. Deine Zeugenaussage im Zuhälterprozess ist nicht Mittwoch, sondern erst nach Weihnachten. Neuer Verhandlungstag wird schriftlich mitgeteilt. Stephanie.
Stephanie Rosenberg, Kriminalhauptkommissarin, gehörte seit anderthalb Jahren zu den Ermittlern FK1. Sie legte Wert auf ihre Kleidung, trug mal diese, mal jene modische Brille und wickelte, wenn sie nachdachte, Strähnen ihrer blonden Haare um den linken Zeigefinger.
Konnert setzte sich und überflog auch noch den Urlaubsgruß von Kriminalkommissar Kilian Kirchner aus Phuket. Weg aus dem regnerischen Dezemberwetter, hin ins warme Thailand. Konnert reizten solche Reisen nicht. Er fand es aber schön, dass Kilian an seine Kollegen im kalten Norden gedacht hatte.
Aus einer Schublade zog er das Telefonbuch und fand den Eintrag des Rechtsanwalts Keil. Um diese Zeit erreichte er aber nur den Anrufbeantworter. Konnert nannte sein Anliegen, gab Handy- und Festnetznummer durch und bat darum, umgehend zurückgerufen zu werden.
***
Es klopfte an der Haftraumtür. »Sascha, ich bin es.«
Knieling öffnete und ließ Michael Otten eintreten. Als die Tür zugefallen war, umarmten sie sich und setzten sich nebeneinander auf das Bett. Unsicher legte Knieling die rechte Hand auf Ottens Unterarm.
»Sascha, ich habe Angst.«
»Angst musst du doch nicht haben. Mir wollen sie ans Leder, nicht dir. Jeder kommt dafür infrage. Du bist der Einzige, dem ich hier vertraue.« Er tätschelte Ottens Hand und ließ seine dann auf ihr liegen. Er lehnte seine Schulter bei Otten an und betrachtete lange die übereinandergelegten Hände.
»Was hat er gesagt? Kann er dir helfen?«
»Ich glaube nicht. Sein Vorschlag war, mich krankzumelden. Das würde Zeit bringen.«
»Du brauchst keine Zeit. Du brauchst Schutz. Sicher bist du selbst auf der Krankenstation nicht.«
Otten blickte hinüber zum Bord über dem Tisch, wo Knieling Seminarhefte und einige Romane aufbewahrte. Er hätte gern einen Kaffee getrunken. Früher hatte Knieling immer einen großen Vorrat. Doch jetzt war der Platz neben der Kaffeemaschine leer. Auch das Tabakpäckchen sah dünn aus.
»Am sichersten bist du in deiner Zelle.« Otten löste sich von Knieling, stand auf und stellte sich ans Fenster. Von draußen drang kein Ton herein. Kein Hundegebell, kein Straßenlärm, keine Geräusche der Stadt. Unwirkliche Stille, die dem Handwerker Michael Otten oft aufs Gemüt schlug.
»Der Vorschlag vom Kommissar ist aber trotzdem nicht ganz schlecht.«
»Wie meinst du das?«
»Du meldest dich krank. Aber nicht so, dass du auf die Krankenstation kommst, sondern nur hier im Bett liegen musst. Du lässt keinen rein. Ich versorge dich.«
Beide überlegten, welche leichte Beschwerde dazu führen würde, dass Knieling auf der Station bleiben könnte. Dann schlenderten sie hinüber zur Stationsküche, um sich ihr Abendbrot zuzubereiten.
»Das Pärchen Einsam und Verlegen«, kündigte sie einer an, und ein anderer rief: »Heißen sie nicht Klug und Scheißer?« Sie ernteten brüllendes Gelächter.
***
Auf der Fahrt nach Hause saß Konnert im Bus und beobachtete die Fahrgäste. Er stellte sich vor, was wohl in ihnen vorging. Drei Sitze hinter dem Fahrer hockte ein Junge, der einen Geigenkasten zwischen die Beine geklemmt hatte. Noch ein Jahr oder zwei, dachte Konnert, dann quält er seine Eltern, bis er das Instrument auf den Schrank legen darf. Oder er wird seine Geige lieben und vorsichtig auf dem Schoß festhalten. Eine Reihe weiter presste eine Frau eine schwarze Aktenmappe an ihre Brust, als würde sie ein Vermögen darin beschützen. Vielleicht trägt sie ihren neuen Arbeitsvertrag nach Hause, dachte Konnert.
An der Haltestelle Zanderweg stieg er aus. Ein paar Schritte wollte er gehen und den Hebel umlegen, wie Zahra es ihm einmal ans Herz gelegt hatte. Er fand, dass man das leichter sagen als in die Tat umsetzen konnte. Besonders schwer wurde es, wenn das Handy klingelte und Venske anrief.
»Es gibt hier eine Vergewaltigungsanzeige. Man hat mich angerufen. Ist es in Ordnung, dass ich Stephanie kommen lasse und sie die erste Befragung macht? Unsere momentan übersensible Babsi soll ich damit doch bestimmt nicht behelligen.«
Konnert missfiel der sarkastische Unterton seines Stellvertreters. Barbara Deepe, von allen Babsi genannt, war Kriminaloberkommissarin. In der Vergangenheit war sie sportlich durchtrainiert, fleißig und dabei eher unauffällig gewesen. Dann hatte es Probleme in ihrer Beziehung gegeben. Jetzt war sie häufig unkonzentriert und reagierte dünnhäutig. Nur Konnert war von ihr ins Vertrauen gezogen worden. Darum verkniff er sich einen Kommentar und sagte: »Ist richtig so. Wieder häusliche Gewalt?«
»Nein, diesmal hat es eine Studentin auf dem Rückweg von einer Weihnachtsparty erwischt. In Bloherfelde, verschleppt, betäubt und ohne Kleidung zurückgelassen. Eine Joggerin hat sie total unterkühlt gefunden und anstatt sie in ein Krankenhaus zu bringen, hat sie sie mit ihrem Wagen nach Hause verfrachtet. Verfluchte Scheiße.«
»War sie beim Arzt?«
»Ja, aber erst heute am späten Nachmittag. Sie ist mit der Sprechstundenhilfe der Ärztin hierhergekommen. Eine Mitarbeiterin der Kriminaltechnik ist dann mit ihr ins Evangelische Krankenhaus gefahren.«
»Stephanie soll sich Zeit lassen.«
»Das brauche ich ihr nicht zu sagen.«
Konnert schloss die Haustür auf. Ihn empfing aus der oberen Etage das fröhliche Lachen junger Leute. Den beiden scheint es richtig gut zu gehen, stellte er fest. Im Mai war seine Tochter Ruth bei ihm eingezogen. Er hatte ihre Schulden bezahlt, oben eine Küche einbauen lassen und das eine oder andere Möbelstück spendiert. Sein Wunschauto musste dann eben noch auf ihn warten.
Schwiegersohn Sven hatte seinen Entschluss in die Tat umgesetzt, keinen Alkohol mehr zu trinken. Erst nach der durchgestandenen Entziehungskur hatte er seine Frau angerufen und berichtet, dass er zusätzlich ein Antiaggressionstraining erfolgreich absolviert hatte. Er würde sie nie mehr schlagen. Einige Wochen später war er wieder bei Ruth eingezogen. So langsam gewöhnte sich Konnert daran, nicht mehr allein im Haus zu wohnen.
Kurz vor acht Uhr wechselte er ins Wohnzimmer, um die Tagesschau anzusehen. Die Separatisten in der Ukraine lehnten Friedensgespräche ab. Das Stichwort Ukraine löste bei ihm noch immer Erinnerungen an einen Fall mit vergewaltigten Zwangsprostituierten aus. Er hätte gern gewusst, wie es der geflohenen Frau jetzt ging und ob sie in ihrer Heimat angekommen war. Als der Sportreporter auf die 5:2-Demütigung für Werder Bremen durch Eintracht Frankfurt zurückkam, schaltete Konnert den Apparat ab.
Seine Gedanken wanderten zurück zu Sascha Knieling. Ihn wird das alles wenig interessieren, was heute Abend im Fernsehen läuft. Mich eigentlich auch nicht. Er suchte eine Pfeife mit großem Kopf aus, stopfte sie sorgfältig und ging zum Rauchen auf die Terrasse.
An einem kühlen Septemberabend hatte er draußen gesessen und gefröstelt. Am nächsten Tag war er in einen Baumarkt gefahren, um einen Heizstrahler zu kaufen. Den hatte er an einem Samstagnachmittag über seinem Sessel an die Wand montiert. Jetzt konnte er auch im Winter hier sitzen, in den dunklen Garten schauen und seinen Gedanken nachhängen.