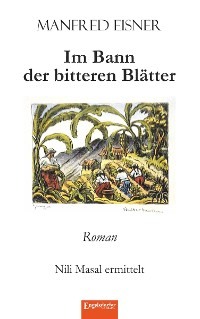Kitabı oku: «Im Bann der bitteren Blätter»
Manfred Eisner
IM BANN DER BITTEREN BLÄTTER
Roman
Nili Masal ermittelt
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2015
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Abbildung „Yungas“ auf dem Titelblatt ist Bestandteil einer Lithographie-Kollektion, die ein geschätzter Familienfreund des Autors, der Münchner Maler und Graphiker Walter Sanden († 1954), während des gemeinsamen Exils in Bolivien unter dem Namen „Bolivia Pintoresca“ – „Malerisches Bolivien“ – herausgab. Es zeigt indigene Erntefrauen beim Einsammeln von Cocablättern in jener subtropischen Region, etwa 80 Straßenkilometer von La Paz entfernt.
Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
Alle Gründe, die man erfindet, um die Sucht zu entschuldigen,
können sich literarisch sehr gut machen. Konkret ist es eine
Schweinerei. Denn man ruiniert sein Leben damit.
Friedrich Glauser, einer der ersten Kriminalautoren
* 1896, Wien
† 1938, Nervi bei Genua (an den Folgen der eigenen Sucht)
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat
Vorwort
1. Böses Schicksal
2. Nili
3. Wochenende
4. Vernehmung
5. Strukturreform
6. Aus Nilis Tagebuch
7. Reiseplanung
8. Das Abenteuer beginnt
9. Containerklau
10. Rotterdam
11. Operation „Torpedo“
12. Erste Bilanz
13. Verschnaufpause
14. Die Kanaren
15. Bogotá, Colombia
16. Im Tal des Schneekönigs
17. Paco-Pepe
18. Im peruanischen Wald der Akronyme
19. Heilende Cocablätter – tausendjähriger Fluch
20. Los Yungas
21. Verhängnisvoller Chapare
22. Letzte Zeilen aus Nilis Tagebuch
Kulinarisches
Danksagung
Der Autor
Fußnoten
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
dieser ist ein vom Autor frei erdachter Roman und kein Tatsachenbericht. Allerdings basieren so manche der darin vorkommenden Geschehnisse und Szenarien auf realen Ereignissen, die vorwiegend während dieses Jahrzehnts entweder tatsächlich so oder zumindest sehr ähnlich geschahen. Dennoch mussten sie gelegentlich dem Ablauf unserer Geschichte entsprechend angepasst werden. Vor allem ist es die leidliche und immer wieder neu auflebende Diskussion über die Legalisierung von sogenannten „weichen“ Drogen, die den Autor veranlasste, dieses Leitmotiv für seinen ersten Roman der „Nili Masal“-Serie aufzugreifen. Der Gebrauch von Drogen aller Art ist so alt wie die Menschheit. Schon seit der Steinzeit kannte man die Wirkung mancher Substanzen aus der Natur, die vorwiegend zur Linderung von Leiden und Schmerzen Verwendung fanden. Jedoch haben diese, bei vernünftiger Dosierung und zielgerechtem Einsatz, überhaupt nichts mit dem willkürlichen und später zwangsweisen Überkonsum jener sinnesbetäubenden Gifte zu tun, von denen hier die Rede ist. Eigene Erfahrungen während der überwiegenden Reisen auf den fünf Kontinenten unseres Planeten haben beim Autor die Gewissheit geschaffen, dass es wahnwitzig und unverantwortlich wäre, die bestehenden Beschränkungen aufzuheben. Der Gebrauch von weichen Drogen bedeutet für labile Geschöpfe doch nur den Einstieg in weitaus Schlimmeres. Man argumentiert, dieser verursache eine ungerechte „Kriminalisierung“ jener, die ihnen bedauerlicherweise verfallen sind.
Fälschlicherweise, so glaubt man, werde mit der Legalisierung des Drogenhandels den finsteren Mächten, die dahinterstehen, die Luft aus den Segeln genommen. Weit gefehlt, denn man unterschätzt die enorme kriminelle Energie und die unendliche Geldgier jener, die mit ihrem makabren Tun und immer raffinierteren Vertriebsmethoden für den Verfall der geistigen und leiblichen Gesundheit von Millionen Menschen auf dieser Welt die Verantwortung tragen.
Sämtliche in diesem Roman vorkommende Namen der – „guten“ oder auch „bösen“ – Akteure sind frei erfunden. Etwaige Übereinstimmungen mit real existierenden Personen oder deren Position und Beruf sind nicht beabsichtigt und daher rein zufällig.
Manfred Eisner, im Sommer 2015
1. Böses Schicksal
„Ralph!“
Der angsterfüllte Ruf der Frau Ende dreißig hallt von den Wänden des menschenleeren Großraumbüros wider, was diesem Nachdruck verleiht.
Ungeduldig und von einer schrecklichen Vorahnung gepeinigt, rüttelt Melanie immer heftiger an der Klinke der verschlossenen Tür zur Herrentoilette, hinter der sie ihren Begleiter weiß, während sie wiederholt seinen Namen ruft. „Mensch, Ralph, Junge, mach doch keinen Unsinn und komm endlich da raus! Es ist höchste Zeit, nach Hause zu gehen!“
Verzweifelt trommelt Melanie mit beiden Fäusten an die Tür, während Tränen der Hilflosigkeit aus ihren blauen Augen quellen, an ihren Wangen herunterlaufen und auf dem Make-up bizarre Flussläufe hinterlassen. Das zunehmend wütende Gezerre an der Tür, die ihren Bemühungen scheinbar ungerührt zu trotzen scheint, hat ihr rotblondes, gewelltes Haar arg durcheinandergebracht.
„Ralph, bitte, bitte, um alles, was dir lieb ist, bitte, bitte, tu mir das nicht an und komm raus!“
Melanies recht hübsches und apartes Gesicht ist von der Anstrengung und vor allem von der Angst gezeichnet. Ihr Herz pocht wild in ihrer Brust und ihr Busen hebt und senkt sich rasch, während sie aufgeregt mit ihrem Atem ringt.
Es ist ein schöner und lauer Samstagnachmittag. Auch in diesem Jahr hat sich wieder eine frühlingsähnliche Luft an dem vom Kalender vorgezeichneten Rhythmus vorbeigewagt und beschert gerade an diesem Wochenende den aufgrund der langen, ungemütlichen Wintermonate besonders sonnenhungrig gewordenen Kielern ein herrliches Spazierwetter. Eigentlich würde Melanie Westphal an einem so schönen Tag viel lieber in dem Golf Cabrio nach Laboe fahren, um dort mit ihrem Joker, einem quirligen Jack Russel, spazieren zu gehen. Da ihre Eltern aber für zwei Wochen auf den Bahamas Urlaub machen, hat sie ihnen versprochen, an beiden Wochenenden für ein paar Stunden in deren Steuerberaterbüro zu gehen, um dort nach dem Rechten zu sehen und die eilige Korrespondenz zu erledigen.
Ihr um viele Jahre jüngerer Halbbruder aus der zweiten Ehe ihres Vaters, Ralph, hat sie an diesem Tage begleitet. Sie hat ihn darum gebeten, weil sie sich bei dem Gedanken, sich wieder einmal allein ein paar Stunden lang in diesen menschenleeren Büroräumen aufhalten zu müssen, nicht gerade wohlgefühlt hatte. Am vorangegangenen Wochenende war sie schon einmal hier gewesen und es war ihr unheimlich vorgekommen.
Außerdem ist es ihr wohler, wenn sie Ralph bei sich weiß, denn so kann sie besser auf ihn aufpassen, als wenn er allein zu Hause geblieben wäre. Es schien ihr sicherer, ihren labilen Bruder, der erst im Herbst vorigen Jahres von einer monatelangen und qualvollen Drogen-Entziehungskur wieder heimgekommen war, nicht allzu lange aus den Augen zu lassen. Allem Anschein nach ist Ralph von seiner Sucht endgültig geheilt – also clean, wie man heute zu sagen pflegt. Er hat kurz nach seinem Entzug sein für fast zwei Jahre unterbrochenes Architekturstudium, diesmal jedoch in Lübeck, also so nahe wie möglich an Kiel, wieder aufgenommen.
Ironie des Schicksals – hatten es doch die Eltern mit ihm besonders gut gemeint! Nachdem ans Licht gekommen war, dass Ralph schon während seiner Gymnasialzeit mit der Neigung, Haschisch zu rauchen, seine arge Mühe gehabt hatte, beschlossen sie ihn nach seinem doch noch mit Ach und Krach geschafften Abitur zum Architekturstudium in eine kleinere Stadt zu schicken, wo die Drogengefahr augenscheinlich geringer war. Und gerade dort, in Konstanz am Bodensee, war es dann passiert. Von dem sogenannten „weichen“ Gift war für Ralph, wie für viele andere, der Schritt zum harten Kokain nur ein sehr kleiner gewesen, als ihm die Versuchung dazu eine Gelegenheit bot.
Ralph war von frühem Kindesalter an schon immer ein in sich gekehrter, stiller Junge gewesen. Mit den Jahren hatten sich seine musischen Neigungen – allen voran die für Poesie und Musik – in besonders ausgeprägter Manier ausgebildet, eine Entwicklung übrigens, für die bei dem bodenständigen, praktisch und kaufmännisch veranlagten Vater trotz langwieriger und ausführlich geführter Diskussionen keinerlei Verständnis aufgekommen war.
Ralph beherrschte das Spielen der spanischen Gitarre besonders gut. Bei einem Sommerurlaub im spanischen Torremolinos hatte ihm seine Mutter aufgrund seines nicht enden wollendes Bettelns ein schönes und teures Instrument gekauft. Schon bald fand der damals Zwölfjährige in einer dunklen Bodega einen bereitwilligen Lehrer, der ihm mit Freuden die ersten Grundgriffe beibrachte. Lange Übungsstunden im Hause eines gleichgesinnten Freundes – wobei die beiden sich das meiste gegenseitig beibrachten – und später auch das gelegentliche Musizieren in einer Schülerband ließen Ralphs Musikalität und Fingerfertigkeit zu einer gewissen Spielkunst heranreifen.
All dies geschah hinter dem Rücken des strengen Vaters. Überhaupt, bei Mutter und Schwester hatten seine künstlerischen Bestrebungen weit mehr positiven Widerhall, aber deren Ehrfurcht vor der väterlichen Abneigung gegen alles Musische ließ in ihnen die aufkommende Bewunderung für Ralphs Musizieren gegenüber dem Familienoberhaupt verhehlen. Nach dem Stimmbruch wandelte sich zudem Ralphs piepsiger Kindersopran in eine weiche, harmonische Tenorstimme, mit der er bekannte Lieder und eigene Chansontexte sang. Unter Freunden und Kommilitonen war seine Begabung durchaus gefragt und nicht selten verhalf ihm seine Musik zu einer ansehnlichen Aufbesserung des sonst nicht allzu üppigen Taschengeldes.
Allerdings, und dies scheint wiederum den Kreis des Verderbens um den jungen Mann zu schließen, waren es augenscheinlich gerade jene musische Umgebung und einige jener Menschen, für die er oft spielte und denen er vorsang, die ihn entsprechend beeinflussten. Hier fühlte er sich besonders wohl, da er voll akzeptiert wurde, jedoch war bei diesen Menschen die Schwäche für den Drogenkonsum bereits unterlegt. So war es eine unausweichliche Folge, dass deren Verlangen nach Drogen auch ihn wie eine schleichende und ansteckende Seuche befiel. Und so kam es, wie es kommen musste: Ralph verfiel den süßen Träumen und vernachlässigte allmählich das Studium. Immer seltener besuchte er die Vorlesungen, was dazu führte, dass er die geforderten Leistungsnachweise nicht erbringen konnte.
Mit tiefer Besorgnis nahm der Vater die erschütternde Nachricht entgegen, die ihm die um ihre Mietzahlungen arg vernachlässigte Wirtin über Ralphs traurigen Zustand zukommen ließ. Es muss dem rechtschaffenen und schwer betroffenen Heinz Westphal zugutegehalten werden, dass er dieser bösen und für ihn besonders peinlichen Situation voll gewachsen war: Er setzte sich sofort in den Wagen und fuhr nach Konstanz, um seinem hilflosen Sohn beizustehen. Er begegnete Ralph ohne ein Wort des Vorwurfes oder der Enttäuschung und umarmte ihn, während beide von Weinkrämpfen geschüttelt wurden.
„Du bist erkrankt, mein Sohn, aber das kriegen wir schon wieder hin!“
Eiligst hatte Vater Heinz Westphal noch vor seiner Abreise bei seinem Hausarzt fachlichen Rat eingeholt. Dieser hatte ihm ein Schweizer Sanatorium in der Nähe von Bern genannt, das eine besonders hohe Erfolgsquote bei der Entwöhnung solcher Fälle – und allerdings auch dementsprechend hoch angesetzte Arzthonorare – aufzuweisen hatte. Nachdem Ralphs Koffer gepackt und seine zahlreichen offenen Rechnungen beglichen worden waren, fuhren Vater und Sohn in das besagte Heilinstitut im Berner Oberland, wo sie nach der Anmeldung von Klinikleiter Dr. Reto Buri bereits erwartet wurden. Nach einer durchaus gründlichen, drei Tage andauernden physischen und psychischen Untersuchung des Patienten eröffnete Dr. Buri dem besorgten Vater eine für diesen ziemlich argen Fall etwas ambivalente Prognose: Die beabsichtigte und ungefähr zwei bis drei Monate dauernde Drogenentzugsbehandlung zur Entgiftung, Stabilisierung und sozialen Wiederintegration würde in Form von medizinischen, psychologischen und psychosozialen Behandlungen sowohl in Einzel- als auch in Gruppentherapie erfolgen und mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit zum gewünschten restlosen Entzugserfolg führen. Ein zehnprozentiges Rückfallrisiko, so die Aussage von Dr. Buri, könne er allerdings aufgrund der etwas labilen Psyche Ralphs nicht ausschließen. Diesem Restrisiko sei nur mit konsequenter Begleitung des Patienten durch Familie und wohlgesinnte Freunde zu begegnen; allerdings dürfe man ihm keine für ihn merkbaren Freiheitsbeschränkungen auferlegen, denn diese könnten in unerwünschte Trotzreaktionen entarten.
Nach dem Ende der Untersuchung und wider die zwiespältige ärztliche Voraussage berieten Vater und Sohn ausführlich darüber. Natürlich ließ dabei Heinz Westphal jegliche Erwähnung des möglichen Rückfallrisikos beflissen aus. „Mein lieber Junge, du siehst einer wochenlangen, ziemlich schwierigen und äußerst unangenehmen – und sehr wahrscheinlich sogar schmerzhaften – Behandlungszeit entgegen. Lass dir aber sagen, es ist diesmal wirklich deine letzte Chance, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ich weiß, es ist schwierig für dich, mir ein Versprechen zu geben, dass du nach dieser Behandlung nie wieder irgendwelche Drogen, in welcher Form auch immer, zu dir nehmen wirst. Trotzdem bitte ich dich jetzt, dich dazu zu äußern. Es ist nicht nur der enorme finanzielle Aufwand, der damit einhergeht, es ist vor allem die Verzweiflung deiner Mutter und Schwester, die so sehr darunter leiden. Möchtest du mir irgendetwas dazu sagen?“
Ralph blickte zunächst still auf den Fußboden. Dann, ohne den Kopf zu erheben, antwortete er: „Vater, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. In meinem Kopf schwirrt es, als ob tausend Wespen sich darin befänden. Ich habe einen Aal, der sich in meinem Bauch windet, und mir ist furchtbar schlecht, ich glaube, ich muss mich gleich wieder übergeben!“ Dann warf er abrupt die Bettdecke zur Seite, sprang aus dem Bett und rannte würgend ins Badezimmer, in das er sich sogleich einsperrte. Nach einigen Minuten kam er wieder zurück, noch blasser als zuvor und mit stark geröteten Augen. Obwohl er sich sofort wieder hinlegte und ganz zudeckte, schüttelt es ihn heftig. „Entschuldige bitte, Vater!“, stieß er reumütig hervor.
„Ist schon in Ordnung, Ralph. Soll ich den Arzt rufen?“
„Nein, lass nur. Das geht schon so, seit ich hier bin. Man gibt mir regelmäßig Tabletten zur Beruhigung, aber diese Anfälle kommen alle paar Stunden wieder. Sie machen einen ganz kaputt. Für dich muss es unfassbar sein, aber Attacken wie diese wurden zunehmend schlimmer und deswegen brauchte ich jedes Mal eine größere Menge Kokain, um mich einigermaßen zu fühlen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht liebe, dich, die Mami und Melanie. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich euch das angetan habe, aber ich kann doch nicht anders, es ist stärker als ich!“ Ralph brach in bitteren Tränen aus. Heinz Westphal beugte sich über das Bett, umarmte seinen Sohn, um ihn zu wärmen, und versuchte ihn mit sanften Worten zu beruhigen. Dann drückte er auf die Klingel, um Hilfe herbeizurufen. Nachdem die Krankenschwester Ralph eine Beruhigungsspritze verabreicht hatte, murmelte er, bevor er in einen Schlummer versank: „Ich verspreche es dir, Vater, ich gebe mir alle Mühe.“
Zweieinhalb Monate später holte Heinz Westphal seinen Sohn aus dem Sanatorium ab. Dr. Buri meinte, der junge Mann sei gründlich geheilt und wieder voll integrationsfähig, zumindest ließen alle seine abschließenden Tests ein solches Resultat erwarten. Als Vademekum gab er Ralph ermunternde Ratschläge mit auf dem Weg, vor allem aber die ernste Ermahnung, jeden Drogenkonsum und vor allem den Umgang mit der entsprechenden Szene unbedingt streng zu meiden. Ralph war offensichtlich ruhig und gelassen und verhielt sich während der ersten Wochen in Kiel absolut unauffällig. Es gelang Heinz Westphal dank seiner guten Beziehungen, ihn an der Fachhochschule Lübeck bereits für den nächsten Lehrgang unterzubringen. Gemeinsam besichtigten sie den Campus der Fachhochschule und waren von diesem Besuch sehr beeindruckt. Erleichtert vernahmen Ralphs Eltern danach seinen Wunsch, zunächst einmal zu Hause wohnen zu bleiben und tagtäglich nach Lübeck und zurück zu pendeln. So könne er auch die etwas mehr als eine Stunde dauernde Bahnfahrt zum Lernen nutzen.
Zum Semesterbeginn machte sich also Ralph an den Wochentagen sehr früh am Morgen auf den Weg zum Bahnhof. Er hatte bei seiner ersten Fahrt sein Fahrrad mit nach Lübeck gebracht, das ihn jetzt am dortigen Bahnhof erwartete und mit dem er anschließend die Weiterfahrt zu seinem Studienplatz unternahm. Von seinen früher geleisteten – oder besser gesagt eher nicht geleisteten – vier Semestern in Konstanz waren ihm lediglich die beiden ersten vollständig testiert worden, sodass er an der hiesigen Fachhochschule den Neueinstieg in das dritte Semester mit gutem Gewissen angehen konnte. Zunächst lief auch alles anstandslos. Ralph hörte aufmerksam alle ihm vorgeschriebenen Vorlesungen und machte die wichtigsten Kurznotizen auf seinem Laptop. Später, meistens schon während der Bahnfahrt nach Kiel, arbeitete er diese in entsprechende Kollegdateien ein. Die ersten Prüfungen bestand er mit guten, manche sogar mit sehr guten Noten. Von seinen Dozenten und Kommilitonen wurde er durchaus geschätzt, auch wenn er dieses Mal, entgegen seiner früheren Konstanzepisode, auf jegliche Auftritte mit Gitarre und Gesang von vornherein verzichtete. Er mied jeden Kontakt zu seinen früheren Mitschülern aus der Gymnasialzeit und widmete sich konsequent seinem Studium. Seine wenigen freien Stunden verbrachte er meist zu Hause im Kreise der Familie. Gemeinsam mit der Mutter und gelegentlich auch mit Schwester Melanie besuchte er Theater- und Konzertveranstaltungen, manches Mal wurden es auch gemeinsame Kinoabende.
Unauffällig beobachtete während der Bahnfahrten ein ungleiches Pärchen die Mitreisenden. Vor allem die zahlreichen Jugendlichen, Schüler und Studenten, die alltäglich auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck pendelten, waren das ausgemachte, jedoch verkappte Ziel ihrer besonderen Aufmerksamkeit. Habiba Massud war ein bildhübsches, noch nicht ganz achtzehnjähriges junges Mädchen, versteckte jedoch ihre besonders aparten orientalischen Züge unter einem derben Parka mit meist über den Kopf gestülpter Kapuze und kaschierte geschickt ihre betont weiblichen Rundungen mit einer für sie unvorteilhaften, massigen Kleidung. Sie verhielt sich sehr unauffällig und trug eine mittelgroße lederne Umhängetasche, sodass man durchaus meinen könnte, sie sei eine der pendelnden Studentinnen. Ihr Begleiter, ein Mittdreißiger, der stets bemüht war, so zu tun, als gehöre er nicht zu Habiba, war ein kahlköpfiger und magerer, in Lederjacke und Jeans gekleideter, äußerst unsympathisch wirkender Geselle namens Mathias Lohse, in seinen Kreisen als Matti bekannt. Mit wachem Auge und geübtem Blick taxierte er seine zukünftigen Opfer und sonderte jene heraus, von denen er sich am ehesten einen Erfolg versprach. Bedeutungsvolle Blicke wanderten dann zu seiner Komplizin, um Habiba zu signalisieren, wen er als ahnungsloses Opfer ausgewählt hatte. Sobald Habiba die Person ebenfalls anvisiert hatte und dann zu Matti zurückschaute, nickte dieser fast unmerklich und verschwand daraufhin verstohlen in dem nächsten Waggon. Während der folgenden Tage gingen die Jäger auf die Pirsch und beobachteten abwechselnd das Tagesverhalten der anvisierten, fast ausschließlich männlichen Personen. Derart erhielten sie Aufschluss über deren alltägliche Ziele und Gewohnheiten. Gelegentlich gesellte sich ein dunkelhäutiger Afrikaner zu den Spähern. Mustafa Mbili tarnte sich meist als Sonnenbrillen- und Billigschmuckverkäufer, womit er von seinem eigentlichen Vorhaben erfolgreich ablenkte.
Eines Tages bemerkte Ralph das attraktive Mädchen, das ihm anscheinend zufällig, aber zunehmend öfter hier und dort begegnete, manches Mal auf seinem Radweg zum und zurück vom Unterricht, gelegentlich am Lübecker Bahnhof oder auch in der Mensa. Irgendwann begannen sie sich im Vorbeigehen zu grüßen. Eines Tages, beim Mittagessen, trat Habiba an Ralphs Tisch und fragte mit einem verführerischen Lächeln: „Ist hier noch frei?“ Sie kamen ins Gespräch, trafen sich bald häufiger, gingen zusammen aus, wurden vertrauter im Umgang miteinander. Und schließlich verführte Habiba den ahnungslosen Ralph zunächst sexuell, aber kurz darauf auch zum erneuten Kokainkonsum.
***
Vollkommen entnervt und geschockt, weil der Bruder weder auf ihre verzweifelten Rufe noch auf das laute Trommeln an der Toilettentür reagiert, versucht Melanie zunächst, den Hausmeister herbeizurufen. Dieser ist aber offensichtlich nicht in seiner Wohnung. Dann wählt sie hektisch die 112 und alarmiert die Feuerwehr.
„Hier Melanie Westphal. Ich benötige dringend Hilfe. Mein Bruder hat sich im Büro in der Toilette eingeschlossen und antwortet nicht. Ich habe Angst, dass er sich etwas angetan hat. Bitte kommen Sie sofort, bitte, bitte!“ Auf Rückfrage der Stimme am Nottelefon nennt sie die Anschrift. Keine fünf Minuten später kündigt sich mit lautem Martinshorn der Rettungsdienst an. Melanie blickt aus dem Fenster und beobachtet mit Erleichterung die Feuerwehrleute und das Notarztteam, die jetzt zum Gebäudeeingang eilen. Als sie ihnen die Tür zum Büroraum öffnet, kommen sie bereits die Treppe hoch. Wortlos deutet sie dem ersten Feuerwehrmann die Richtung zur Herrentoilette. Da das erneute Rufen und Klopfen ebenfalls wirkungslos ist, setzt einer der Männer eine kleine Ramme an das Türschloss und stößt zu. Mit lautem Krachen spaltet sich das Holz. Als man danach versucht, die Tür zu öffnen, hindert sie ein schwerer Gegenstand, der nur mit vereintem Kräfteaufwand beiseitegeschoben werden kann.
Einer der Sanitäter stützt die verzweifelt schluchzende Melanie und führt sie weg, um ihr den Anblick des leblosen Körpers ihres Bruders zu ersparen. Langsam bringt er sie zu einem der entfernteren Schreibtische und schiebt ihr gerade noch rechtzeitig einen Stuhl unter, bevor sie kraftlos zusammensackt. Die sofort eingeleiteten Reanimierungsversuche sind vergebens. Traurig schüttelt der Notarzt nach einigen Minuten den Kopf. „Exitus. Wir sind leider zu spät gekommen!“ Einsatzleiter Meno Hansen telefoniert mit der Kriminalpolizei und berichtet kurz über das Vorgefallene.
„Wir haben einen Toten!“, verkündet Kriminalhauptkommissar Harald Sierck, leitender Beamter der Kieler Bezirkskriminalinspektion Blumenstraße, seinen beiden Mitarbeitern, Oberkommissar Sascha Breiholz und Oberkommissarin Steffi Hink. Er überreicht ihnen einen Zettel mit der Anschrift des Tatorts. „Seht euch dort bitte um. Oberbrandmeister Meno Hansen rief soeben an und meldete den Fall. Es scheint sich um einen ‚goldenen Schuss‘ zu handeln, aber man weiß ja nie …“
„Wer fährt?“, fragt Oberkommissar Breiholz seine Kollegin.
„Darf ich?“, erwidert Oberkommissarin Hink mit einem Lächeln. Geschickt fängt sie den Autoschlüssel, den Oberkommissar Breiholz ihr über das Dach des VW Passat Kombi zuwirft, auf und setzt sich ans Steuer. „Ich weiß, wo es ist“, sagt sie, während sie den Motor startet und das Blaulicht einschaltet. Gelegentlich lässt sie auch kurz das Martinshorn ertönen, denn es ist schon fast Mittag und der Wochenendverkehr ist dichter geworden.
Als sie wenig später die Treppe des Bürogebäudes emporsteigen, begegnen ihnen die Sargträger, die Ralphs Leichnam hinunterbringen. Oben empfängt sie der Chef des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Kiel, Prof. Dr. Christoff Klamm. Da der Pathologe gerade an einer Studie für die Landesregierung über den Drogenkonsum und seine Folgen arbeitet, hat er es sich nicht nehmen lassen, persönlich am Tatort zu erscheinen, um den Fall zu untersuchen.
„Guten Tag, Herr Professor. Können Sie uns schon etwas sagen?“
„Hallo, Frau Oberkommissarin, lange nicht gesehen, und auch Ihnen guten Tag, Breiholz. Ja, offensichtlicher Tod durch eine Überdosis Kokain. Allerdings ziemlich unübliche Umstände, behauptet doch die Schwester des Toten, dieser sei nach einer längeren Entwöhnungskur in der Schweiz clean gewesen und habe sich anschließend, so auch während der ganzen letzten Zeit, absolut unauffällig verhalten. Sie kann sich dieses Malheur überhaupt nicht erklären. Ich werde also den Fall näher untersuchen. Sobald ich den Leichnam seziert habe, gebe ich Ihnen Bescheid.“
Sascha Breiholz unterhält sich zunächst mit Feuerwehr-Einsatzleiter Hansen und lässt sich alles genau berichten. Steffi Hink geht an den Schreibtisch zu Melanie Westphal, die vollkommen apathisch ins Leere blickt. Der Notarzt hat ihr eine Beruhigungstablette verabreicht. „Guten Tag, Frau Westphal, ich bin Oberkommissarin Steffi Hink, Bezirkskriminalinspektion Kiel. Das da vorn ist mein Kollege, Oberkommissar Breiholz.“ Sie deutet auf Sascha, der inzwischen hinzugekommen ist. „Gemeinsam ermitteln wir im Todesfall Ihres Bruders – Ralph, nicht wahr? Zunächst unser allerherzlichstes Beileid zu diesem tragischen Vorfall.“
Professor Klamm, die Feuerwehr und der Notarztwagen sind inzwischen abgefahren. Stattdessen sind die hinzugerufenen Mitarbeiter der Spurensicherung und zwei Streifenpolizisten anwesend.
Sascha fragt: „Ich weiß, es muss furchtbar für Sie sein, aber wären Sie dennoch in der Lage, uns einige Fragen zu beantworten?“
Melanie nickt.
„Würden Sie uns bitte erzählen, was geschehen ist?“, sagt Steffi.
Melanie berichtet ausführlich über die Vorgeschichte. „Ich kann mir einfach nicht erklären, wie es plötzlich zu diesem bösen Rückfall gekommen ist. Ralph hat sich doch absolut unauffällig verhalten, und ich bin sicher, ich hätte es bemerkt.“
Lars Kruse, ein Mitarbeiter der Spurensicherungsmannschaft, erscheint in seiner weißen Montur mit einem kleinen Plastikbeutel in der Hand. „Kokain, kein Zweifel, anscheinend sehr rein. Geht ins Labor, okay?“
Sascha nickt. „Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Bruder sich das Kokain beschafft haben könnte?“, fragt er Melanie.
„Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es kann nur in Lübeck gewesen sein, und zwar an der Fachhochschule. Dorthin ist Ralph täglich gefahren. Wer weiß, wem er dort alles begegnet ist.“
Die beiden Oberkommissare sehen sich vielsagend an. „Wir müssen Waldi informieren“, sagt Steffi. Dann klärt sie Melanie auf: „Kommissar Walter Mohr ist unser Spezialist von der Drogenfahndung. Er wird sich um alles Weitere kümmern. Dürfen wir Sie jetzt nach Hause bringen?“
„Vielen Dank, aber ich habe meinen Wagen in der Tiefgarage stehen.“
„Sie sollten jetzt nicht selbst fahren, da Sie die Beruhigungstabletten genommen haben. Kommen Sie bitte mit.“ Saschas Tonfall lässt keine Widerrede zu. „Ach, mein Gott, ich muss ja noch die Eltern anrufen. Wie soll ich ihnen nur das Furchtbare erklären?“ Melanie verfällt wieder in Panik.
Steffi versucht sie zu beruhigen: „Wann wollten sie denn zurückreisen?“
„Am Mittwoch gegen Mittag. Ich soll sie am Hamburger Flughafen abholen. Oh Gott, oh Gott, was mache ich nur?“
„Also, wenn Sie meine Meinung hören möchten“, sagt Sascha, „ist es wenig sinnvoll, Ihre Eltern schon jetzt mit der Todesnachricht Ihres Bruders in Aufruhr und Trauer zu versetzen. Es sind ja nur vier Tage bis zu ihrer geplanten Rückkehr. Viel früher könnten sie sowieso nicht zurückkommen, und damit wäre auch nichts gewonnen. Haben Sie eine gute Freundin oder einen Freund, der Sie zum Flughafen begleiten könnte? Allein sollten Sie keineswegs dorthin fahren.“
Melanie denkt nach. „Ja, ich habe eine sehr gute Freundin aus meiner Hamburger Gymnasialzeit, die Nili. Mit ihr treffe ich mich sehr oft. Übrigens eine Ihrer Kolleginnen, sie ist Oberkommissarin in Oldenmoor.“
„Dürfen wir bitte den Büroschlüssel haben?“ Sascha nimmt den Schlüssel entgegen und übergibt ihn an einen der Streifenpolizisten. „Wenn die Spusi hier fertig ist, verschließen Sie bitte das Büro und versiegeln die Tür.“
Dann gehen Sascha und Melanie gemeinsam in die Tiefgarage. Sascha lenkt Melanies Cabrio, gefolgt von Steffi im schwarzen Kombi. Sie bringen die immer noch von Weinkrämpfen geschüttelte junge Frau nach Hause.
Als die beiden Oberkommissare gemeinsam auf dem Weg zurück in die Bezirksinspektion sind, verkündet Steffi: „Ich werde sofort Waldi anrufen, er muss diesem Fall auf die Spur kommen. Die arme Frau Westphal tut mir so leid!“
Sascha pflichtet ihr bei: „Eine bodenlose Gemeinheit! Wenn schon mal einer von der Sucht loskommt – und dann das! Manches Mal verzweifle ich an unserer Justiz. Man ist viel zu nachlässig mit der Bestrafung dieser gewissenlosen Kanaille. Die Erpresser, Entführer und Drogenhändler gehören doch alle …“
„Genug, Sascha!“, unterbricht ihn Steffi. „Ich weiß, was du fühlst, und manches Mal bin auch ich geneigt, aus Frust über unsere Ohnmacht gegenüber diesen Verbrechern alles hinzuwerfen. Wir geben uns die beste Mühe, sie ausfindig und dingfest zu machen, damit sie ihre gerechte Strafe erhalten. Und dann schaffen es oftmals die gewieften Herren Verteidiger, unter Ausnutzung sämtlicher Gesetzeslücken und Tricks, diesen miesen Übeltätern zu milden Urteilen oder sogar zu einem Freispruch zu verhelfen. Trotzdem, ich bin froh, in einem Staat zu leben und diesem zu dienen, in dem das Gesetz regiert und nicht die Willkür. Und das solltest auch du, lieber Herr Kollege Oberkommissar!“