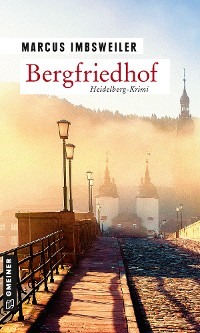Kitabı oku: «Bergfriedhof», sayfa 4
6
»Das kann doch nicht sein, Max!«, rief Fatty und ruderte mit seinen kurzen Armen. »Eine Leiche verschwindet nicht einfach so.«
»Sie war aber nicht mehr da.«
»Dann hat sie einer weggebracht. Dein Pfeffersprayer, wer sonst? Und den muss einer gesehen haben.«
»Wer denn?«
»Überleg doch mal, dieses Risiko. Da läuft einer mit einem Toten huckepack über den Friedhof und fährt ihn dann durch halb Heidelberg. Dafür muss es doch Zeugen geben!«
»Mitten in der Nacht? Nein, muss es nicht. Angenommen, der Alte hat einen guten Grund, den Mord zu vertuschen. Zum Beispiel weil er persönlich darin verwickelt ist, auf welche Weise auch immer. Dann muss er die Leiche beseitigen. Und so groß ist sein Risiko nicht. Dieser obere Teil des Friedhofs liegt ziemlich einsam, ein paar Meter nur, dann ist er am Ausgang, und wenn er seinen Wagen geschickt geparkt hat, sieht ihn kein Mensch.«
»Und der Einzige, der von dem Toten weiß, liegt kampfunfähig im warmen Bett. Du bist mir ein schöner Ermittler.«
Ich sah Fatty zu, wie er mit vorwurfsvoller Miene ein Stück Weißbrot in die Olivenöltunke stippte.
»Die Schmerzen«, sagte ich, »die Schmerzen waren einfach unerträglich. Schlimm war das. Schlimm.«
Er hielt inne und betrachtete mich eingehend von oben bis unten, bevor er das öltriefende Stück Brot in den Mund steckte.
»Schlimm«, wiederholte ich und schaute gequält zur Seite.
»Schmerzen machen stark«, bemerkte er kauend. Dann leckte er sich gedankenverloren die Finger ab. Er sah aus, als habe er gegen einen zweiten Teller Lamm und Aubergine nichts einzuwenden.
Lautes Klirren ließ uns hinunter in den Hof schauen. Eine Bewohnerin des Hinterhauses stieg gerade von ihrem Rad, im Lenkerkorb purzelten Bierflaschen in einer Plastiktüte durcheinander. Die Frau war dürr und hässlich und Zahnarzthelferin. Zumindest hatte sie Letzteres mir gegenüber einmal behauptet. Jeder im Block kennt sie, weil sie sich regelmäßig mit ihrem Freund streitet, der großformatige Aktbilder malt und möglicherweise sogar verkauft. Sie streiten lange und laut. Man hört es im Hinterhaus, im Vorderhaus, in den Nachbarhäusern. Einmal kam sogar der Besitzer der Apotheke vis-à-vis, klingelte und fragte, ob er helfen könne. Er hatte Pflaster und Mullbinden mitgebracht. Weswegen die beiden streiten, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht wegen der Aktbilder. Der Mann malt immer nur aus dem Gedächtnis; Modelle kann er sich nicht leisten.
Die dürre Frau stellte ihr Rad ab und nahm die Plastiktüte mit den Bierflaschen aus dem Korb. Sie schlurfte zum Hintergebäude und kramte nach ihrem Hausschlüssel, ohne ihn zu finden. Kurz überlegte sie, dann stellte sie die Tüte auf den Boden und öffnete eine Flasche. Mit den Zähnen. Trinkend blickte sie sich schuldbewusst um; nach oben wanderte ihr Blick allerdings nicht.
Wir schauten uns schweigend an. Mit den Zähnen, Respekt. Und das von einer Zahnarzthelferin. Vielleicht kam sie billig an Prothesen.
»Der Tote«, begann Fatty, als die Frau im rückwärtigen Gebäude verschwunden war. »Hast du eine Idee, wer er sein könnte?«
»Schwer zu sagen.«
»Kein Anhaltspunkt? Nichts Besonderes an ihm? Beschreibe ihn mal.«
Achselzuckend stellte ich mein Glas auf den Tisch. »Ich habe ihn ja nur kurz gesehen. Er war im Pensionsalter, über 70 wahrscheinlich, mittelgroß, hageres, fast knochiges Gesicht, markante Nase und die Augen… starr und weit geöffnet halt. Braune Augen. Ein abgetragener Anzug. Dunkle Hosen, dunkle Schuhe, alles recht unansehnlich. Das Einprägsamste waren seine Augen.«
»Jean-Louis Trintignant.«
»Da gab es doch mal diesen jüdischen Nobelpreisträger aus New York, der so heißt wie ein Tier, na …?«
»Katzehundtiger?«, half Fatty freundlich.
»Nee, was Netteres. Egal. Ich komm schon noch drauf. Übrigens roch er nach Mottenpulver.«
»Nach Mottenpulver?«
»Ja, nach Mottenpulver. Kann ich auch nichts dafür. So wie es bei dir riecht, wenn du deinen Kleiderschrank öffnest.«
»Ich hab noch nie Mottenpulver benutzt. Weiß gar nicht, wie das riecht.«
»So wie der halt. Vielleicht war es auch etwas anderes, keine Ahnung. Eigentlich kam er mir vor wie ein …« Ich überlegte. »Ja, wie ein Ausländer.«
»Wie ein Ausländer?«
»Mhm …«
»Verstehe ich nicht.« Fatty runzelte die Stirn. »Wie riechen denn Ausländer?«
»Wieso riechen? Ich habe nicht gesagt, dass er wie ein Ausländer roch.«
»Natürlich hast du das.«
»Quatsch, ich habe gesagt, dass er mir wie ein Ausländer vorkam.«
»Du hast gesagt«, unterbrach mich Fatty, »dass er nach Mottenpulver roch, vielleicht aber auch nach etwas anderem, und du ihn deshalb für einen Ausländer hältst. Und nun frage ich mich, wie er deiner Meinung nach wohl riecht, der genormte Standardausländer? Nach Knoblauch? Nach Mülltonne?«
»Verdammt, Fatty, dreh mir das Wort nicht im Mund rum!«
»Ich drehe nicht. Du drehst!«
»Ich wollte bloß diesen Geruch beschreiben. Einen fremdartigen, ungewöhnlichen Geruch, klar?«
»Ungewöhnlich ist noch lange nicht ausländisch.«
Abwehrend hob ich die Hände. »Ich nehms zurück, okay?«
»Aber Ausländer …«, begann er.
»Vergiss es!«, schnitt ich ihm das Wort ab.
Er zuckte die Achseln.
Pause. Ich goss Wein nach.
Du meine Güte, ich bin doch nicht fremdenfeindlich! Nur weil ich hin und wieder eine unbedachte Bemerkung fallenlasse? Mein ganzes Dasein besteht aus unbedachten Bemerkungen, und die treffen Ausländer ebenso wie Einheimische. Dass mir bestimmte Menschen fremder sind als andere, Asiaten fremder als Europäer, Osteuropäer fremder als Westeuropäer – das sagt gar nichts. Ich bin nun mal im Südwesten der Bundesrepublik aufgewachsen, und ich lebe dort; das prägt. Ob mir allerdings Bayern, Lausitzer oder Nordfriesen näher stehen als Elsässer, Schweizer oder Luxemburger, wage ich zu bezweifeln, und beim Kochen verhalte ich mich eindeutig undeutsch. Mein Gaumen ist ein heimatloser Geselle. Daran denkt jemand wie Fatty natürlich nicht.
Trotzdem, das mit der weltoffenen Küche mag stimmen, aber es stellt bloß die eine Seite der Medaille dar. Auf der anderen Seite sind weniger schmeichelhafte Dinge verzeichnet. Zu diesen Dingen gehört meine reflexartige Abwehrhaltung, wenn sich Zugnachbarn einer Sprache bedienen, die ich für Serbisch halte. Dazu gehören meine Aversionen gegen türkische Halbstarke mit Gel im Haar und Goldkettchen an den Handgelenken, die gelangweilt auf dem Bahnhofsvorplatz herumlungern, gegen ihre verschleierten Mütter und ihre rauchenden, Filme glotzenden Väter. Nein, ich bin nicht so offen und tolerant, wie ich es gerne wäre und wie es die öffentliche Meinung verlangt. In der Schülerzeitung schrieb ich einmal, wir bräuchten mehr Exoten in diesem verstaubten Land, ohne Afrikaner oder Asiaten würden wir in unserem eigenen Mief ersticken. Die Provokation gelang prächtig, unser Religionslehrer bekam einen Wutanfall, und in einigen Fächern wurden meine Noten plötzlich schlechter. Aber dann kam der Tag, an dem mein Cousin eine Senegalesin heiratete und ich einsah, dass ich mir in die Tasche gelogen hatte. Mit einer Schwarzen leben? Das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Warum nicht? Ich wagte nicht, genauer darüber nachzudenken. Und wenn man schließlich noch anführt, dass meine Eltern mich mit 14 zum Schüleraustausch in die Bretagne schickten und ich erst nach drei Wochen, nach drei schrecklichen Wochen, in denen ich heulte und mich übergab und heulte und abnahm, zurück nach Hause durfte, dann existiert möglicherweise doch der eine oder andere Hinweis auf eine tief in Max Koller verankerte Fremdenangst.
Mag sein.
Nur brauchte ich mir das nicht von einem Friedhelm Sawatzki vorhalten zu lassen. Nicht von einem politisch überkorrekten Kindergärtner mit schlesischen Vorfahren, der stets weiß, welche sozialkritische Stunde geschlagen hat, der mit 15 das Kapital … Aber das erwähnte ich ja schon.
Zurück zu unserem Abendessen auf einem der brüchigsten Hinterhofbalkone Heidelbergs.
»Okay«, sagte Fatty versöhnlich. »Lassen wir den Toten in Ruhe, Mottenpulver hin oder her. Schenkst du mir noch mal ein?«
Ich grinste.
»Was ist mit deinem Auftraggeber? Wer könnte das gewesen sein?«
»Keinen blassen Schimmer.«
»Lass uns logisch vorgehen. Ein Heidelberger? Auswärtiger? Wie sprach er? Kannte er sich aus?«
Ich überlegte. »Er sprach lupenreines Hochdeutsch, dialektfrei. Trotzdem schien er ein Ortsansässiger zu sein. Er kannte den Bergfriedhof, wusste, wie er über den Gaisberg zu fahren hatte.«
»Also ein Heidelberger. Was ist dir noch aufgefallen?«
Ich zuckte die Achseln. »Nichts Besonderes. Er hat Geld, Selbstbewusstsein, Bildung und er gibt gerne Kommandos, kommt sofort zur Sache, wenn nötig, kann bei Bedarf aber auch um den heißen Brei herumreden.«
»Das heißt?«
»Könnte ein Wirtschaftstyp gewesen sein. Ehemaliger Aufsichtsrat, Abteilungsleiter, so was in der Art. Vielleicht aber auch ein Juraprofessor oder ein Oberarzt.«
»Sein Wagen?«
»Ein beigefarbener BMW, ziemlich breit, ziemlich protzig.«
»Ausstattung?«
»Keine Ahnung. Normal, würde ich sagen.«
»Normal«, lachte Fatty verächtlich. »Und du willst Privatdetektiv sein? Schaff dir mal ein Auto an, vielleicht achtest du dann mehr auf das, was andere Leute fahren.«
»Mir reicht, wenn ich einen Mini von einem BMW unterscheiden kann.« Fatty liebt seinen Mini und hat ihm sogar einen Namen gegeben. Einen weiblichen natürlich.
»Das dachte ich mir.« Er kniff die Augen zusammen und spielte mit seinem Glas, in dem sich nur noch ein winziger Rest Wein befand. »Pass auf, Max: Morgen früh machst du einen Spaziergang an der Bergstraße entlang, einschließlich aller Nebenstraßen rechts und links, und hältst Ausschau nach deinem BMW. Spätestens um 14 Uhr hast du deinen Unbekannten gefunden.«
»Habe ich? Um 14 Uhr?«
»Oder 14.30 Uhr. Prost!«
»Interessant. Und wie kommt Friedhelm Sherlock Sawatzki zu dieser Annahme?«
»Durch Nachdenken«, entgegnete er ernst. »Durch die Kraft der reinen Vernunft. Grips, verstehste? Hier oben.« Er tippte an seinen runden Schädel.
»Wahnsinn«, meinte ich. »Wahnsinn im Quadrat. Wo holst du das nur her? Kannst du mir seine Adresse diktieren? Und seine Blutgruppe? Ich bin manchmal ein bisschen schwer von Begriff.«
Fatty rülpste zufrieden. »Bergstraße«, wiederholte er. »Bergstraße und nirgendwo sonst.«
»Nur weil er Kohle hat? Deswegen muss er gleich …«
»Nicht nur Kohle, Max. Stil, Statur, das richtige Alter. Schon mal was von soziologischem Profil gehört?«
»Nee.«
»Gibts auch nicht. Habe ich gerade erfunden. Aber Tatsache ist, dass solche Typen wie er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hier in Neuenheim am Hang wohnen, damit sie die Sonne genießen und dem Rest der Welt aufs Dach spucken können.«
»Neuenheim ist groß. Warum nicht am Neckar, in einer der Villen?«
»Zu laut, zu nahe am gemeinen Volk.«
»Und die Weststadt? Da ist es schön ruhig, und es gibt …«
»Weststadt? Vergiss es. Mit den Türkenläden im Erdgeschoss und der Studenten-WG im Hinterhaus? Nein, ausgeschlossen. In Handschuhsheim haust der Studienrat mit Gattin, und beide schielen neidisch nach Neuenheim. In der Altstadt will schon lange keiner mehr wohnen, da bleibt nur noch die Bergstraße. Das Paradies für die Spießerelite der Stadt.«
»Und was ist mit dem Schlosswolfsbrunnenweg auf der anderen Neckarseite?«
Fatty wiegte abschätzend sein Haupt. »Ja, möglich. Die einzige realistische Alternative. Wobei die Leute, die dort wohnen, nun wirklich stadtbekannt sind. Die stehen alle naslang in der Zeitung, und danach hörte sich dein Mann nicht an.«
»Bergstraße also«, sagte ich. »Gott, ja, ich kann es versuchen. Mit Soziologie hat das allerdings nichts zu tun, Fatty. Soziologie light vielleicht, passend zu deiner Cola.«
»Sehr witzig«, brummte er beleidigt. »Da lässt man sich herab und schüttet literweise Rotwein in sich hinein, nur damit … Pass auf, Max: Wir wetten drum. Bergstraße plus angrenzende Nebenstraßen; wenn du den Alten dort findest, zahlst du mir eine Kiste von dem Roten.«
»Eine Kiste?«, lachte ich. »Wer soll die trinken? Deine Oma vielleicht?« Fattys Großmutter stammt aus Polen und verträgt mehr als wir beide zusammen, selbst wenn uns eine durchschnittlich trinkfeste Seniorenfußballmannschaft verstärkt.
»Was ist? Wetten wir oder wetten wir?« Seine Augen funkelten vor Begeisterung.
»Wenns dir Spaß macht. Vielleicht weißt du ja auch, wo sich das Opfer befindet?«
Er überlegte. Nagte an der Unterlippe, drehte Däumchen. »Das ist nicht so einfach«, sagte er schließlich. »Obwohl man die Schwierigkeiten, eine Leiche verschwinden zu lassen, nicht unterschätzen sollte.«
»Das klingt, als hättest du jede Menge Erfahrung in dieser Hinsicht.«
»Denk doch mal nach, Max! Dein Unbekannter oder wer auch immer kommt mitten in der Nacht zum Friedhof, um den Toten wegzuschaffen. Er braucht erstens ein Auto. Zweitens einen Ort, an dem die Leiche so schnell nicht entdeckt wird, am besten über Jahre nicht. Wie war das noch mal mit der Todesursache?«
»Ich schätze, er hatte eine Schussverletzung. Wobei ich keinen Schuss gehört habe.«
»Vielleicht ein Schalldämpfer? Jedenfalls kann der Mörder so keinen Unfall vortäuschen. Die Leiche in einem Steinbruch zu deponieren, scheidet also aus. Was sonst? Ein stillgelegtes Bergwerk, eine Sondermülldeponie … nein.« Er entkorkte die Rotweinflasche und schenkte sich nach.
»Red nur weiter.«
»Ich würde ihn verbrennen. Besser als im See versenken oder klein gehackt einfrieren. Beim Verbrennen bleibt nichts übrig, wenn man es richtig macht.«
»Mit anderen Worten: Ich brauche nur in der Bergstraße nach heimlichen Feuerchen hinterm Haus Ausschau zu halten.«
»Das wäre zumindest ein Anfang. Natürlich musst du die Tatwaffe finden.«
»Wenn es weiter nichts ist.«
»Und du musst klären, warum dich der Alte zum Bergfriedhof bestellt hat.« Er nickte anerkennend. »Ein ordentliches Programm für die nächsten Tage, Respekt. Da heißt es, rechtzeitig aufzustehen. Der frühe Vogel fängt den Dings. Den Wurm.«
»Wiesel, richtig.«
»Vogel, nicht Wiesel. Wiesel fressen keine …«
»Der Nobelpreisträger. Jetzt fällt es mir wieder ein. Elie Wiesel hieß der. Und genau so sah mein Toter aus.«
7
Am Steigerweg hatten sie ganze Arbeit geleistet. Die Straße war von ihrem tiefsten Punkt am Alois-Link-Platz bis zum nördlichen Nebeneingang des Bergfriedhofs aufgebaggert, und nur auf einer Seite hatte man einen schmalen Streifen für den Verkehr freigelassen. Die Heidelberger Stadtbusse passten so eben hindurch, mussten allerdings den Bürgersteig mitbenutzen. Befahrbar war der Durchlass bloß in einer Richtung; wer hinunter in die Stadt wollte, musste, wie der Silberrücken in der gestrigen Nacht, den Umweg über den Gaisberg in Kauf nehmen.
Ich erwähne das nur, weil es Folgen für den weiteren Verlauf der Geschichte hatte. Natürlich ließ ich mich sofort hügelabwärts rollen, um den Steigerweg gegen die vorgeschriebene Richtung zu durchfahren. Keine Chance. Von unten kamen nicht viele Autos, aber sie kamen regelmäßig, und zwischen der Friedhofsmauer und der Baustellenabsperrung gab es keinen Platz zum Ausweichen. Außerdem war ich mit meinen beiden Fahrrädern – eines unter, eines neben mir – fast so breit wie ein PKW.
Ich wendete also schweren Herzens und fuhr bergauf. Noch vor der ersten Serpentine bog ich links ab und nahm eine Abkürzung durch den Wald, die mich zum Johannes-Hoops-Weg führte. Eine kurze Strecke musste ich schieben. Nassgeschwitzt kam ich oben an. Die restliche Strecke war kein Problem, es ging relativ eben an der Riesensteinkanzel vorbei und dann die Klingenteichstraße hinunter in die Altstadt.
Allerdings gab es hier deutlich mehr Verkehr, als ich erwartet hatte. Ob es an der Umleitung lag? Oder war das schon Heidelbergs Wochenendtourismus? Wie auch immer, ich war kaum in die talwärts führende Klingenteichstraße eingebogen, als sich auch schon eine lange Schlange hupender PKWs hinter mir bildete. Für die schmale Straße war mein Doppelsitzer einfach zu breit.
Ganz ruhig, sagte ich mir, bis nach unten ist es nicht weit, wir haben Samstagmorgen, kein Grund zur Eile. Leider sah der motorisierte Rest der Bevölkerung das anders. Ich glaubte, die Trompeten von Jericho hinter mir zu haben: Es wurde gehupt, Bremsen winselten, einer lehnte sich aus dem Beifahrerfenster und beschimpfte mich. Und was sie mir erst zuriefen, wenn sie mich überholten! Ich sehnte mich in die Stille des Bergfriedhofs zurück.
»Was erwartest du, Max?«, hätte Fatty gesagt. »Spießer sind das. Spießer, wie sie im Buche stehen. Und zwar in keinem schönen Buch.«
Vermutlich hatte er recht. Es waren Spießer, aber sie regten mich auf. Sogar ihre Autos regten mich auf, diese albernen Corollas und Civics und Passat Kombis. Es war immer dasselbe Spiel: Ein Motor heulte auf, man scherte nach links, zog an mir vorbei, gestikulierte und fluchte, dann sah ich nur noch die Hinterfratzen dieser scheußlichen Kleinwagen, regelrechte Metallgrimassen, die Rücklichter blitzten verächtlich, die Stoßstangen waren flach und breit und ähnelten zusammengekniffenen Lippen.
Wie elend lange diese Straße aber auch war! Und ich musste ja vorsichtig fahren.
Irgendwann löste sich meine linke Hand wie von selbst von der Lenkstange, fuhr zur Faust geballt nach oben und ließ den Mittelfinger gen Himmel zeigen. Ich weiß, man soll sich nicht auf das Niveau der anderen herablassen, aber es waren bloß noch ein paar 100 Meter hinab in die Altstadt, und danach gab es zweispurige Straßen, Platz zum Überholen, Abbiegemöglichkeiten. Außerdem tat es verdammt gut.
Hinter mir wurde gehupt.
Ich ließ die Hand in der Luft. Nebenbei gesagt, war es kein kleines Kunststück, sekundenlang freihändig eine steil abfallende Straße hinunterzurollen, mit der Rechten ein unbemanntes Rennrad zu dirigieren und mit der Linken nonverbal zu kommunizieren. Verständnis für diese akrobatische Leistung erwartete ich dennoch nicht.
Eine letzte Kurve, dann war es geschafft. Wieder hupte es hinter mir, lange und aufdringlich. Ich warf einen kurzen Blick über die Schulter und dann noch einen, um mich zu vergewissern. Ein Streifenwagen.
Das war natürlich Pech. Großes Pech sogar. Nicht ein einziger Polizist auf dem Bergfriedhof, und nun saßen sie mir im Nacken: zwei ehrgeizige Ordnungshüter auf der Jagd nach Verkehrssündern. Überm Steuer hing ein junger Sportsmann mit Schnauzbart, angespornt von einer kleinen Blonden, die eine hübsche Zahnreihe blitzen ließ, und beide sahen nicht gerade freundlich aus.
Was tun?
Bremsen? Aufgeben? Selbst wenn ich mich dazu entschlossen hätte – und einfach wäre es nicht geworden, bei meinem Tempo, mitten in der Abfahrt, zwei Fahrräder steuernd –, selbst wenn ich ihren Aufforderungen brav Folge geleistet und angehalten hätte, wären wir keine Freunde geworden. Ich hätte ihnen gestehen müssen, dass der Grund meiner rasanten Fahrt eine Leiche war, die sich in Luft aufgelöst hatte, dass mir ein Unbekannter im Kaschmirmantel die Augen verätzt hatte und dass ich ein Privatflic war, der sich mit anonymen Auftraggebern nachts auf einem Friedhof verabredete, einfach so. Eine nette Unterhaltung wäre das geworden.
Also tat ich nichts. Ich ließ den Dingen, das heißt: den Rädern, ihren Lauf und flitzte das letzte Steilstück der Klingenteichstraße hinab ins Tal, die Kirchtürme der Altstadt bedrohlich nahe vor Augen. Es war ein warmer Aprilmorgen, die Sonne schien mit erstaunlicher Kraft, ich schwitzte, hinter mir hupte es.
Die Klingenteichstraße mündet unten in die viel befahrene Friedrich-Ebert-Anlage, und spätestens dort war es vorbei mit der wilden Jagd. Ich würde an der Ampel halten müssen oder mich wie ein Lemming in die Kreuzung stürzen. Und selbst wenn ich es lebend über die vier Spuren der Anlage schaffte, würden sie mich bekommen. Ich hätte im Bett bleiben sollen.
Noch 200 Meter, noch 150 … Mein Doppelsitzer war kaum zu kontrollieren. Ich flitzte an parkenden Autos und überraschten Fußgängern vorbei, an einer etwas heruntergekommenen Jugendstilturnhalle, in der ich eines vergangenen, eines sehr fernen, sehr schönen Tages einmal Fußball mit einer Gruppe trotzkistischer Philosophen gespielt hatte. Dann kam mir ein Gedanke.
Er kam mir in Gestalt des Klingentores entgegen, eines ebenso pittoresken wie nutzlosen Baus rechts der Straße, vom Stadtteilverein liebevoll gepflegt und vom Tourismus missachtet. Es ist ein schmales Tor, zwei Fahrräder passen mit Mühe hindurch, allerdings hat bei seiner Errichtung im Mittelalter niemand an Fahrräder gedacht, denn der Torweg besteht aus Kopfsteinpflaster, das in einige Treppenstufen übergeht. Daran dachte ich allerdings in diesem Moment nicht. Ich sah nur das Klingentor und die Möglichkeit, meine Verfolger abzuhängen.
Jetzt oder nie! Ich riss meine beiden Fahrräder nach rechts, der Polizeiwagen schoss an mir vorbei und ich mitten durch das Klingentor hindurch. Szenenapplaus. Nun kamen die Stufen. Vier Räder, und alle verloren sie den Bodenkontakt. Ich biss die Zähne zusammen, ohne die Lenkstangen loszulassen. Dann der Aufprall. Keine Ahnung, wie ich es schaffte, aber ich stürzte nicht.
Links und rechts quietschten Reifen. Die Friedrich-Ebert-Anlage. Mein eigenes Bremsmanöver kam zu spät, umso schneller reagierten die übrigen Verkehrsteilnehmer. Wahrscheinlich hatte ihre Ampel gerade erst auf Grün geschaltet, ihr Tempo war nicht besonders hoch. Gleichwie, sie verhinderten eine Katastrophe. Ich schlitterte über die vierspurige Anlage, die Peterskirche vor Augen, bis zum Beginn der Grabengasse. Hinter mir wieder ein Hupkonzert.
Wenn ich nun geglaubt hatte, die Jagd sei zu Ende, dann hatte ich mich geirrt. Einige 100 Meter entfernt, in Höhe der Einmündung der Klingenteichstraße, heulte ein Martinshorn auf. Die beiden Polizisten verschafften sich an der Kreuzung, Gott weiß wie, freie Bahn, bogen verkehrswidrig rechts ab und preschten über die Friedrich-Ebert-Anlage auf mich zu. Verflucht, waren die empfindlich! Ich nahm wieder Fahrt auf, wollte zunächst der Grabengasse folgen, mitten hinein ins Herz der Altstadt, doch dann kam mir eine bessere Idee. Links von der Universitätsbibliothek, die ich inzwischen erreicht hatte, zweigt die Plöck ab, ein schmales Altstadtsträßchen, nur in eine Richtung befahrbar. Genauer gesagt gilt der Einbahnstraßenpfeil für Kraftfahrzeuge, nicht für Fahrradfahrer; wenn ich nun in westlicher Richtung in die Plöck einbog, verhielt ich mich völlig korrekt. Einmal abgesehen von der Tatsache, dass kein Verkehrsplaner an einen Doppelsitzer gedacht hatte, wie ich einen fuhr.
Im Prinzip war ich gerettet.
Leider nur im Prinzip, denn ich hatte nicht mit der Entschlossenheit meiner Verfolger gerechnet. Vielleicht gehörten sie einer neuen Generation an, der athletische Schnauzbart und seine blonde Kollegin, vielleicht wollten sie sich gegenseitig etwas beweisen, vielleicht auch verwechselten sie die Situation mit einem Videospiel, und ich, Max Koller, war ein Alien auf vier Rädern, den sie so schnell wie möglich wegpusten mussten, um den nächsten Level zu erreichen. Was interessierte da ein ›Durchfahrt-verboten‹ Schild?
Ich war bereits einige Häuser weit gekommen, als ich das Martinshorn hinter mir durch die Plöck schallen hörte. Sie ließen also nicht locker. Sie wollten mich haben, unbedingt.
Ich fuhr weiter. Trat in die Pedale, so schnell ich konnte, die linke Hand bremsbereit, denn die Plöck war schmal und belebt. Vor mir stoben drei junge Mädchen auseinander, als ich sie anbrüllte, eine Gruppe behelmter Mountainbiker, die mir entgegenkam, machte bereitwillig Platz. Fußgänger drückten sich unter wütenden Zurufen an die Hauswände. Wenn mir nur kein Lieferwagen mit quadratischer Vorderfront begegnete! Ein kleines Auto dagegen wäre mir gerade recht gekommen: eines, an dem ich knapp vorbei passte, nicht aber meine Verfolger.
Doch da war kein Auto, bloß die Mountainbiker, die Fußgänger, fassungslose Passanten. Sie hörten das Martinshorn, und sie sahen einen Mann auf zwei Fahrrädern, der von einem Streifenwagen verfolgt wurde. Was sie wohl dachten? Ich hatte keine Gelegenheit, dem nachzugehen, denn im nächsten Moment war meine Jagd zu Ende. Es war kein Auto, das mich stoppte, kein Lieferwagen, auch kein überraschter Tourist.
Sondern eine Schule.
Eine Schule und davor 30, 40 Schüler mit Pausengetränk und Kippe. Sie standen einfach da und glotzten in meine Richtung. Wer hatte denn Schulstunden an einem Samstagmorgen? Fatty meinte hinterher, es müsste sich um Nachhilfeunterricht oder ein Blockseminar gehandelt haben, vielleicht auch um ein Theaterprojekt oder Orchesterproben. Egal. Jedenfalls standen sie da, Samstag hin oder her, sie sahen die Gefahr, die sich ihnen näherte, aber sie reagierten nicht. Zumindest nicht schnell genug. Die Ersten ließen ihre Kippe fallen, die Nächsten begannen zu schreien, andere rannten los, wieder andere stolperten ihnen entgegen, sie fielen schon übereinander, bevor ich in sie hineinraste.
Die Katastrophe war unvermeidlich. Ich konnte nicht ausweichen, überall standen sie, diese 14-, 16-, 17-Jährigen, und bis sich so eine träge Meute mal in Bewegung setzt… Kurz vor dem Aufprall, immer noch hoffend, da würde sich eine winzige Lücke auftun, bremste ich. Zu spät.
Ich weiß nicht genau, was geschah. Alles wirbelte durcheinander: die Schreie der Jugendlichen, Sirenengeheul und Bremsenquietschen, ich sah bunte Flecken vor mir, rote, schwarze, blaue, Farbtupfer, die wohl von Schulranzen und Jeansjacken herrührten, ließ mein Rennrad los und tauchte ein in diese gigantische Malerpalette. So ähnlich dürften sich Hippies in ihren Kifferträumen gefühlt haben, beim Sprung in prallbunte, dreidimensionale Halluzinationen, beim Planschen im Innern einer Hammondorgel. Sogar eine olfaktorische Seite hatte dieses Erlebnis: Ein intensives, billiges Parfüm wehte mir um die Nase, schrecklich, mit was sich diese Halbwüchsigen begießen! Dann prallte ich gegen weiche Gegenstände, wurde gebremst von Bäuchen und Brüsten, Schenkeln und Hintern und landete schließlich in einer Hecke, die einen kleinen Spielplatz begrenzte. Dort roch es auch; allerdings nicht mehr nach Parfüm.
Ich schnappte nach Luft und rappelte mich auf. Zwei bleiche Jungs mit Elvis-Tolle starrten mich entsetzt an. In einiger Entfernung quietschten Reifen. Schüler kauerten am Boden, es gab Hilferufe und Tränen, Schulhefte flatterten durch die Luft. Vor mir lag meine rote Mühle, das Vorderrad noch in wilder Drehbewegung. Jemand schrie mich an, einfach so, ohne Sinn und Verstand.
Ich hasse Schule, dachte ich und hob das Rad auf.
Sekundenbruchteile später saß ich wieder im Sattel und setzte meine Flucht fort.