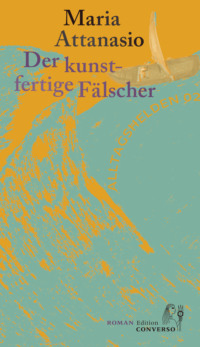Kitabı oku: «Der kunstfertige Fälscher», sayfa 2

Ein ansehnlicher Trupp Sicherheitsbeamter unter dem Kommando von Kommissar Gulizia bezog Stunden vor Morgengrauen rings um das Haus des »Mavaro« Stellung. Eine im nahegelegenen Zollhaus versteckte Gruppe postierte sich auf der Seite zur Allee hin mit Blick auf die kleine Eingangstür; eine andere verteilte sich zwischen dem Lavageröll hinter dem Haus, um ja keinen Moment die tiefgelegenen Fenster aus den Augen zu verlieren, durch die selbst ein Halbblinder wie der professore ganz einfach hätte entwischen können.
Schwaches Licht einer Öllampe sickerte durch die Fensterläden, die nicht wie sonst ganz zugezogen waren. Das Haus war also nicht im Tiefschlaf versunken, und der Kommissar befürchtete eine undichte Stelle unter den Kollegen und eine Falle des Mannes, der, um Verwirrung zu stiften, womöglich am Abend zuvor ungestört das Haus verlassen und die Lampe hatte brennen lassen. Doch er beruhigte sich, als er einen Schatten im Zimmer gewahrte und sah, wie dieser stehen blieb und das Fenster öffnete.
Der Ermittler Petralia und der Königliche Gardist Gervasi, die an den Seiten des Fensters postiert waren, um im Fall der Fälle rechtzeitig eingreifen zu können, spürten in allernächster Nähe seinen schweren Atem und seine nervös das Fensterbrett umklammernden Hände. Sie atmeten auf, als der Mann ins andere Zimmer ging, doch sogleich kam er mit einer Mappe voller Zeichnungen zurück. Auf dem Bett sitzend, nahm er sich eine Zeichnung nach der anderen vor, zog dann zwei heraus und befestigte sie mit Reißzwecken an der Wand. Dann setzte er die Brille ab, trat ganz nah an sie heran, wie um sie zu küssen. Stattdessen tat er je drei Mal so, als wollte er sie anspucken — zuerst die eine, dann die andere.
»Wie ein Hexer«, sagte Gervasi verschreckt zu Petralia, der ihn beruhigte. »Das ist ganz bestimmt unser Mann. In ein paar Stunden wirst du schon sehen.« Der Mann verschloss das Fenster ganz fest. »Endlich geht er schlafen«, sagte der Kommissar erleichtert und begab sich zu dem an der Allee postierten Trupp. Sie warteten, dass der Mann wie immer pünktlich um acht Uhr das Haus verließ; doch als die Kirchturmuhr von Sant’Agostino sechs Mal schlug, trat der Mann durch die kleine Haustür und machte sich langsamen Schrittes, misstrauisch um sich blickend, auf den Weg.
Ein Polizist stellte sich ihm entgegen.
»Entschuldigen Sie, auf ein Wort, professore …«
»Bitte, sprecht doch …«
»Nicht hier, in Ihrem Haus. Wir sind von der Königlichen Garde. Eine Durchsuchung … Waffen …«
»Wenn’s nur das ist. Hier, der Revolver. Ein Mauser. Vor ein paar Monaten hatte ich Besuch von Räubern … bloß zur Abschreckung … Sehen Sie nur, er ist nicht geladen. Ich bin nicht einmal fähig, ihn zu bedienen.«
Inzwischen waren weitere Beamte hinzugekommen, und schon war der Mann umstellt. Er begriff. Ohne weitere Ausflüchte ging er ins Haus zurück und setzte sich neben dem Fenster nieder. Stumm in sich versunken, während die Beamten unter Ausrufen der Verwunderung und einigen Flüchen die kleine Wohnung auf den Kopf stellten. Gervasi betrachtete prüfend die beiden Zeichnungen, die mit Reißzwecken an der Wand befestigt waren; sie zeigten die gleiche Person: einmal auf leicht vergilbter Pappe als jungen Mann mit verschlagenem Blick, einen Pinsel in der Hand, auf der zweiten Zeichnung in fortgeschrittenem Alter und mit hochmütiger Miene. »Wer ist das?«, fragte er den professore, der gereizt zur Antwort gab: »Ein Judas. Der für fünf Centesimi auch die eigene Mutter verkauft.« Groß war die Verblüffung am Ende der Durchsuchung. Keine Spur von der Druckereiwerkstatt für Hundert-Lire-Scheine, die mutmaßlich mit der in Palermo im Verbund stand. Stattdessen fand man Handbücher über Chemie, Vergrößerungsgläser, Fotoapparate und die komplette Apparatur — von der Vorbereitung der Klischees bis zum Druck — eines unerwarteten Labors für die Fälschung von Fünfhundert-Lire-Banknoten, viele davon ordentlich verpackt unter den Kommoden und für den Absatz bereit. Doch weder eine Bank noch irgendeine Privatperson hatten jemals die Existenz ebendieser gefälschten Scheine zur Anzeige gebracht. »Wie ist das möglich?«, fragte sich der Kommissar verdutzt, und an den professore gewandt:
»Mit wem arbeiten Sie zusammen?«
»Das hier habe ich alles allein gemacht. Und aussagen werde ich vor niemand anderem als dem Königlichen Staatsanwalt«, erwiderte der Mann barsch, der, ohne sich im Mindesten um das Treiben um ihn herum zu kümmern, wieder mit stolzer Brust, doch gebrochener Sehkraft in Richtung der Lavafelder starrte.
Der telefonisch benachrichtigte Staatsanwalt traf einige Stunden später ein. Erstaunt blickte er auf den Mann mittleren Alters, der am Fenster saß; in seinem abgetragenen haselnussbraunen Anzug wirkte er wie ein bescheidener, ehrwürdiger Beamter im Ruhestand: In nichts entsprach er dem Klischee eines Geldfälschers oder Schwarzmarkthändlers, die sofort an ihrem Tand und Protz und dem im Vergleich zu ihrer angeblichen Tätigkeit hohen Lebensstandard zu erkennen waren.
Der Staatsanwalt hörte zu, prüfte, analysierte und verweilte vor dem Selbstbildnis, das den Schreiner so sehr in Schrecken versetzt hatte. Er, ein Amateurmaler zarter Veduten von Meer und Küste, blickte nun befremdet auf die beiden Gesichter ohne Schädel, die aus der Schwärze des Hintergrunds hervortraten.
Schließlich schickte er sich an, den Geldfälscher zu befragen, der ihn jedoch gestreng innehalten ließ: »Vor einem Künstler nehmen Sie gefälligst den Hut ab!«
Dieser stolze und empörte Ton brachte ihn aus der Fassung. So legte er nicht nur den Hut, sondern auch Überzieher und Schal ab, griff sich den einzigen Stuhl im Zimmer und setzte sich neben den Mann ans Fenster.
»Reden Sie jetzt«, sagte er. »Sagen Sie mir alles über diese Werkstatt.«
»Keine Eile«, war die Antwort. »Ich komm’ schon noch dazu: Sie werden Namen, Nachnamen und Adressen erfahren. Alles.«
Der Geldfälscher Paolo Ciulla begann also seinen Bericht mit dem Tag seiner Geburt am 19. März 1867 in Caltagirone, in einem Sizilien, das in jenem Jahr beim schwierigen Übergang von der Herrschaft der Bourbonen unter die der Savoyer den Gipfel seiner verzweifelten Lage erreichte: Krieg, Aufstände, Cholera, Dürre. Und beim Erzählen geriet er in Begeisterung, wurde ironisch, war gerührt, entrüstete sich, wurde fuchsteufelswild angesichts der Ereignisse jenes Lebens, als wäre es das eines anderen und nicht sein eigenes. Die fabulierende Verdoppelung, wie sie jeder conteur — zwischen phantasievoller Allwissenheit und sich entziehenden Fakten — vollbringt, indem er die Leerstellen füllt und dem längst Vergessenen, dem Vorstellbaren einer Lebensgeschichte eine Stimme verleiht. Dem tieferen Sinn der Erzählung.
ERSTER TEIL
Eins
Es war wahrlich kein friedlicher Spaziergang, jene wenigen hundert Meter, die Don Giuseppe Ciulla — wie ihn inzwischen so manch einer nannte — am Morgen des 20. März 1867 zusammen mit zwei Zeugen zurücklegte, um im Rathaus die Geburt seines am Vortag geborenen Sohnes anzuzeigen.
Kaum bog er um die Ecke der Via Sotto il Duomo im alten Stadtteil Giudecca, seinem Wohnviertel, wurde er von einer Polizeisperre aufgehalten, die eine neugierige Menge mit Drohgeschrei gegen das nahe Rathaus und den fernen Staat zu durchbrechen suchte; obschon Stadt und Staat in jenen Jahren von höchst integren Männern der Rechten geführt wurden, echten Liberalen, die freilich den Wert der Finanzen vor den Hunger des Volkes stellten.
Nach der von Garibaldi angeführten Revolution und der gewaltsamen Niederschlagung, die auch in Caltagirone Märtyrer hervorgebracht hatte, war der Hass auf die Regierung und ihre Unterstützer im Rathaus — geschürt von Kaplänen und Bourbonenanhängern — im Gleichschritt mit Zöllen, Militärdienstpflicht und Hungersnöten Jahr um Jahr angewachsen. Zwischen Juni und November jenes Jahres sollten die sozialen Spannungen mit der Ausbreitung der Cholera ihren Höhepunkt erreichen. Denn in den ärmsten Schichten verbreitete sich bei den ersten Krankheitssymptomen auch die Überzeugung, dass die Regierung, um das Problem des Hungers und der öffentlichen Sicherheit zu lösen, die Streuung der Epidemie — Stadt für Stadt — mit genauen Vorgaben hinsichtlich der Anzahl der Toten und der Gesellschaftsschicht verfügt habe. Caltagirone hatte fünftausend Tote zu beklagen, alle unter den einfachen Leuten, den Handwerkern, den Arbeitslosen und den bedürftigen Bürgern. Darauf folgten Tumulte, Brände und Angriffe auf das Rathaus und eine gnadenlose Jagd auf den untore, den Giftsalber: Pech für den Unglücksvogel, der dabei überrascht wurde, wie er sich gerade zu Boden beugte oder sich dicht an den Mauern entlang fortbewegte, genau wie es im 17. Jahrhundert dem Barbier Mora und dem Kommissar der Gesundheitsbehörde Piazza geschehen war, den beiden Opfern in Alessandro Manzonis Geschichte der Schandsäule. Und der Aberglaube des Volkes wurde auch durch den aufsässigen katholischen Fundamentalismus angefacht, der von den Kanzeln herab, mit Donnergetöse von Verdammnis oder Kirchenbann, die Ursache der Epidemie in der antiklerikalen Revolution Italiens erkennen wollte, »das nun zu Recht von Gottes Hand mit der furchtbaren Cholera bestraft wurde.«
Doch an jenem 20. März war die Cholera ein bloßes Drohgespenst. Heftiger und unmittelbarer war das Bedürfnis nach Nahrung: Seit neun Monaten regnete es nicht mehr, auf ein Jahr der Dürre folgte ein weiteres, gleichermaßen unfruchtbares, brütend heißes. Und obwohl die Stadtverwaltung dafür gesorgt hatte, dass Weizen aus Catania kam — wohin er wiederum aus Tunesien und Ägypten angeliefert wurde —, hatte man kein Brot backen können: Flüsse und Wildbäche waren ausgetrocknet, und so standen die Flügel der Mühlen unerbittlich still. Der Weizen, das waren unbezwingbare Körner geblieben, und die Stadt somit ohne Brot. Nachdem man am Stadtrand auf eine verhungerte Schwangere gestoßen war, obsiegte der Hunger über jede atavistische Vorsicht; Proteste und Plünderungen nahmen Tag um Tag zu, bis an ebenjenem Morgen ein unschuldiger Wachmann der Stadtverwaltung ermordet wurde, der mit dem Regierungsinspektor des Versorgungsamtes, Eugenio Manca, dem eigentlichen Ziel des Schützen, unterwegs war, um die städtischen Backstuben zu inspizieren.
An Brot mangelte es Don Giuseppe Ciulla in Wirklichkeit nicht. Gleich nach der Vereinigung Italiens war er aus dem fernen Barrafranca mit einem kleinen Sparsäckel hierhergekommen, hatte eine Schuhmacherwerkstatt eröffnet, an die er nach und nach einen bescheidenen, aber vom Glück gesegneten Lederwarenhandel angliederte. Damit konnte er nicht nur sorglos leben, sondern auch etwas zur Seite legen. Seiner geizigen Natur schmerzlich zuwiderhandelnd, kaufte er unter der Hand stets ein wenig überteuertes Mehl für seine schwangere Frau, die er im Jahr zuvor geheiratet hatte. Verführt hatten ihn nicht ihre liebliche Schönheit, auch nicht ihr jugendliches Alter, sie war zwanzig Jahre jünger als er, sondern ihre Geschicklichkeit als Strumpfwirkerin.
Don Giuseppe war nicht nur knausrig, sondern auch äußerst umsichtig. So versuchte er an jenem Morgen, unbemerkt an den Wachleuten und dem Ermordeten vorbeizuschlüpfen, taub obendrein gegenüber dem Drohgeschrei an die Adresse der Behörden. Er zerrte seine beiden Begleiter, die sich unter die Menge hatten mischen wollen, mit sich fort und machte schleunigst kehrt. Nachdem er mit ihnen einen langen Umweg über den unteren Teil des Corso zurückgelegt hatte, traf er schwer atmend am Rathaus ein, wo alle wegen der bedrohlichen Anwesenheit des gemeinen Volks draußen auf der Piazza in höchster Aufregung waren.
Die beiden Rathausdiener, die am Eingang Wache hielten, hießen ihn mit einem barschen »Das ist ein Befehl. Keiner darf hier vorbei!« Halt machen. Aber ein paar Münzen der alten Währung dienten als Passierschein, der es ihm begleitet von einem verschwörerischen »Macht schnell, Euer Ehren« erlaubte, endlich die Geburt seines Sohnes Paolo Francesco Gesualdo registrieren zu lassen und sich von der lästigen Gegenwart der zwei Zeugen zu befreien.
Während er sich zufrieden und nunmehr allein auf den Heimweg machte, vervielfältigten sich in seinem Kopf die Bilder der von Lederwaren überquellenden Ladengeschäfte und einer schwatzenden Schar wartender Kunden: Diesem Sohn, Lohn und Zukunft seiner Arbeit, würde er den Umgang mit Schnur, Pfriem und Hammer lehren, um einen Schuster, vor allem aber einen geachteten Händler und einen kundigen Meister des Geschäfts und der Kundenwünsche aus ihm zu machen, wie er selbst einer war.
Diese Geburt mehrte sein Glück. Er erweiterte die Werkstatt um einen Großhandel in einer der prächtigen Straßen der Stadt, der auch auf Kunden aus den umgebenden Ortschaften zählen konnte. Die Gewinne verwandelte er in Darlehen an Händler in Schwierigkeiten und an Adlige, die auf dem Trockenen saßen, und konnte so binnen kurzer Zeit den gemieteten Laden und das kleine Haus, das er bewohnte, erwerben, während der Landbesitz zahlungsunfähiger Personen, einer nach dem anderen, in seine Hände überging.
Als sein Sohn etwa vier Jahre alt war, beschloss er, ihn zu sich in die Werkstatt zu holen, um ihn mit dem Werkzeug vertraut zu machen. Doch Paolo weinte, bis ihn Krämpfe schüttelten, und war nicht zu beruhigen. Don Giuseppe verschob die Sache auf spätere Jahre und war immer bestürzter wegen dieses Knaben, der sich mit zunehmendem Alter wenig bis gar nicht in der Werkstatt blicken ließ. Stets hockte er zu Hause und schaute der Mutter beim Strümpfestricken zu. Doch eigentlich wartete er gespannt darauf, dass sie — und das hätte sich der tatkräftige Don Giuseppe niemals vorstellen können — diese Arbeit niederlegte, um endlich ihr Stickzeug zur Hand zu nehmen. Wie verzaubert folgte der Sohn ihren Fingern, unter denen sich bunte Seidenfäden auf einem Deckchen oder einem kleinen Tischtuch in Blumen, Blätter und vielfarbige Schnörkel verwandelten. Beim Sticken sang sie. Und hinter ihr sang auch Paolo, mit einem hohen und sehr wohlklingenden Stimmchen. Das war ihrer beider Geheimnis. Don Giuseppe wollte nämlich nichts davon wissen, er hielt diese unproduktive Stickerei für Zeit- und Geldverschwendung, obschon seine Frau betonte, dass sie es nur auf Stoffresten machte, um ihre Augen auszuruhen, die infolge der Monotonie der grauen und schwarzen Strümpfe schier blind waren.
Vollkommen unproduktiv erschien ihm auch die außergewöhnliche Begabung, die der Sohn schon von den ersten Schuljahren an bewies: Er malte alles in seiner Umgebung ab, und wenn da nichts war, das sein Interesse weckte, so zeichnete er aus dem Gedächtnis und mit großer Liebe zum Detail Gesichter, Gegenstände, Landschaften, die er irgendwann einmal gesehen hatte.
Am Ende der Grundschuljahre war keine Rede mehr davon, dass er im Geschäft mitarbeiten sollte. Seine Lehrer und die meist gefügige, jetzt aber unnachgiebige Gattin drangen einstimmig darauf, dass Paolo unbedingt auf der Königlichen Fachschule seine Studien im Zeichnen fortsetzen solle. Doch wenige Tage nach seinem Eintritt schon lief der Junge, die Zerstreutheit der Schulbediensteten ausnutzend, davon. Giuseppe fand ihn mitten auf dem freien Feld, zitternd unter einen Granatapfelbaum gekauert. Nichts von dem geschah, was der Junge, den Blick hebend — da stand er, der Vater mit dem Ledergurt in der Hand — glaubte, es müsse geschehen. Der beugte sich nämlich zu ihm nieder, legte die Arme um seine Schultern und brachte ihn nach Hause. »Du warst es doch, der auf die Schule gehen wollte. Warum bist du dann weggelaufen?«, fragte er, indes ohne eine Antwort zu erhalten, außer einem untröstlichen Schluchzen. Am nächsten Tag begleitete er ihn höchstpersönlich in die Schule zurück.
Am meisten jedoch beunruhigte Don Giuseppe das verwirrende Durcheinander der gesellschaftlichen Stände und Hierarchien unter den Freunden des Jungen: Vom ersten Schuljahr an bildete er mit Turi, dem jüngsten der drei Söhne des Barons Aprile, ein unzertrennliches Gespann; auch mit Luigino, dem Sohn eines Habenichts ohne Kunst noch Können aus Acquanuova — als Halbwüchsiger dann wird Luigino mit der ganzen Familie auf der Überfahrt nach Amerika ums Leben kommen. Ob Nebel oder Schirokko, stets steckten die drei zusammen. Sie jagten jeder Neuigkeit nach, folgten wie Schatten dem Fotografen Valenti, quasselten unaufhörlich miteinander, verschwanden für ganze Nachmittage, ohne dass jemand wusste, was sie anstellten, noch, wohin sie gegangen waren.
Ohnmächtig fühlte sich Don Giuseppe gegenüber diesem dickköpfigen und launischen Sohn, der ihm in allem und jedem widersprach. Und aus dem kein Kapital zu schlagen war. Doch das war nur der Vorgeschmack des großen Schmerzes, den ihm Paolo ein paar Jahre später bereiten sollte, als er, frisch diplomiert, verkündete, er werde aufs Festland gehen, um an einer angesehenen Akademie Malerei zu studieren. Vergebens versuchte Giuseppe, ihn mit der nassen Wäscheleine zur Vernunft zu bringen, drohte, ihn aus dem Haus zu werfen. »Wucherer!«, schrie der Sohn ihm entgegen, und kam am Abend nicht mehr nach Hause, sondern ging in eine Ortschaft in der Nähe, um dort gegen Kost und Logis Häuser anzustreichen. Allein die Tränen der Mutter konnten Paolo einige Wochen später zur Rückkehr bewegen.
Das war das letzte Mal gewesen, dass der Vater versuchte, ihm seinen Willen aufzuzwingen. Fortan fand er sich mit ihm ab wie mit einem Schicksalsschlag: Es kommt, wie’s kommen soll, warum also Tränen vergießen.
Auch mit den anderen Kindern war ihm das Glück versagt: Der Zweitgeborene, Vincenzo, hatte zwar schon als kleiner Bub den Beruf des Schuhmachers erlernt, verstand sich aber nicht auf den Handel und ließ sich von jedermann übers Ohr hauen. Rosetta, die Letztgeborene, kostete ihn für besondere Nahrung und Arzneien ein Vermögen.
Geschlagen mit so unnützen Kindern und der Diabetes, die ihm langsam den Blick trübte, blieb ihm nichts weiter, als seine Geschäftstätigkeit zu beenden.
Die Schuld hierfür suchte er beim modernen Leben: in der Laxheit der Sitten; der Schulpflicht, die die Kinder von der Arbeit abzog; und beim größten aller Übel, den Zeitungen, die in den Köpfen der jungen Leute für übergroße Erwartungen sorgten und Unruhe stifteten; bei der Vorstellung einer Welt, die sich zu schnell wandelte und den angestammten Platz und die Rolle aller Dinge durcheinanderbrachte.
Es war die Revolution von 1860, die in den Augen von Don Giuseppe alles aus den Fugen hatte geraten lassen. Je mehr Jahre vergingen, desto stärker ergriff diese Unordnung das Denken, zerrüttete die Sitten und das Gehirn der Menschen. Und vielleicht auch das der Tiere, schloss er bitter und dachte dabei an seinen Hund Damuso, der, missraten wie sein Sohn, bisweilen grundlos die Zähne gegen ihn fletschte.
(Notiz)
Ein Schusterkollege war es, der Don Giuseppe Ciulla — er verstand sich sehr gut aufs Rechnen, stolperte beim Lesen aber über jede Silbe — die erste offizielle Verlautbarung über seinen Sohn vorlas.
In einem Artikel vom 17. Oktober 1885 in Il Cimento — eines der zahlreichen kurzlebigen Blätter, die in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für Bewegung im politischen und kulturellen Leben von Caltagirone sorgten — war die Rede von dem außergewöhnlichen Malertalent des jungen Mannes und von einem sehr schönen, in der Via del Corso ausgestellten Portrait, gemalt »ohne fremde Hilfe, nur mit natürlicher Begabung; doch weit mehr könnte er erreichen, wenn ihm jemand, zum Beispiel die Stadtverwaltung, die Mittel für ein Studium zur Verfügung stellte«.
Und das Rathaus stattete Paolo tatsächlich mit solchen Mitteln aus, wie es jahrhundertealter Brauch einer Stadt so wollte, in der eine kleine Elite aristokratischer Familien, sich in den Amtssesseln der Institutionen abwechselnd, den überaus reichen öffentlichen Besitz verwaltete. Sie taten das zum eigenen Vorteil, aber mit großem politischem Gespür: So versahen sie die Gemeinde mit allen denkbaren kulturellen Einrichtungen und Wohltaten und schickten die Verdienstvollsten unter den jungen Leuten — aller Gesellschaftsschichten — auf Kosten der Stadt zum Studium an die renommierten Universitäten und Akademien Italiens. Im Gegenzug wuchsen Ansehen und Macht der Honoratioren, wie es just in diesen Jahren bei Giorgio Arcoleo der Fall war.6 Auch dem vielversprechenden Paolo Ciulla wurde ein Stipendium zugesprochen, damit er weiterhin Malerei an den Kunstakademien in Rom und in Neapel studieren konnte, doch mit der stillschweigenden Verpflichtung, nach Beendigung des Studiums sein Können der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. In devotem Einvernehmen mit ihrer führenden Klasse.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.