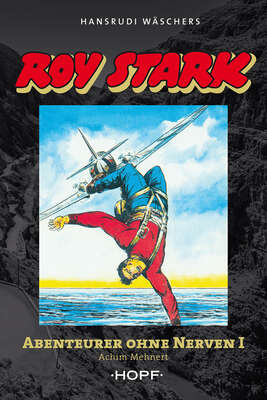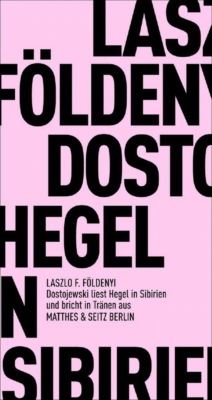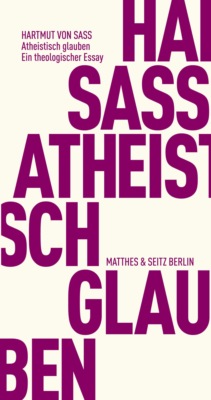Sayfa sayısı 151 sayfa
0+
Going Viral!

Kitap hakkında
Martin Burckhardts Essay Going Viral! schließt an den zusammen mit Dirk Höfer verfassten programmatischen Versuch an, die Urformel aller Digitalität, das Boole'sche x = xn, als Triebwerk der neuen Ordnung der Dinge zu deuten. War Alles und Nichts eine Meditation über die symbolische Viralität, geht Burckhardt nun einen Schritt weiter und postuliert ein durch die Pandemie ausgelöstes Ende des postmodernen Phantasmas, mitten in den Abgrund der Geschichte hinein. Wenn Wittgenstein einmal gesagt hat «Die Welt ist, was der Fall ist», lässt sich der Sturz als Zusammenstoß mit dem Realitätsprinzip deuten. Oder genauer: als Einsicht, dass die überkommenen Sprach- und Gesellschaftsspiele nicht mehr zu tragen vermögen. Als blinder Passagier der globalen Warenketten und Reisebewegungen erweist sich die Pandemie als böser Zwilling der Netzwerkgesellschaft, die mit ihrem Ruf des Going Viral! die industriellen Gesellschaften grundstürzend verändert hat, der nun aus seinem Untergrund auftaucht. Als Behemoth? Oder nicht doch: als fremdes Porträt unserer selbst?