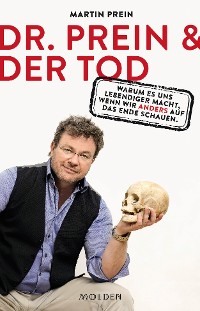Kitabı oku: «Dr. Prein & der Tod», sayfa 2
TABUZONE LEICHE
„Der Tod ist ja ein Tabu“, so eine der vielen, wie ich sie nenne, „Allerheiligen-Diagnosen“ rund um das Thema Endlichkeit, die mir immer und immer wieder begegnen. Oft und gerne schwingt dabei ein „immer noch“ oder „zumindest bei uns“ mit, und auch ein eigenwilliger Abgleich mit einer Vergangenheit, in der angeblich alles ganz anders, nämlich natürlicher war. Jedenfalls kehrt der Satz gebetsmühlenartig wieder und hat sich mittlerweile einen fixen Platz in unserem Sprachgebrauch gesichert. Was auch immer er bedeuten soll. Kaum ein Artikel oder sonstiges Druckwerk über Tod und Sterben, das nicht damit kokettiert und unserer Gesellschaft den Umgang damit als chronisches Tabu attestiert. Nur, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir das sagen? Was genau ist daran tabu bzw. worüber können wir nur schwer oder nur mit vorgehaltener Hand reden?
Das Wort „Tabu“ gebrauchen wir übrigens nicht nur im Zusammenhang mit dem Tod sehr gerne, vielen anderen Erscheinungen des menschlichen Lebens wird ebenso ein Tabu-Status zugedacht, etwa der Sexualität, der Menstruation, den Vorsorgeuntersuchungen von vielleicht schambesetzten Köperteilen und vielem mehr. Man kann sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren: Wenn jemand seiner jeweiligen Angelegenheit, die er oder sie gerne unter die Menschen bringen möchte, eine ganz besondere Bedeutung und Wichtigkeit verleihen will, dann scheint es günstig, diese Angelegenheit als gesellschaftliches Tabu auszuweisen. „Die Sexualität im Alter ist nach wie vor ein Tabu“ – dies zu sagen scheint die Sache dringlich zu machen und die Sprecherin weist sich dadurch als Pionierin und tapfere, rastlose Kämpferin gegen dieses Tabu aus, die etwas Wichtiges zu sagen hat. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, doch ist uns meistens nicht vollumfänglich klar, dass wir fast immer, wenn wir das Wort Tabu verwenden, es nicht in seiner eigentlichen Bedeutung gebrauchen und es auch nicht in seinem ursprünglichen Sinne verstehen.
Ein Schicksal, das übrigens viele Begriffe miteinander teilen, zumindest, wenn wir sie gebrauchen. Denn oft tun wir das, ohne dass wir ihre ursprüngliche Bedeutung meinen, bzw. oft kennen wir diese nicht einmal. Man könnte sogar sagen, je inflationärer ein Begriff im Alltag vorkommt, desto beraubter ist er oft seiner eigentlichen Bedeutung. Und da ist der Tabubegriff längst kein Einzelfall. Wir sehen dies etwa auch bei Begriffen und Fachtermini wie Stress, Verdrängung, Trauma, Depression und vielen mehr. „Ich habe ein Trauma“, tönt es da selbstdiagnostisch und manche meinen damit lediglich den Wochenendbesuch der Schwiegermutter oder den zum hundertsten Mal ohrenbetäubend laut abgespulten Lieblingsschlager des Gatten. Natürlich haben diese, sicher auch belastenden, Situationen so rein gar nichts mit einem Psychotrauma im eigentlichen Sinn zu tun. Auch wenn wir meinen, wir seien „depressiv“, verbergen sich dahinter oft keine Symptome einer klassischen, klinisch relevanten und behandlungsbedürftigen Depression. Vielmehr wollen wir damit unserer Sehnsucht Ausdruck verleihen, ein paar Tage lustlos sein zu dürfen und den Nachmittag lieber auf der Couch verbringen zu wollen, als fröhlich durch den Sonntagnachmittagsspaziergang zu hüpfen, wir fühlen uns vielleicht ein wenig traurig oder frustriert, aber sind zum Glück weit von einer tatsächlichen, nämlich krankheitswertigen Depression entfernt. Und auch wenn Sie sagen, den für Sie schrecklichen Lieblingsschlager Ihres Mannes oder den Besuch seiner Mutter verdrängen zu müssen, bleibt es vermutlich beim innigen Wunsch, nicht mehr daran denken zu wollen, aber die Psyche spaltet die Erinnerung daran nicht ab bzw. löscht sie vermeintlich nicht aus Ihrer Wahrnehmung.
Aber was verbirgt sich nun hinter einem „echten“ Tabu?
JAMES COOK UND DAS TAPU
Der britische Seefahrer James Cook bereiste und erforschte im 18. Jahrhundert die polynesischen Inseln, das heutige Hawaii. Dort entdeckte er, dass die Ureinwohner dieser Inseln nach vielen ungeschriebenen Gesetzen und Regeln zusammenlebten, die für einen Außenstehenden nicht einsichtig, nicht nachvollziehbar schienen. Besonders auffällig dabei war, dass viele Gegenstände, aber auch Plätze, Tiere oder manche Mitmenschen tapu waren (so die eigentliche, erste Schreibweise). Wenn jemand tapu war, unterlag dieser einer Art Kraft, einer Macht bzw. konnte er diese auch in sich tragen, das Gleiche galt für Gegenstände. Entscheidend war, dass sich die Person oder eben das entsprechende Ding hervorhob und damit abhob vom Gewöhnlichen. Diese besondere Kraft oder Macht wurde von den Einheimischen Mana genannt und verwies weit über das Irdische hinaus, tief hinein (oder vielleicht hinauf) in etwas Übernatürliches. Demnach konnte dieses Mana den Einheimischen auch ganz schön gefährlich werden, denn als eine aus einer außerweltlichen Dimension stammende Macht konnte es, so der Glaube, schaden, strafen oder verletzen. Und deshalb waren Gegenstände, Dinge oder Menschen, die Mana in sich trugen, für die anderen tapu. Das bedeutete, dass man ihnen nur in einer bestimmten inneren Haltung und mit äußerster Vorsicht begegnen durfte: demütig, gereinigt, weihevoll oder mittels eines Rituals, einer Zeremonie. Jede andere profane Haltung hätte den Zorn des Mana erwecken können, es erzürnen, entweihen, und das hätte unvorstellbare Strafen nach sich gezogen, gegen die ein normalsterblicher Menschling absolut nichts auszurichten gehabt hätte. Er durfte sich also nur rituell vorbereitet und dem Heiligen entsprechend verhalten.
Versuchen wir diese jetzt vielleicht etwas theoretisch und trocken daherkommende Begriffsdiskussion ins Fühlbare zu übersetzen: Die meisten von uns sind wahrscheinlich katholisch oder, allgemeiner gesagt, christlich sozialisiert, und wenn nicht, dann doch sehr wahrscheinlich etwas mit der christlichen Mythologie vertraut bzw. sind Rituale, Feste, Symbole der christlichen Kirchen ein Begriff. Es gibt etwas in der katholischen Kirche, einen Gegenstand, den Sie vielleicht kennen, nämlich die Monstranz. Diese Monstranz ist ein meist reich verzierter, kelchförmiger liturgischer Gegenstand mit einer kleinen Glasscheibe in der Mitte, wohinter sich eine Hostie, also der Leib Christi, befindet, so die Vorstellung der Gläubigen. Selbstredend, dass für viele von diesem Objekt eine ganz besondere Bedeutung, Ausstrahlung und Wirkung ausgeht. Dieser Gegenstand, der das Allerheiligste (die höchstmögliche Steigerung von heilig?) in sich birgt, wird im Kirchenraum verborgen im Tabernakel aufbewahrt und ist außerhalb von Gottesdiensten für die Augen der Gläubigen unsichtbar. Berühren darf ihn ohnehin nur der Priester, ein durch seine Weihe dafür Qualifizierter, und das auch nur in demutsvoller Haltung.
Jetzt mal ehrlich, auch wenn man nicht gläubig ist und den in den Kirchen verwendeten Schaugeräten aus Gold und Edelstein keine besondere Heiligkeit abgewinnen kann: Wer von uns würde es wagen, in eine Kirche zu gehen, den Tabernakel zu öffnen, sich die Monstranz zu schnappen, diese unter die Achsel zu klemmen und damit zu einem Würstelstand zu gehen, um dann dort quasi mit dem Leib Christi im Schlepptau sich selbst leiblich zu stärken? Ich vermute, die wenigsten von uns. „Versündige dich nicht“, pflegte meine Oma zu drohen, wenn ich etwas vorhatte oder bereits getan oder bloß gesagt hatte, was in ihren Augen eine höhere Macht, in ihrer Vorstellung Gott, die gewürdigt und ehrfurchtsvoll behandelt werden will, erzürnen oder entwürdigen könnte (sie selber jedoch pflegte mehrmals täglich herzhaft mittels „ja, Kruzifix“ zu fluchen, wenn sich etwas nicht ihrem Willen beugte).
Also wir können uns sicher darauf einigen: Das mit dem Würstelstand und der Monstranz würden wir nicht wagen. Allein schon aus Respekt und Achtung fremdem Eigentum gegenüber, aber vermutlich auch nicht, weil ganz tief (oder vielleicht gar nicht mal so tief) etwas in uns schlummert, das uns davor warnt, uns mit einer derartigen Entweihung die potenzielle Strafe, die Rache einer höheren Macht, einzuhandeln. Nicht auszudenken, wozu außerweltliche Kräfte imstande wären, vermutlich drohten uns Krankheit, Schmerz und Leid, letztlich vielleicht gar der Tod.
Was wir hier am Beispiel der Monstranz erkennen können, haben wir auch schon von den Menschen auf den hawaiianischen Inseln erfahren: Dieses Mana, so der Glaube, diese jemandem oder etwas innewohnende Kraft, ist von übernatürlicher und vor allem übermenschlicher Macht, sie übersteigt uns arme, normale Wesen bei weitem und führt uns damit unsere Ohnmacht vor Augen. Ganz wesentlich dabei: Sie unterscheidet sich immer und überall vom Gewöhnlichen, so wie die Monstranz, sie erfüllt ebenso diese Eigenschaft. Es handelt sich hier zwar einerseits nur um ein vergoldetes und reich verziertes Stück Metall mit einem kleinen Glasstück in der Mitte, in dem sich eine Oblate aus Mehl, Wasser und sonstigen Zutaten befindet, und doch ist die Monstranz nicht nur das, sondern eben so viel mehr bzw. auch etwas ganz anderes. Sie unterscheidet sich also massiv vom Gewöhnlichen und aufgrund seiner Verbindung zum Übernatürlichen, aufgrund seiner Heiligkeit unterliegt sie einem Tabu.
Und noch ein ganz wesentlicher Aspekt springt ins Auge: Dieser Gegenstand birgt das Allerheiligste in sich, also in gewisser Weise das Göttliche, eine Art irdische Manifestation Gottes, an den die Gläubigen glauben. Und hier tut sich Doppeldeutigkeit auf: Denn dieser Gott steht für das Gute, das Heil, die Erlösung, für Errettung aus der Not, für Liebe und das ewige Leben. Also durchaus sehr sympathische und anziehende Eigenschaften. Aber, es ist trotzdem Vorsicht geboten, denn nur demütig, ehrfürchtig, im Falle der Monstranz nur der Pfarrer, darf man sich dieser nähern. Jede Respektlosigkeit und jeder Verzicht auf Ehrfurcht kann aufs brutalste und barbarischste bestraft werden. Unser Seefahrer Cook, zum Beispiel, ist zu Beginn seiner Erkundungstour von den Einheimischen nahezu wie ein Gott verehrt worden, wurde dann aber doch von diesen umgebracht, nachdem er einen seiner Matrosen an einer Stelle beerdigen hat lassen, die nur für Häuptlinge bestimmt war, also in heiliger Erde. Er hatte ein Tabu (tapu) gebrochen.
Dies ist doch eine augenfällige Widersprüchlichkeit: einerseits die allumfassende Liebe und Barmherzigkeit, andererseits die strafende und richtende Instanz. Einigen wir uns hinsichtlich dieser Doppeldeutigkeit und Widersprüchlichkeit auf einen Begriff, nämlich den der Ambivalenz. Mit Ambivalenz ist genau diese Doppeldeutigkeit gemeint: Etwas ist so und sein Gegenteil zugleich und es lässt sich nicht auflösen.
TABUISIERUNG – EINE SCHUTZSTRATEGIE?
Ich frage mich: Ist der Umstand, dass etwas tabu ist, in gewisser Weise auch ein Schutz? Könnte es sein, dass wir uns lieber mit der Abwehr von übernatürlichem Ungemach beschäftigen, weil uns dadurch die eigene Auslöschung weniger bedrohlich erscheint? Könnte der Umstand, dass etwas tabu ist, vor diesem Hintergrund positiv sein?
Ich habe in den letzten Jahren ich weiß nicht wie viele „Letzte-Hilfe-Kurse“ in Form von Tagesseminaren und öffentlichen Abendvorträgen gehalten. Mehrere tausend Menschen müssen es gewesen sein, die ich dabei erreichen durfte und mit denen ich intensiv in die Dimension eines Tabus, nämlich in die von toten Körpern, eingetaucht bin. Vor allem in den Lehrveranstaltungen arbeite ich auch oft mit Menschen zusammen, die in einem Beruf tätig sind, in dem sie immer wieder mit toten Körpern umgehen müssen, etwa in der Pflege, in Krankenhäusern, in Palliativeinrichtungen, bei Rettungsdiensten, aber auch mit jenen aus klassischen Leichenberufen, dem des Bestatters oder Pathologen. Dank der vielen Gespräche und Geschichten, dank der vielen Erlebnisse und dem Austausch über Ängste und Gefühle habe ich unheimlich viel erfahren über die chronisch unterschätzte Wirksamkeit des Leichentabus. Und selbstverständlich habe ich auch selbst immer und immer wieder meine eigenen Erlebnisse als Bestatter, als Psychologe in der Krisenintervention oder als Rettungssanitäter reflektiert und festgestellt, dass ich mich der Strahlkraft verstorbener Menschen nicht erwehren konnte. Spätestens nach meiner Forschungsarbeit und Dissertation mit dem Titel „Der Leichnam, das (Un-)Begreifbare der menschlichen Endlichkeit“ stand für mich unumstößlich fest, dass auch der Leichnam mit einem Tabu belegt ist. Und – und das werden vermutlich viele in Zweifel ziehen – dieses Leichentabu lässt sich in allen Kulturen, in allen Epochen und Zeiten feststellen und beobachten.
Ich betone die Zweifel deshalb, weil es der Mensch einfach sehr gerne hat, wenn uns jemand erzählt oder wir es selber zum Besten geben, dass nur wir in unserer Kultur mit dem Tod nicht besonders gut umgehen können, er nur bei uns ein Tabu darstellt, denn, so ein weiterer Allerheiligenbefund, in Mexiko zum Beispiel, in diesem oder jenem Teil Afrikas, wo auch immer, wird im Todesfall oder an den Totengedenkfesten gefeiert und getanzt. Zugegeben, wir mögen bei uns vielleicht nicht unbedingt bei Beerdigungen oder auf Friedhöfen gefeiert haben, höre ich oft weiter, aber einen anderen, natürlicheren Umgang, ein besseres Verhältnis mit dem Tod hätten wir früher auch irgendwann einmal gehabt. Aber all dem werde ich erst weit später im Buch klar widersprechen. Immerhin schreibe ich es ja, um gemeinsam mit Ihnen vieles zu ergründen, vielleicht auch zu widerlegen oder zumindest neu denken zu können.
Aber zurück zu jenem Zustand, der unsere Zukunft ist, dem toten Körper: Wollen wir uns mit dem Tod befassen, so ist es sinnvoll, sich mit einer der deutlichsten Erscheinungsweisen des Todes auseinanderzusetzen, mit dem Leichnam. Der Leichnam, als der Körper gewordene Tod, bietet uns neben einem genaueren Verständnis für das Tabu auch die Möglichkeit, vieles über unser Verhältnis zu dem Wissen, dass wir alle tot sein werden, zu entdecken. Auch der Leichnam ist mit einem Tabu belegt, auch der Leichnam trägt eine Kraft, eine Macht in sich, die oben Mana genannt wurde, auch dem Leichnam gegenüber verhalten wir uns höchst ambivalent. Die Tabuisierung des Leichnams scheint uns Lebende vor Bedrohung und Gefahr zu schützen und hat somit einen Sinn.
TABUZONE LEICHE
Der Leichnam erfüllt alle Wesensmerkmale eines echten Tabus. Sie erinnern sich an unseren Seefahrer James Cook und das tapu auf den hawaiianischen Inseln? Tabu ist etwas, das eine besondere Kraft, eine übernatürliche Macht in sich trägt (Mana) und sich vom Gewöhnlichen abhebt. Tabu können Gegenstände sein (Monstranz), aber auch Menschen, lebende, wie zum Beispiel der Heilige Vater, oder aber eben tote Menschen, Leichen. Ist etwas tabu und wird dieses Tabu verletzt, so spüren die meisten von uns dabei ein Unbehagen, eine düstere, in uns hochsteigende Ahnung, die uns sagt, dass wir etwas getan haben, was wir besser nicht hätten tun sollen. Dieses strafende Gefühl entsteht aus einer eigenen inneren Einrichtung heraus. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Ihnen die Käsekrainer am Würstelstand mit der entwendeten heiligen Monstranz unterm Arm nicht so gut schmecken würde wie sonst. Und gleich vorweg, das Tabu und vor allem das Leichentabu ist nichts Gelerntes, weil man das gesagt oder vorgelebt bekommen hat. Besonders das Leichentabu dürfte eine Grundkonstante in uns Menschen sein, so wie wir zwei Augen haben, rotes Blut oder Trauer fühlen, wenn ein geliebter Mensch für immer von uns geht, auch das hat uns niemand beigebracht, es gehört zu unserer Grundausstattung. Das Leichentabu als grundlegende Seelenfunktion.
Glauben Sie mir, es macht einen Unterschied, ob Sie als Pflegekraft in einem Krankenhaus bei Tageslicht einen Patienten zur Radiologie fahren, oder ob Sie bei Nacht einen soeben Verstorbenen in den Kühlraum bringen müssen, mit dem Aufzug in den Keller fahren, in dem Sie ganz allein sind mit dem bedeckten Körper, der nicht mehr atmet und in dem nichts mehr pulsiert. Ihr Verstand weiß zwar, dass Ihnen der Tote nichts anhaben kann, und trotzdem kann sich ein Gefühl einstellen, das unheimlich ist, vielleicht sogar gruselig. Ich selbst habe als Bestatter manchmal einen kleinen Umweg gemacht, um nicht durch den mit leblosen Körpern befüllten Kühlraum gehen zu müssen, obwohl der Weg deutlich kürzer gewesen wäre. An manchen Tagen ist man anscheinend durchlässiger für Gefühle der Angst als an anderen.
Konzentrieren wir uns hier aber weiter auf die Tatsache, dass der Leichnam mit einem Tabu belegt ist, tabuisiert wurde und ist und wir in der Begegnung mit ihm alle Aspekte des Tabus beobachten und erfahren. Nämlich dieses Mana, das dem toten Körper innewohnt und in uns ein unheimliches Gefühl erzeugen kann, fast so, als könnte der Tote auf dämonische Weise für uns gefährlich werden. Nicht wenige Pflegekräfte erzählen mir in den Seminaren, dass, wenn sie etwa eine verstorbene Heimbewohnerin für den letzten Weg – wie sie es nennen – „schön herrichten“, den leblosen Körper ankleiden, frisieren usw., sie das als eine Art letzten Liebesdienst verstehen, der es ihnen ermöglicht, von der gemochten, vielleicht jahrelang betreuten Person Abschied zu nehmen. Da gibt es aber oft auch noch eine andere Seite. Manche erzählen mir, dass sie dabei eine gewisse Anspannung wahrnehmen und im Umgang mit dem Leichnam eine Art Angst verspüren: „Ich weiß, es ist absurd, aber manchmal fürchte ich, der Tote könnte plötzlich seine Augen aufreißen und mich am Arm packen.“
Hier erleben wir wieder die dem Tod eigentümliche Ambivalenz, einerseits ist da nämlich die gemochte oder geliebte Person, die leider gestorben ist, um die wir trauern und die wir vielleicht auch noch mal gerne berühren möchten; andererseits ist da dieser Leichnam, der uns eventuell auch irgendwie gefährlich werden, auf dämonische Art untot sein Unwesen treiben könnte. Im Grunde verbirgt sich dahinter die Angst, dass man selbst sterben könnte, uns der oder die Verblichene dorthin mitnehmen könnte, wo er oder sie jetzt ist oder hingeht, mit in die neue Nicht-Existenz, die Existenz als Toter oder Tote. Die Idee des Wiedergängers, des Nachzehrers finden wir nahezu in allen Kulturen und Epochen, also genau jene Vorstellung, dass der Tote jetzt noch jemanden mitnehmen könnte. Vor allem die Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung ist eine hochaufgeladene, potenziell gefährliche Zeit: Da ist der Mensch zwar verstorben, also tot, aber immer auch noch irgendwie da. Darum ist diese sogenannte Schleusenzeit in allen Kulturen, und das war auch in unserer so, eine Zeit, die geprägt ist von Ritualen und allerlei Vorgaben, wie man sich in der Gegenwart der Toten zu verhalten hat. Viele dieser Rituale dienten dazu, den Toten nicht zu erzürnen, um nicht Gefahr auf sich zu ziehen und um sich letztlich von dem Toten auch ein Stück weit zu distanzieren, konkret auch um die Welt der Lebenden und der Toten möglichst zu trennen. Ist der Tote nach diesen Tagen, der potenziell gefährlichen Schleusenzeit, schließlich beerdigt, also aus dem Bereich der Lebenden hinausbefördert und dort, wo er hingehört, kehrt wieder Ruhe ein und unsere Verstorbenen werden zu hilfreichen Ahnen.
Und auch in diesen im Volksglauben praktizierten Bräuchen, die von uns gerne als damaliger natürlicher Umgang mit dem Tod verklärt werden, finden wir wieder die Doppeldeutigkeit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Sie vielleicht, je nach Region, in der Sie wohnen, und je nachdem, wie alt Sie sind, liebe Leserin, lieber Leser, kennen werden. Man muss als Bestatter zum Beispiel wissen, und ist auch mir damals beigebracht worden, dass man eine zu Hause verstorbene Person, die man von dort abholen fährt, auf gar keinen Fall mit dem Oberkörper, also dem Kopf voraus, aus dem Haus tragen darf. Denn, so die Vorstellung dahinter, dadurch würde etwas von dem Toten, oder etwas von ihm (Mana?) im Haus zurückbleiben, und das könnte für die dort noch wohnenden Lebenden ungemütlich werden, daher immer und ausnahmslos: mit den toten Füßen voraus aus dem Haus! Da stirbt der geliebte Opa oder die geliebte Oma und die Angehörigen sind in erster Linie umgriffen von Trauer und Schmerz, und obwohl der Abschied schwerfällt, muss der tote Körper unbedingt auf eine spezielle Art und Weise aus dem Haus getragen werden, damit nicht „etwas“ zurückbleibt. Es soll bitte schon alles mit rechten Dingen zugehen und vor allem soll alles ganz raus, ganz weggehen. Erkennen Sie die Ambivalenz?
Wenn zum Beispiel bei den Aborigines die Toten direkt vor oder sogar in der Wohnstätte bestattet worden sind oder andere Kulturen ihre Verstorbenen tage-, wenn nicht gar wochenlang zu Hause aufbewahrt haben, dann sind wir gerne verleitet zu behaupten, dass diese eben einen anderen, vermutlich besseren und furchtloseren Umgang mit dem Sterben und dem Leichnam haben als wir in Europa. Erst kürzlich hat mir eine Dame nach einem Vortrag beeindruckt entgegengeschleudert: „Die (gemeint waren die Aborigines) haben kein Problem mit dem Tod, die bestatten ihre Liebsten sogar bei sich daheim.“ Sie war nicht besonders erfreut, als ich sie auf die vorherrschende Ambivalenz aufmerksam gemacht habe, dass es nicht nur reine Nächstenliebe und Todes-Unbekümmert zu sein scheint, die die Beschriebenen so handeln lassen, sondern eben auch die Abwehr einer möglichen Gefährlichkeit. Denn die Aborigines bestatten die Toten deswegen bei sich, um auf sie aufpassen zu können, um ihre Seele im Blick zu haben und somit unter Kontrolle, denn diese könnte andernfalls übermütig werden und unbeobachtet ihr Unwesen treiben, ja gar Lebende zu sich holen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.