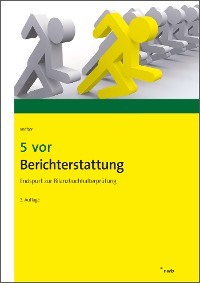Kitabı oku: «5 vor Berichterstattung», sayfa 2
3.1.2 Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs
20Gemäß § 269 HGB a. F. konnten vor Inkrafttreten des BilMoG Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs als Bilanzierungshilfe vor der Aktiva ausgewiesen werden. Durch diese Regelung sollte die Kapitalgesellschaft die Möglichkeit haben, einen Teil des Anlaufverlustes über einen Zeitraum von fünf Jahren zu verteilen und somit eine Überschuldung zu vermeiden. Wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht, kann ein entsprechender Betrag vor dem Anlagevermögen ausgewiesen werden. Diese Posten können bis zu ihrer vollständigen Abschreibung auch in einer BilMoG-Bilanz fortgeführt werden (Art. 67 Abs. 5 EGHGB).
Im Rahmen der Umgliederung der Bilanz für Zwecke der Analyse wird diese Position mit dem Eigenkapital saldiert. Das bedeutet, dass hier eine Bilanzverkürzung stattfindet.
3.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert
21
Geschäfts- oder Firmenwert
Der Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) ist der Mehrwert, den ein Unternehmen über den Gesamtwert aller materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter hinaus hat. Er kann z. B. durch den Standort, Kundenstamm, Markennamen, die Belegschaft und die Organisationsstruktur begründet sein. Wird dieser im Rahmen eines Unternehmenserwerbs käuflich erworben, ist dieser zwingend zu aktivieren und auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Kann die Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden, erfolgt die handelsrechtliche Abschreibung auf zehn Jahre (§ 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB). Im Steuerrecht erfolgt die Abschreibung zwingend auf 15 Jahre (§ 7 Abs. 1 Satz 3 EStG).
Da der GoF nicht einzelverkehrsfähig ist, also nicht getrennt vom Unternehmen verwertet werden kann, ist dieser im Rahmen der Erstellung der Strukturbilanz mit dem Eigenkapital zu saldieren.
3.1.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
22
Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen können nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB entweder unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen oder offen von den Vorräten abgesetzt werden. Da diese Art von Schulden nicht durch Zahlung, sondern durch Lieferung beglichen wird, ist bei der Erstellung der Strukturbilanz der offenen Saldierung mit den Vorräten der Vorzug zu geben. Übersteigen die erhaltenen Anzahlungen jedoch die Vorräte, ist eine Saldierung nicht mehr möglich. In diesem Fall verbleibt nur die Erfassung im Rahmen der Verbindlichkeiten.
3.1.5 Eigene Anteile
23
eigene Anteile
Eigene Anteile, deren Erwerb in § 71 AktG bzw. § 33 GmbHG geregelt ist, waren vor Inkrafttreten des BilMoG im Umlaufvermögen zu aktivieren. Korrespondierend hierzu war ein entsprechender Betrag in den Gewinnrücklagen auszuweisen. Beide Positionen waren für bilanzanalytische Zwecke gegeneinander aufzurechnen, wodurch sich eine Bilanzverkürzung ergab.
Das BilMoG normiert den Kauf und Verkauf eigener Anteile in § 272 Abs. 1a und 1b HGB. Gemäß § 272 Abs. 1a HGB sind nun zurückerworbene eigene Anteile auf der Passivseite der Bilanz in der Vorspalte des Postens „Gezeichnetes Kapital“ offen abzusetzen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag und den Anschaffungskosten ist mit den frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen. Hierdurch tritt die Bilanzverkürzung automatisch ein, sodass keine Korrektur mehr erforderlich ist.
3.1.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
24
ARA
Da in einer Strukturbilanz die Aktiva nur aus den Bereichen Anlage- und Umlaufvermögen besteht und die Passiva nur Eigen- und Fremdkapital aufweisen soll, sind die Rechnungsabgrenzungsposten umzugliedern. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind grundsätzlich im Umlaufvermögen zu berücksichtigen.
Damnum
Eine Ausnahme besteht für ein aktiviertes Damnum. Da dieses vorweggenommenen Aufwand darstellt, dem kein konkreter Gegenwert gegenübersteht, ist der Betrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen um ein eventuell enthaltenes Damnum zu verringern. Das Eigenkapital wird entsprechend gekürzt. Ein weiterer Hintergrund der Saldierung ist, dass hinsichtlich des Damnums ein handelsrechtliches Aktivierungswahlrecht besteht (§ 250 Abs. 3 Satz 1 HGB) und somit durch die Saldierung eine bessere Vergleichbarkeit geschaffen wird.
3.1.7 Aktive latente Steuern
25
Steuerlatenzen
Sind in der Handelsbilanz aktive latente Steuern im Sinne des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB ausgewiesen, werden diese mit dem Eigenkapital saldiert, da diese keinen „echten“, sondern nur einen fiktiven Zahlungsanspruch gegen den Fiskus darstellen.
3.2 Passiva
26Die Passivseite der Handelsbilanz ist wie folgt aufzubereiten:
3.2.1 Eigenkapital
27
Eigenkapital
Im Eigenkapital sind die Positionen Jahresüberschuss und Gewinnvortrag zu finden. Diese werden oftmals auch zum Bilanzgewinn zusammengefasst (§ 268 Abs. 1 HGB). Sind in einer dieser Größen die Ausschüttungen für das zu analysierende Jahr enthalten, sind diese beim Eigenkapital abzuziehen und dem kurzfristigen Fremdkapital zuzurechnen.
Beispiel
Die Passiva der A-AG sieht zum 31. 12. 2015 wie folgt aus (alle Werte in T€):

Vom Bilanzgewinn sollen im Mai 2016 50 T€ ausgeschüttet werden.
Dies hat zur Folge, dass die Passiva umzugliedern ist:

3.2.2 Sonderposten mit Rücklageanteil
28
Sonderposten
Bis zum Inkrafttreten des BilMoG war die Bildung des Sonderpostens mit Rücklageanteil in den §§ 247 Abs. 3 und 273 HGB geregelt. Ursache für dessen Bildung war die Vermeidung der Besteuerung stiller Reserven, beispielsweise nach § 6b EStG, R 6.5 EStR und R 6.6 EStR.
Da es sich bei steuerfreien Rücklagen um einen Ertrag handelt, der noch nicht versteuert werden muss, ist ein Sonderposten mit Rücklageanteil (temporäres) Eigenkapital, die enthaltene, künftige Steuerbelastung stellt dagegen Fremdkapital dar. Die Höhe des Eigen- und Fremdkapitalanteils hängt von der Steuerbelastung im Auflösungsjahr des Sonderpostens ab. Da diese meist noch nicht bekannt ist, wird die Aufteilung auf dem Schätzungsweg vorgenommen. Es dürfte bei einer Kapitalgesellschaft zutreffend sein, wenn 60 % bis 70 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil dem Eigenkapital und der Rest dem mittelfristigen Fremdkapital zugewiesen werden.
Durch das BilMoG ist die Möglichkeit der Bildung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil entfallen, sodass sich im Rahmen der Erstellung der Strukturbilanz grundsätzlich kein Korrekturbedarf mehr ergibt. Da jedoch Sonderposten, die vor Inkrafttreten des BilMoG gebildet wurden, fortgeführt werden können, ergibt sich in Altfällen noch ein Korrekturbedarf (vgl. Art. 67 Abs. 3 EGHGB).
3.2.3 Rückstellungen
29
Rückstellungen
Pensionsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen sind dem langfristigen Fremdkapital zuzuordnen. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden, sofern keine spezifischen Informationen vorliegen, dem kurzfristigen Fremdkapital zugeordnet.
3.2.4 Verbindlichkeiten
30
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden nach ihrer Fristigkeit geordnet. Es werden hierbei kurzfristige, mittelfristige und langfristige Verbindlichkeiten unterschieden (siehe Tz. 33).
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
31
PRA
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst.
3.2.6 Passive latente Steuern
32
Steuerlatenzen
Analog zu der Behandlung der aktiven latenten Steuern werden passive latente Steuern im Sinne des § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB bei der Erstellung der Strukturbilanz dem Eigenkapital hinzugerechnet.
3.2.7 Zusammenfassende Darstellung
33
Fremdkapital nach Fristigkeiten

3.2.8 Berücksichtigung stiller Reserven
34
Aufdeckung stiller Reserven
Insbesondere bei der internen Jahresabschlussanalyse ist oftmals bekannt, ob stille Reserven vorhanden sind. Im Rahmen der Erstellung der Strukturbilanz werden diese im Regelfall aufgedeckt. Da die spätere, tatsächliche Aufdeckung eine Steuerbelastung auslöst, wird, abhängig vom individuellen Steuersatz, ein entsprechender Betrag dem Fremdkapital zugewiesen, wogegen der Restbetrag das Eigenkapital erhöht.
Beispiel
Ein im Anlagevermögen mit 200.000 € aktiviertes Grundstück hat einen Verkehrswert von 300.000 €. Der Steuersatz der Kapitalgesellschaft beträgt 30 %.
In der Strukturbilanz wird das Grundstück mit 300.000 € ausgewiesen. Das Eigenkapital wird um 70.000 € (70 % von 100.000 €) und das langfristige Fremdkapital um 30.000 € (30 % von 100.000 €) erhöht.
3.3 Arten der Strukturbilanz
3.3.1 Finanzwirtschaftlich
35
Bonität
Eine Strukturbilanz wird u. a. schuldnerorientiert im Rahmen von Bonitätsprüfungen aufgestellt. Oftmals erfolgt die Aufstellung auch investororientiert. Es stehen insbesondere Kennzahlen zur Beurteilung der Liquidität und der Schuldendeckung im Vordergrund. Darüber hinaus wird vor allem auch die Rentabilität betrachtet.
3.3.2 Branchenüblich
36
Branchenvergleich
Eine branchenorientierte Strukturbilanz enthält die für die jeweilige Branche aussagefähigen Vergleichszahlen. Hierbei soll die Stellung des Unternehmens im Verhältnis zur gesamten Branche bzw. zu unmittelbaren Konkurrenten betrachtet werden.
3.3.3 Segmentiert
37
Segmentbetrachtung
Bei einer segmentbezogenen Jahresabschlussanalyse werden bestimmte Geschäftsfelder oder Regionen u. a. nach folgenden Aspekten betrachtet:
 | Ergebnis des Segments, | |||
 | Vermögenswerte, | |||
 | Schulden (sofern diese der verantwortlichen Unternehmensinstanz regelmäßig gemeldet werden), | |||
 | Umsatzerlöse, die von externen Kunden stammen, | |||
 | Umsatzerlöse aus Intersegmentgeschäften, | |||
 | Zinserträge, | |||
 | Zinsaufwendungen, | |||
 | planmäßige Abschreibungen und Amortisationen, | |||
 | Erweiterungsinvestitionen. | |||
Hierzu müssen in der Strukturbilanz die Aktiva und Passiva entsprechend zugeordnet werden.
3.4 Beispiel zur Strukturbilanz
Beispiel
38 Ihnen liegt folgende Handelsbilanz vor:

Weitere Angaben:
 | Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um einen entgeltlich erworbenen Firmenwert. | |||
 | Die Wertpapiere des Umlaufvermögens können in Höhe von 5.000 T€ jederzeit veräußert werden. Der Restbetrag kann frühestens in sechs Monaten veräußert werden. | |||
 | Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von 800 T€ eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Der Restbetrag ist innerhalb Jahresfrist fällig. | |||
 | Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben bis auf 100 T€ eine Restlaufzeit von ca. sechs Monaten. Die angesprochenen 100 T€ werden in zwei Jahren fällig. | |||
 | Die Anleihen haben eine Restlaufzeit von sieben Jahren. | |||
 | Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 500 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der Rest in Höhe von 1.500 T€ soll ausgeschüttet werden. | |||
Die Strukturbilanz hat folgendes Bild:

Erläuterungen:
 | Der Firmenwert wird mit dem Eigenkapital verrechnet, sodass sich das in der Strukturbilanz ausgewiesene Anlagevermögen aus den Sach- und den Finanzanlagen zusammensetzt. | |||
 | Die liquiden Mittel, Forderungen, und Wertpapiere gehören grundsätzlich zum monetären Umlaufvermögen. Da jedoch bekannt ist, dass Wertpapiere in Höhe von 2.000 T€ erst in frühestens sechs Monaten veräußert werden können, werden diese neben den Vorräten in das sonstige Umlaufvermögen umgegliedert. | |||
 | Das ausgewiesene Disagio sowie die latenten Steuern werden mit dem Eigenkapital verrechnet. | |||
 | Das in der Handelsbilanz ausgewiesene Eigenkapital wird, wie angesprochen, um den Firmenwert, das Disagio und die latenten Steuern (jeweils 500 T€) gekürzt. Darüber hinaus wird die geplante Ausschüttung in Höhe von 1.500 T€ vom Eigenkapital in das kurzfristige Fremdkapital umgegliedert. | |||
 | Im langfristigen Fremdkapital werden neben den Pensionsrückstellungen und den Anleihen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 800 T€ ausgewiesen. | |||
 | Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die in zwei Jahren fällig werden, sind im mittelfristigen Fremdkapital auszuweisen. | |||
 | Das kurzfristige Fremdkapital setzt sich wie folgt zusammen: | |||

4. Bewegungsbilanz
39
Veränderungsbilanz
Wird eine Kapitalflussrechnung erstellt, ist die Aufstellung einer Bewegungsbilanz zielführend. Die Vorstufe einer Bewegungsbilanz ist eine Veränderungsbilanz. In letzterer werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzposten durch Vergleich zweier aufeinander folgender Jahresabschlüsse dargestellt und durch Umgliederung auf die entsprechende Bilanzseite gebracht. Diese dynamische Betrachtungsweise führt dazu, dass sich auf der linken Seite einer Veränderungsbilanz Aktivmehrungen und Passivminderungen und auf der rechten Seite Aktivminderungen und Passivmehrungen wieder finden.
40
Mittelverwendung, Mittelherkunft
Durch die Bewegungsbilanz werden die Werte der Veränderungsbilanz finanzwirtschaftlich strukturiert dargestellt. Die Aktivmehrungen und Passivminderungen (linke Seite der Veränderungsbilanz) werden als Mittelverwendung, die Aktivminderungen und Passivmehrungen (rechte Seite der Veränderungsbilanz) werden als Mittelherkunft bezeichnet. Eine Bewegungsbilanz hat somit folgendes vereinfachtes Bild:

Materiell sind die Veränderungs- und die Bewegungsbilanz identisch. Dies führt dazu, dass die Begriffe häufig synonym verwendet werden.
Beispiel
Ihnen liegt folgende Bilanz der A-AG vor (Werte in T€):

Aufgabe
Erstellen Sie eine Bewegungsbilanz. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 50 T€ durch den Jahresüberschuss veranlasst ist. Der restliche Betrag (100 T€) resultiert aus einer Kapitalerhöhung.

41Neben den beiden Hauptmerkmalen Mittelverwendung und Mittelherkunft kann eine Bewegungsbilanz je nach Zielsetzung auf verschiedene Arten untergliedert werden. Häufig sind Untergliederungen nach der Finanzierungsart (Innen- und Außenfinanzierung bzw. Eigen- und Fremdfinanzierung) sowie nach verschiedenen Verwendungsarten (Investitionstätigkeit, Schuldentilgung, Ausschüttungen) gefordert.
4.1 Bewegungsbilanz unter Berücksichtigung der Fristigkeiten
42
Bewegungsbilanz mit Fristigkeiten
Hier werden die einzelnen Positionen der Bewegungsbilanz in Hinblick auf die jeweilige Fristigkeit dargestellt, sodass tiefer gehende Analysen möglich sind.
Beispiel
Fortsetzung aus Tz. 40:
Eine feinere Untergliederung der Bewegungsbilanz hätte folgendes Bild:

43
Cashflow (Praktikermethode)
Im Rahmen der Erstellung der Bewegungsbilanz werden oftmals bestimmte Arten von Bestandsveränderungen mit den entsprechenden Aufwands- und Ertragspositionen aus der GuV gekoppelt, sodass sich der Cashflow (= Geldfluss) ermitteln lässt. Der Cashflow lässt sich u. a. wie folgt ermitteln:

Diese Berechnungsmethode wird als indirekte Methode (auch Praktikermethode) bezeichnet.
4.2 Kapitalflussrechnung
44
Erweiterung des Cashflows zur Kapitalflussrechnung
Ziel der Kapitalflussrechnung ist es, den Zahlungsmittelstrom eines Unternehmens transparent zu machen. Die Kapitalflussrechnung ist eine Fortentwicklung des Cashflows. Der Cashflow wird um Zahlengrößen erweitert, die sich nur in der Bilanz, aber nicht in der GuV niederschlagen. Man erhält hierdurch präzisere Aussagen über die Mittelverwendung. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der Liquidität und der sie bestimmenden Größen in Form von Ein- und Auszahlungen während des Abrechnungszeitraums.
45
Finanzmittelfonds als Mittelpunkt
Im Mittelpunkt der Kapitalflussrechnung steht ein Finanzmittelfonds, der grundsätzlich aus den liquiden Mitteln und den sonstigen Wertpapieren des Umlaufvermögens gespeist wird. In der sog. Fondsänderungsrechnung wird die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln dargestellt. Dieser Wert ist der Saldo aus dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres.
Die gewonnenen Beträge werden in der Ursachenrechnung, die sich in die Bereiche
 | laufende Geschäftstätigkeit, | |||
 | Investitionsbereich und dem | |||
 | Bereich der Finanzierungsaktivitäten | |||
untergliedert, erläutert.
Im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ergeben sich in der Regel Überschüsse der Einzahlungen über die Auszahlungen. Diese werden betriebliche Nettoeinnahmen genannt. Im Investitionsbereich werden dagegen die Auszahlungen überwiegen. Vergleicht man die Salden dieser beiden Bereiche, ergibt sich ein Finanzbedarf oder ein Finanzüberschuss.
Im Bereich der Finanzierungsaktivitäten – auch Kapitalbereich genannt – wird gezeigt, wie durch Außenfinanzierungsmaßnahmen ein Bedarf gedeckt oder ein Überschuss verwendet wird. Eine verbleibende Differenz führt zu einer Änderung des Finanzmittelfonds. Die Richtigkeit dieser Änderung kann durch einen Vergleich der Bilanzpositionen für liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens nachgeprüft werden.
Die Darstellung der Kapitalflussrechnung beinhaltet folglich zwei Bereiche:
 | Fondsveränderungsrechnung und | |||
 | Ursachenrechnung. | |||
Die IFRS-Regelungen zur Kapitalflussrechnung finden sich in IAS 7.
Beispiel
Ihnen liegt die bereits bekannte Bilanz der A-AG vor (Werte in T€):

Zu dieser erhalten Sie folgende ergänzenden Informationen:
 | Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen haben im Berichtsjahr 500 T€ betragen. | |||
 | Im Berichtsjahr wurden Sachanlagen mit einem Restbuchwert von 20 T€ für 60 T€ verkauft. | |||
 | Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres beträgt 50 T€. | |||
 | Im Berichtsjahr fand eine Kapitalerhöhung (100 T€) statt. | |||
 | Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 420 T€ wurde in voller Höhe ausgeschüttet. | |||
Aufgabe
Erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung.


Der Bestand der finanziellen Mittel entwickelt sich wie folgt:

5. Gewinn- und Verlustrechnung – nach Erfolgsquellen strukturiert
46
GKV/UKV
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Basis der Analyse der Ertragslage. Sie kann sowohl nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB, IAS 1.102) als auch nach dem Umsatzkostenverfahren (§ 275 Abs. 3 HGB, IAS 1.103) aufgestellt werden. Die beiden Verfahren unterscheiden sich nur bis zur Größe „Betriebsergebnis“.


Bruttomethode
Die GuV wird wie die Bilanz nach der sog. Bruttomethode aufgestellt. Dies bedeutet, dass Aufwendungen nicht mit Erträgen bzw. Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite saldiert werden dürfen (§ 246 Abs. 2 Satz 1 HGB). Durch den separaten Ausweis erhöht sich die Transparenz und somit der Informationsgehalt des zu analysierenden Jahresabschlusses.
47
Erfolgsspaltung
Für Zwecke der Jahresabschlussanalyse wird die GuV vergleichbar mit der Vorgehensweise bei der Erstellung einer Strukturbilanz aufbereitet. Dieser Vorgang wird als Erfolgsspaltung bezeichnet. Deren Aufgabe ist es, das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis nach unterschiedlichen Gesichtspunkten darzustellen, um hierdurch tiefere Einblicke in die Ertragssituation des Unternehmens zu gewinnen. In Kapitel I.5.5 (Tz. 52) findet sich ein Beispiel zur Erfolgsspaltung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.