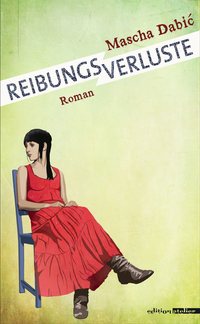Kitabı oku: «Reibungsverluste», sayfa 2
- ankommen -
Als sie ihr Ziel erreichte, war es zehn nach neun. Sie war verschwitzt, außer Atem und hätte sich am liebsten selbst dafür geohrfeigt, dass sie schon wieder zu spät kam, obwohl sie sich am Vorabend fest vorgenommen hatte, diese Woche gut und richtig anzufangen. Sie sperrte ihr Fahrrad hastig ab, stürmte in das Gebäude und rannte die drei Stockwerke hinauf. Vor der Tür blieb sie einen Augenblick lang stehen, um der Versuchung zu widerstehen, die Tür aufzureißen. Sie atmete einmal durch und trat ein.
Erika saß wie immer an ihrem Schreibtisch und begrüßte sie mit einem breiten Lächeln.
»Guten Morgen, Norotschka!«
»Hallo, Erika, bitte entschuldige die Verspätung, ich …«
Erika unterbrach sie:
»Kein Problem. Du hast sowieso eine Stehstunde. Herr Achmadow hat gerade telefonisch abgesagt. Er ist krank. Roswitha ist schon im Therapiezimmer.«
Nora holte reflexartig ihr Handy heraus.
»Ja, ich habe dich gleich angerufen und dir auf die Box gesprochen.«
»Ich hab’s nicht gehört, bin heute mit dem Rad da.«
»Bringst du uns einen Kaffee?«
Nora nickte und rang sich ein gequältes Lächeln ab. Der Stress war umsonst gewesen. Sie hätte eine Stunde länger schlafen können. Oder in aller Ruhe bei der Aida einen Kaffee geschlürft und dazu eine Nussschnecke vertilgt.
Egal, so hatte sie eben ihre sogenannte Stehstunde, eine erzwungene Wartezeit, die man ja keineswegs im Stehen verbringen musste und die immerhin elf Euro einbrachte. Besser als nichts. Außerdem war ein Kaffeeplausch mit Erika insbesondere an einem Montagmorgen nicht zu verachten. Am Wochenende erlebte Erika meistens verrückte Sachen, was montags für Unterhaltung sorgte. Nora hatte das Gefühl, dass Erika die Wochenenden dringend brauchte, um ihre Batterien aufzuladen. Kein Wunder, musste sie doch den ganzen Tag freundlich und geduldig bleiben, jedem noch so schwierigen Klienten eine verständliche Auskunft geben und die Launen sämtlicher Psychotherapeuten und Dolmetscher über sich ergehen lassen. Nora fragte sich, wie Erika das aushielt. Sie selbst arbeitete maximal drei Tage pro Woche hier, manchmal auch nur einen Tag. Alle Psychotherapeuten und Dolmetscher arbeiteten so, stundenweise oder tageweise. Nur Erika war von Montag bis Freitag im Haus. Sie bildete das soziale Kernstück des Zentrums, an ihrem Tisch liefen alle Fäden zusammen, bei ihr wurde getratscht, gelästert und gejammert, Honorarnoten wurden ausgefüllt, in dringenden Fällen Tampons, Nagellackentferner und Handcreme geschnorrt, und der Kaffee, ja, ohne Kaffee ging gar nichts.
Nora war schon fast wieder bei der Treppe, als ihr einfiel, dass sie vergessen hatte nachzufragen, welchen Kaffee Erika heute wollte. Sie kehrte um und steckte ihren Kopf durch die Tür:
»Automat, Filter oder Kanne?«
»Automat. So, wie er rauskommt«, antwortete Erika.
Nora grinste verschwörerisch und machte auf dem Absatz kehrt. Erika und Nora hielten große Stücke auf den neuen Kaffeeautomaten, was von allen anderen Kollegen im Büro mit Kopfschütteln bedacht wurde. Sie griffen nur im Notfall darauf zurück, wenn die Milch im Kühlschrank der Gemeinschaftsküche abgelaufen oder das Kaffeepulver aufgebraucht war. Erika und Nora dagegen machten sich einen Spaß draus, jedes Mal eine andere Sorte im Angebot auszuprobieren und für die jeweilige Geschmacksrichtung Punkte zu vergeben.
Auf dem Weg zum Automaten im ersten Stock sinnierte Nora darüber, ob es möglich wäre, eine Statistik über Vornamen von Sekretärinnen aufzutreiben. Bestimmt war es nur selektive Wahrnehmung, aber sie hatte den Eindruck, dass der Name Erika überproportional vertreten war. In der Caritas-Stelle im vierten Bezirk, wo sie mittwochs arbeitete, hieß die Sekretärin auch Erika, ebenso die Sekretärin in der Volkshochschule, wo Nora Russisch für Anfänger unterrichtete, und wenn ihr Gedächtnis sie nicht täuschte, hatte in ihrem ersten Studienabschnitt einer von den vier Sekretariatsdrachen am Institut für Politikwissenschaft ebenfalls Erika geheißen. Konnte das ein Zufall sein? Oder war es so, dass Namen bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge verstärkten und sich deshalb überdurchschnittlich viele Gleichnamige in einem Berufsfeld tummelten? Erika klang nach Ordnung, Zuverlässigkeit und einer gewissen Strenge, wenn es drauf ankam. Eine Erika passte hervorragend in jedes Büro, der Name bürgte für Sicherheit. Nach Noras Beobachtung lautete das russische Pendant dazu Svetlana.
Roswitha dagegen war ein typischer Name für eine Psychotherapeutin, und zwar für eine von denen, die zu ihrem mütterlich-verständnisvollen Lächeln und ausladenden Kurven gerne große bunte Schals und auffällige Broschen trugen. Roswitha oder Lydia, diese Namen suggerierten Vertrauen und Geborgenheit. Die eher hölzern-abstinent wirkenden Psychoanalytikerinnen hörten wiederum gerne auf solche Namen wie Gertrud oder Hedwig.
Was ihren eigenen Namen betraf, so hatte Nora seit ihren Teenagertagen darauf gesetzt, dass ihr kurzer, prägnanter und im Übrigen weltberühmter Nachname Kant sie mit einer gehörigen Durchsetzungskraft ausstatten würde. Nora Kant, das klang doch kantig, zackig, resch. Hence the name. Kurz und prägnant, wie Dora Maar oder Anaïs Nin. Spätestens im zweiten Studienabschnitt musste sie sich jedoch eingestehen, dass in ihrem Fall die Magie des Namens versagt hatte. Seit sie als Dolmetscherin für Russisch arbeitete, wurde sie ohnehin von vielen verniedlichend Norka oder Norotschka genannt, was ihrem verschusselten Charakter viel eher gerecht wurde, wie sie sich selbst widerwillig eingestehen musste. Außerdem bedeutete Norka auf Russisch Nerz, und als Nora klar wurde, dass sie also mit einem Spitznamen herumlief, der ein Tier bezeichnete, aus dessen Fell schicke Hauben und Mäntel für neureiche Damen hergestellt wurden, wunderte es sie nicht mehr, dass sie in Russland von niemandem ernstgenommen wurde. An ganz düsteren Tagen, die sich vor dem Dreißiger gehäuft hatten, also an solchen Tagen, an denen es Selbstvorwürfe bar jeglicher Selbstironie hagelte, tauchte in ihrer Fantasie von irgendwoher die unheilvolle Überschrift »Norotschka oder ein Puppenleben« auf, mit der sie nichts anzufangen wusste und die sich nur mit einer starken Kopfschmerztablette in Kombination mit einem gut gekühlten Bier verscheuchen ließ.
Erikas heutiger Favorit war also Cappuccino, »so wie er rauskommt«. Nora hatte Lust auf Cappuccino mit Haselnuss. Mit einem Plastikbecher in jeder Hand versuchte Nora, die schwere Glastür mit der rechten Schulter aufzustoßen und verschüttete dabei ein wenig Haselnusscappuccino über ihre Hand.
»Scheiße!«
»Scheiße sagt man nicht«, ließ sich eine Kinderstimme von hinten vernehmen.
Nora drehte den Kopf. Die Stimme gehörte zu einem kleinen Jungen, etwa fünf Jahre alt, der in Socken auf dem Gang stand und Nora aus seinen großen dunkelbraunen Augen ernst anblickte. Offenbar wohnte der Kleine im Haus.
»Entschuldigung«, sagte Nora und lächelte verlegen. Ernst dreinblickende kleine Kinder nötigten ihr Respekt ab.
»Stimmt, so etwas sagt man nicht. Wie heißt du? Wo ist deine Mama?«
»Und wie heißt du?«
»Ich heiße Nora. Und du?«
»Ich heiße Jusuf.«
»Und wo ist deine Mama?«
»Ich habe keine Mama. Mein Papa ist beim Arzt. Meine Schwester ist da«, sagte Jusuf und deutete mit dem Kopf zu einer halb offenen Tür, die zu einer Wohneinheit führte. Im ersten Stock gab es einige Wohnungen für Familien, im zweiten Stock waren alleinstehende Männer untergebracht, auf Russisch Odinotschki genannt, und im dritten Stock befanden sich diverse Büros, in denen Sozialarbeit, Rechtsberatung, Sprachkurse und Psychotherapie angeboten wurde. Wenn Nora im Wohnbereich ihren Automatenkaffee holte, kam sie sich wie ein Eindringling vor. Sie fühlte sich an ihre Zeiten im Internat und in diversen Studentenheimen und WGs erinnerte, wo man vom Bad bis zum eigenen Zimmer einen Korridor durchqueren musste, was kleidungstechnisch mit einem logistischen Aufwand verbunden war. Erst in Vladimirs Wohnung war es für sie nach vielen Jahren wieder möglich gewesen, den Weg vom Bad bis zum Kleiderschrank nackt oder nur in ein Handtuch gewickelt zurücklegen. Für sie war es damals der ultimative Beweis dafür, endlich angekommen zu sein, was immer das bedeutete.
Im ersten Stock sah Nora manchmal Männer und Frauen mit nassen Haaren, in Schlafröcken oder Jogginganzügen, mit verschlossenen Gesichtern, Menschen, die so aussahen, als sei ihnen das Warten auf den Asylbescheid in jede Faser des Körpers eingeschrieben, als habe ihre gesamte Existenz den Aggregatzustand des Wartens angenommen. Auf den ersten Blick wirkten die im Haus wohnenden Kinder anders, sie konnten laut und verspielt sein, aber Nora hatte manchmal den Eindruck, dass sie das kindliche Verhalten zum Teil aus reinem Pflichtgefühl an den Tag legten, weil man es von ihnen erwartete. Schaute man den Kleinen etwas länger zu, hatte man das Gefühl, dass ihnen die Angst und die Unsicherheit der Erwachsenen keineswegs fremd waren.
Nora schaute den kleinen Jusuf an. Mit seinen rotbesockten Füßen, von denen eine Micky Maus heruntergrinste, stand er ruhig da und schaute zurück. Nora zwang sich zu einem kinderfreundlichen Lächeln.
»Gehst du in den Kindergarten?«
»Ja.«
»Dort gefällt es dir, ja?«
»Ja.«
»Jusuf! Juuusuuuf!!« – rief eine Stimme aus dem Zimmer. Ein etwa zwölfjähriges Mädchen mit rotblonden Haaren kam heraus und sagte im raschen Tempo einige Sätze auf Tschetschenisch, die nach Schimpfen klangen. Nora hörte nur ein russisches Wort heraus, komnata für Zimmer, ansonsten blieb ihr der Wortschwall mit den vielen Kehllauten vollkommen unverständlich, aber auch so war klar, dass hier eine ältere Schwester ihren kleinen Bruder zurechtwies. Jusuf warf Nora noch einen letzten ernsten Blick zu, dann drehte er sich um, trippelte folgsam ins Zimmer und war einen Augenblick später hinter der blassgrünen Plastiktür verschwunden.
Nora stieß noch einmal die schwere Glastür mit der Schulter auf und stieg die zwei Stockwerke hinauf, sorgfältig darauf bedacht, diesmal keinen Kaffee zu verschütten. Mit dem rechten Ellbogen drückte sie die Türklinke hinunter und stieß die Tür auf.
»Danke, bist ein Schatz!«, sagte Erika und nahm ihren Kaffee entgegen.
»Tschick?«, fragte Nora und deutete mit dem Kopf zur Teeküche. »Rauchst du noch? Oder schon wieder?«
»Eigentlich schon seit fünf Tagen aufgehört, aber heute mache ich eine Ausnahme.«
»Auf keinen Fall! Ich will dich nicht verführen!«
»Ach was, verführ mich …«, sagte Erika schnurrend und griff nach ihrer magischen Schublade, die Nora als »Erikas Mary-Poppins-Tasche« bezeichnete, weil sie alles enthielt, was man im Büroalltag gebrauchen konnte. Mit einer geschickten Bewegung zog Erika eine Packung extralanger Damenzigaretten und ein knallgelbes Feuerzeug heraus.
In der Teeküche setzten sich die beiden an den kleinen Tisch am Fenster, Erika gab Nora Feuer und zündete dann ihre überlange schmale Zigarette an.
»Also, erzähl mal. Liest du wieder?«
»Nein. Ich sagte doch, drei Monate Lesestreik. Da bin ich konsequenter als du mit deinem Rauchen«, sagte Nora und lachte, während sie genüsslich den Rauch durch die Nase ausblies.
»Na wart nur, irgendwann sitzt du beim Zahnarzt und greifst nach einer Zeitschrift, und dann liest du dort eine Buchbesprechung, und dann, wirst sehen, dann rennst du nach Haus und stürzt dich auf das erstbeste Buch und liest die ganze Nacht durch. So wird’s sein! Das schau ich mir dann an, deinen Lesestreik!«, sagte Erika und versuchte vergeblich, mit den Lippen den Rauch zu einem Ring zu formen.
»Und was gibt’s sonst bei dir? Hast du wieder Kontakt mit Vladimir? Und was ist mit diesem anderen, diesem Timothy? Kommt er dich jetzt besuchen oder nicht?«
»Vladimir hat mir zum Geburtstag eine SMS geschickt, aber ich habe nicht geantwortet. Interessiert mich nicht.«
Erika nahm einen Schluck von ihrem Cappuccino, nickte anerkennend und sagte: »Glatte fünf Punkte.«
»Timothy kommt angeblich Ende des Monats nach Wien«, sagte Nora, »aber das glaub ich erst, wenn ich ihn wirklich vor mir seh. Der hat schon zwei Mal kurzfristig abgesagt, weißt du noch? Letztes Mal hatte er angeblich einen Bänderriss. Ich glaub kein Wort davon. Akutes Manierenversagen nenn ich so was. Diesmal überleg ich ernsthaft, ob ich nicht selbst kurzfristig absagen soll. Einfach so, aus Rache.«
»Scheiß auf Rache, davon hast du nichts. Sieh lieber zu, dass du ein schönes Wochenende mit ihm verbringst. Bist ja noch jung. Genieß das Leben, solang du noch keine eigene Familie hast.«
»Meine liebe Erika, wenn ich so weitermache, kann ich die Kinderkriegerei und das ganze Familiendings sowieso vergessen«, lachte Nora und stocherte mit ihrer Zigarettenspitze vorsichtig im Aschenbecher herum.
»Und, ist das ein Problem?«
»Nicht wirklich.«
»Na siehst du. Bist ja noch jung. Red keinen Unsinn, das kommt noch alles.«
»Aber sicher nicht mit Tim, das steht fest. Alles, was ich so quasi zu bieten habe« – Nora zeichnete mit ihren Fingern ausladende Gänsefüßchen in die Luft –, »das hat er schon, glaub mir. Schöner, größer, besser. In seinem Universum bin ich kein Fixstern, das sag ich dir. Allenfalls so ein kleiner Trabant«, sagte Nora und lachte bitter.
»Jetzt hörst du aber sofort auf mit diesem Scheiß! So was will ich gar nicht hören. Mit dir kann man überhaupt nicht über Männer reden! Du siehst immer alles so melodramatisch!«
»Das kommt von der Überdosis an russischer Literatur. Aber damit ist ja jetzt Schluss«, rechtfertigte sich Nora. »Keine Sorge, ich werd mich schon nicht vor einen Zug werfen, wenn Mister Timothy nicht auftaucht.«
»Na, das will ich hoffen. Aber jetzt mal etwas ganz anderes, was ist eigentlich mit diesem FWF-Antrag?«
»Frag lieber nicht. Keine Ahnung. Wir warten noch.«
»Ich drück dir die Daumen.«
»Weiß nicht so recht. Vielleicht war das alles keine so gute Idee. Stell dir vor, wir kriegen das Projekt. Was dann? Dann muss ich mich jahrelang mit EU-Russland-Beziehungen herumschlagen, und Ukraine-Krise, und die Krim, und Russlands Beteiligung in Syrien, und irgendwelche Dokumente analysieren, Politikerreden interpretieren und so ein Zeug. Ich frag mich, will ich das überhaupt?«
»Na, das hättest du dir aber vorher überlegen müssen, meine Liebe.«
»So ist es. Ganz genau so«, sagte Nora resigniert, drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher und zündete sich sofort die nächste an.
»Und was ist mit dir? Hast du dich mit Bernhard versöhnt?«
»Ja, hab ich. Stell dir vor, am Wochenende waren wir in einer Therme in Ungarn, super war das, ich sag’s dir, urromantisch …«
Plötzlich ging die Tür auf, und Roswitha steckte ihren Lockenkopf durch.
»Entschuldigung, da ist jemand am Apparat. Nora, gehst du bitte ran, ich glaub, es ist Russisch.«
Nora sprang von ihrem Stuhl auf, drückte ihre Zigarette aus und eilte zum Telefon. Es war Frau Sultanowa, die sich dringend einen Termin wünschte, möglichst noch heute, es sei ein Notfall. Nora gab die Information an Roswitha weiter, diese schaute in ihren Kalender und fragte Nora:
»Bis wann kannst du heute?«
»Open end«, antwortete Nora, ohne zu überlegen, und hätte sich in diesem Augenblick am liebsten auf die Zunge gebissen.
»Okay, dann hängen wir einfach eine Stunde an. Sag ihr, sie kann um 17 Uhr kommen.«
Nora gab den Termin durch und legte auf. Sie würde also mindestens bis 18 Uhr bleiben müssen. Nora verfluchte sich für ihre unbedachte, in vorauseilender Hilfsbereitschaft getroffene Zusage.
Roswitha lächelte.
»Danke. Der Herr Achmadow hat uns ja mal wieder versetzt. Wer weiß, was es diesmal schon wieder ist.«
»Vielleicht hat er eine Arbeit gefunden …?«, warf Nora ein und ärgerte sich wieder über ihre Gedankenlosigkeit. Bei den meisten Psychotherapeuten musste man auf der Hut sein, so viel hatte Nora schon begriffen. Erst seit etwas mehr als einem Jahr war sie mit dieser Berufsgruppe konfrontiert und fühlte sich in der betriebsinternen Kommunikation noch nicht ganz wohl. Die Art, wie die Psychotherapeuten untereinander über die Patienten oder »Klienten« sprachen, gab ihr Rätsel auf. Manchmal klang es wie banaler Tratsch, dann wieder hatte Nora das Gefühl, dass in jedes Wort des Klienten viel zu viel hineininterpretiert wurde, und manchmal wusste sie einfach gar nicht, was sie von dem ganzen Laden halten sollte. Ihr war bewusst, dass da mehr dahinterstecken musste, aber dass sie selbst noch nicht ganz darauf gekommen war, worum es eigentlich ging und welche Begriffe mit welchen Bedeutungen aufgeladen waren. Alles in allem fühlte sich das psychotherapeutische Terrain für Nora wie ein verbales Minenfeld an, auf dem man nicht oft genug den Mund halten konnte. Erika war ihr da eine große Hilfe. Sie konnte in klaren Worten und mit wohldosierter Ironie die Macken und Vorlieben jeder Therapeutin umreißen, sodass Nora in etwa wissen konnte, woran sie bei wem war.
»Nein, das meinte ich nicht, ob er eine Arbeit gefunden hat oder nicht«, konterte Roswitha auch schon, und Nora beschlich schon wieder dieses ungute Gefühl, etwas Banales und Überflüssiges gesagt zu haben. Si tacuisses, Norotschka …
»Ich denke, es geht um etwas anderes. Weißt du noch, vor zwei Wochen hat er zum ersten Mal wirklich über seine Foltererfahrungen gesprochen. Das ist ihm jetzt wahrscheinlich unangenehm, und deshalb bleibt er uns jetzt eine Weile fern. Aber ich denke, er wird wiederkommen.«
Und ich denke, er hat letztes Mal erwähnt, dass er vermutlich bald eine Arbeit als Hausmeister bekommt und dass er dann nicht mehr regelmäßig kommen kann, dachte Nora, sagte diesmal aber nichts, sondern nickte nur vage.
- übersetzen -
Roswitha kramte in ihrer bunten Filztasche und holte einige Formulare heraus, die in einer blassrosa Aktenhülle steckten.
»Übrigens, wenn du schon da bist, könntest du mir bitte schnell ein paar Fallberichte ins Englische übersetzen? Das wäre ganz lieb. Ist für die UNO, du weißt schon.«
Ja, Nora wusste. Das waren diese haarsträubenden Folterberichte, die der Verein jedes Jahr in einer bestimmten Anzahl an die UNO schicken musste, um weiterhin Subventionen zu erhalten. Die UNO, das war für Nora in den Teenagerjahren und in den frühen Zwanzigern eine Oase der Völkerverständigung und des Weltfriedens gewesen. Ein UNO-Praktikum in New York war ihr während ihres Studiums der Politikwissenschaft als das höchste der Gefühle erschienen, und es war nichts anderes als die allzu große Ehrfurcht vor dieser einzigartigen globalen Institution, die sie damals daran gehindert hatte, konkrete Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Seit sie als Dolmetscherin mit Folterüberlebenden arbeitete, hatte sie die banale bürokratische Seite der UNO kennengelernt, mit Formularen und Statistiken. In den Telefonaten mit Genf ging es um board meetings, bei denen über die Subventionen entschieden wurde, und als eines Tages eine hübsche junge UNO-Mitarbeiterin hereingeschneit kam, um sich den subventionierten Laden vor Ort anzusehen, da hatte sich bei Nora in die aufrichtige Bewunderung gegenüber der weltgewandten vielsprachigen Dame auch eine Prise Erleichterung eingemischt, dass sie, Nora, diesen Weg der globalen Bürokratie doch nicht beschritten hatte. Vielleicht waren es aber auch nur saure Trauben, dachte Nora später, wer konnte schon wissen, welche Tricks das Gehirn mobilisierte, um sich die momentane Misere schönzureden.
Nora hasste es, diese Case Studies zu übersetzen, die »Käs-Staddis«, wie Erika schrieb, wenn sie die ausgefüllten Formulare per Mail an Nora verschickte. Die Berichte wurden zwar anonymisiert, aber häufig gelang es Nora, die Foltergeschichten einigen bekannten Klienten zuzuordnen.
Sie fand es verstörend, wie sich eine Lebensgeschichte, die sich in vielen intensiven Gesprächen wie ein Mosaik allmählich zusammenzusetzen begann, in der Sprache der Bürokratie auf eine »Foltergeschichte« reduzieren ließ, die wiederum in ihre Einzelteile zergliedert wurde – Anzahl und Funktion der Täter, Häufigkeit der Folterung, angewandte Methoden und Werkzeuge, physische und psychische Folgeerscheinungen. Aus dem Menschen, an dessen Lippen sie Stunde um Stunde gehangen war, um Sinn und Ausdruck so vollständig und unverfälscht wie möglich aufzunehmen, wurde im Formular ein »Opfer« oder ein »Überlebender«, alles kompakt auf maximal drei formatierte A4-Seiten zusammengefasst. Das Formular wurde dann in englischer Übersetzung nach Genf in ein UNO-Gebäude geschickt, wo es wohl in einem Büro auf einem Tisch landete, anschließend mit den anderen Formularen in eine Mappe geheftet wurde, um beim nächsten board meeting von einer wohlgesonnenen UNO-Mitarbeiterin als Beleg dafür verwendet zu werden, warum ausgerechnet dieser Verein weitere Subventionen erhalten sollte.
Nora bereitete es Unbehagen, wenn sie diese Berichte übersetzen sollte, weil es ihr paradoxerweise viel schwerer fiel, die kompakte, schwarz auf weiß abgefasste Foltergeschichte zu ertragen als die gestammelte, hervorgepresste oder unter Tränen in einem Wortschwall nach außen drängende Erzählung in der Therapiestunde. Wenn Folter oder Vergewaltigung zum Thema in der Therapie wurden, und früher oder später war das bei jedem Klienten der Fall, dann hielt sich Nora krampfhaft an ihrer Wahrnehmung fest, studierte aufmerksam den Gesichtsausdruck des Klienten, starrte auf die in sich zusammengesackte Topfpflanze am Fenster, trank einen Schluck Wasser, betrachtete die Hände des Klienten oder fummelte selbst an einem Taschentuch herum, konzentrierte sich auf das Dolmetschen, auf diesen alchemischen Prozess, im Zuge dessen das Gesagte in einer bestimmten Wortkombination durch den Gehörgang in ihren Kopf eindrang und in einer anderen Form, möglichst unbeschadet und so wenig wie möglich durch Reibungsverluste in Mitleidenschaft gezogen, durch den Mund wieder verließ. Der etwaige Schaden, den der Kanal, also Noras Kopf, durch diese Transaktion möglicherweise nahm, interessierte nicht. Reibungslos sollte die Kommunikation ablaufen, das war das Ideal, keine Reibung, keine Verluste. Dabei waren Reibungsverluste nichts anderes als Wärme, genau genommen die Umwandlung von Bewegungsenergie in Wärmeenergie, das wusste Nora noch aus dem Physikunterricht, aber die Sprache entzog sich wohl diesen Gesetzmäßigkeiten, und Wärme entstand manchmal erst dort, wo Sprache aufhörte.
Wenn die kritischen Augenblicke vorüber waren, spürte Nora gemeinsam mit dem Klienten die Erleichterung darüber, dass das Unsagbare schließlich doch noch ausgesprochen worden war und sogar den Weg in eine andere Sprache gefunden hatte, sie war froh, daran mitgewirkt zu haben, dass diese Worte nach außen drängen konnten, wo sie gut aufgehoben waren, wo sie nicht, wie sie es etwa bei der Polizei oder bei Gericht erlebt hatte, jederzeit gegen den erschöpften Sprecher verwendet werden konnten und auf etwaige Widersprüche abgeklopft wurden.
Nach solchen Therapiestunden fühlte sich Nora angesteckt und beschmutzt von einem Grauen, von dem sie nichts wissen wollte, durchdrungen vom sicheren Wissen darum, dass Menschen einander entsetzliche Dinge antaten, und zwar nicht irgendwelche Menschen irgendwo irgendwann, sondern da, hier, saß ein solcher Mensch, dem so etwas angetan worden war, ein Mensch, der nicht nur Opfer, sondern auch Zeuge der Grausamkeiten war, die ein Krieg produzierte oder aber, da war sich Nora nicht ganz sicher, bloß zum Vorschein brachte.
Und nicht immer waren es Opfer. Manchmal hatte es Nora auch mit Tätern zu tun gehabt, das waren Soldaten oder Freiheitskämpfer, Bojewiki, bullige Männer mit militärischem Aussehen, die gemordet und gefoltert hatten und deren Erzählungen über den Krieg sich in vagen Andeutungen erschöpften. Solchen Tätermännern Kopf und Stimme zur Verfügung zu stellen, kostete Nora nicht wenig Überwindung, aber manchmal ertappte sie sich auch bei dem Gedanken, dass einige dieser Täter selbst Opfer des Krieges waren und dass sie unter normalen Umständen Sportlehrer, Handwerker oder Installateure geworden wären und ihre Muskelkraft für friedliche Zwecke eingesetzt hätten. Da sie aber nun einmal in einer Zeit lebten, in der ein Gewehrschuss den nächsten nach sich gezogen hatte, waren aus diesen Männern im Handumdrehen Bewaffnete geworden, und die Ereignisse hatten unaufhaltsam ihren Lauf genommen.
Trotz aufrichtigen Bemühens, sich auch in die Lage von Soldaten und Kämpfern hineinzuversetzen, arbeitete Nora nur ungern mit solchen Männern zusammen. Alles in ihr sträubte sich dagegen, bei solchen Männern »ich« sagen zu müssen, »ich habe für die Unabhängigkeit gekämpft«, »ich habe gegen die russischen Soldaten gekämpft«, »ich habe mich in Wäldern versteckt«, »ich habe Essen und Medikamente für die Truppe besorgt«, aber sie tat es, sie überwand sich, sie sagte »ich«, wenn der Mann über sich selbst sprach. Meinte der Mann aber sie, Nora, die Perewodtschiza, formten ihre Lippen reflexartig das Wort »die Dolmetscherin« oder »unsere Dolmetscherin«, und ihre Stimme hörte sich fremd an.
Selbst wenn ein solcher Mann geknickt oder schluchzend vor ihr saß und keine Spur von Brutalität ausstrahlte, musste Nora an rohe, männliche Gewalt denken, an dieses unbegreifliche Phänomen, das von Menschen ausgeübt wurde und dem zugleich genau diese Menschen und auch andere, unbeteiligte, zum Opfer fielen und das immer und immer wieder nach einem ähnlichen Muster ablief, zu allen Zeiten, an allen Orten. Sollte die pure Grausamkeit tatsächlich in allen Menschen schlummern? War es nur dem Zufall geschuldet, ob einer zum Täter oder zum Opfer oder zu beidem wurde? War das sogenannte Böse nur eine Frage der Konstellation und der Dynamik? Hatten Männer in Kriegszeiten wirklich nur die Wahl, Helden oder Verräter, Freiheitskämpfer oder Terroristen zu werden, gab es da so wenig dazwischen? Wenn einer einfach feig war, musste das dann bedeuten, dass er Verrat beging? Verrat an wem oder an was? Beim Dolmetschen schwirrten solche Gedanken immer in einem Teil von Noras Kopf umher, weil alle Geschichten, mit denen sie als Dolmetscherin zu tun hatte, so unverwechselbar und einzigartig sie auch waren, zugleich Teil eines größeren, unerbittlichen Zusammenhangs waren, aus dem es kein Entrinnen gab, für niemanden. Eine unbarmherzige Kraft war über alle diese Menschen hinweggefegt und hatte sie niedergetrampelt, und zugleich waren manche Männer, mit denen Nora arbeitete, auch Teil dieser gewaltigen Kraft gewesen, wenn auch nur als Zahnrädchen innerhalb einer größeren Kriegsmaschinerie.
Allerorts produzierte der Krieg Ruinen und Scherbenhaufen. Das betraf die sichtbare städtische Architektur genauso wie die filigrane Struktur der Seele. Die Therapie, schlussfolgerte Nora, war so etwas wie der Wiederaufbau, ein Marshall-Plan zur Konsolidierung der verwüsteten inneren Landschaften. In den Therapiegesprächen ging es darum, die von der Wucht des Traumas in alle Richtungen geschleuderten Teilstücke aufzusammeln und sie behutsam wieder zusammenzusetzen. Nora hatte nicht den Eindruck, dass die Bruchstellen jemals ganz zusammenwachsen würden. Sie stellte sich die Psyche der Klienten wie zusammengeklebte Tongefäße vor, aber immerhin Tongefäße und hoffentlich keine Scherbenhaufen mehr. Dass diese Menschen überhaupt da waren und für ihre Erlebnisse Worte finden konnten, das allein war ein Triumph des Lebenswillens über die todbringende Zerstörung, und auch wenn sich Nora in manchen Therapiesitzungen am liebsten Augen und Ohren zugehalten hätte, schöpfte sie dennoch Kraft aus der lebendigen Anwesenheit der Klienten, aus dem Bewusstsein, dass diese Menschen allen Widrigkeiten zum Trotz, against all odds, noch immer da waren, unter uns, dass der Krieg sie nicht zermalmt hatte. In der Therapie, so reimte Nora es sich in ihren eigenen Worten zusammen, sollte es darum gehen, aus Überlebenden wieder Lebende zu machen.
Wenn Nora jedoch Fallgeschichten übersetzte, wenn sie also allein am Computer arbeitete, fiel die beruhigende Anwesenheit der anderen Menschen weg. Hatte sie einen Fallbericht zu übersetzen, war sie ganz allein mit dem Blatt Papier und mit den darauf geschriebenen Wörtern, die schwarz auf weiß die Folter und ihre zerstörerischen Langzeitfolgen beschrieben und ein für alle Mal festhielten. Verba volant, scripta manent. Nora hasste es, was diese Wörter mit ihr machten. Sie bohrten sich in ihre Stirn und ließen in ihrem Kopf Bilder entstehen, die sie nicht sehen wollte und die sich nicht verscheuchen ließen.
»Ist eh kein Problem für dich, oder?« – Roswithas Worte rissen Nora aus ihren Gedanken.
»Rauch in Ruhe aus. Kein Stress, heute kriegen wir sicher noch irgendwo eine Stehstunde, und die Fallberichte müssen erst Ende der Woche raus«, fügte Roswitha betont freundlich hinzu.
Nora nahm die Formulare und verließ wortlos den Raum Richtung Teeküche, wo ein alter Laptop stand, auf dem man in den Pausen arbeiten konnte. Roswitha sah der zierlichen Gestalt nach. War Nora etwa beleidigt? Aber wodurch denn bloß? Weil sie ein paar kurze Fallberichte übersetzen sollte? Für die sprachbegabte Norotschka war das doch ein Klacks!
Die Dolmetscher sind schon ein seltsames Volk, dachte Roswitha. Manchmal kannte sie sich mit ihnen einfach nicht aus. Als sie vor drei Jahren begonnen hatte, mit Dolmetschern zusammenzuarbeiten, hatte sie gedacht, sie würde keine zwei Wochen durchhalten. Es war unheimlich gewesen, eine dritte Person im Raum zu haben, auf die man angewiesen war, die einem auf die Finger schauen konnte und mit der man, ja, das auch, manchmal um die Aufmerksamkeit des Klienten wetteifern musste. In den letzten drei Jahren hatte Roswitha mit unterschiedlichen Dolmetschern gearbeitet, mit den sogenannten professionellen und auch mit den sogenannten Laiendolmetschern, mit deutschsprachigen und ausländischen, jungen und älteren, und immer, ausnahmslos immer hatte es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben. Kleinere oder größere, je nachdem, aber ganz reibungslos ging es nie vonstatten. Ein abgeschlossenes Dolmetschstudium war noch keine Erfolgsgarantie, das stand für Roswitha fest. Gerade die Profis taten sich oft schwer, sich auf den therapeutischen Prozess einzulassen und in einem Nachgespräch ihre Gefühle und Eindrücke mitzuteilen. Nora war so ein Fall. Zwar war sie keine ausgebildete Dolmetscherin, aber sie kam aus dem universitären Umfeld, hatte ein gutes Sprachgefühl und verstand sich darauf, um die passenden Ausdrücke zu ringen. Zumindest musste man ihr nicht erklären, warum es wichtig war, sich um sprachliche Feinheiten zu bemühen. Aber wie so viele andere Dolmetscher aus dem akademischen Bereich nahm Nora manchmal eine abwehrende Haltung ein und sperrte sich gegen jede Art von Besprechung. Als Roswitha sie zu Beginn ihrer Zusammenarbeit gebeten hatte, »alles wortwörtlich zu übersetzen«, hatte Nora wie eine fauchende Katze erwidert: »Erstens heißt es im mündlichen Modus dolmetschen und nicht übersetzen, und zweitens gibt es kein wortwörtliches Übersetzen – beziehungsweise: So etwas gibt’s schon, aber das klingt dann so, wie wenn man sagt ›I understand only railway station‹ für ›ich verstehe nur Bahnhof‹.« Roswitha hatte sich seitdem gehütet, übersetzen und dolmetschen synonym zu verwenden, und »wortwörtliches Übersetzen« war ihr nicht mehr über die Lippen gekommen. In der Stunde gab es mit Nora so gut wie keine Probleme, sie hatte sehr schnell gelernt, Distanz zu wahren, ohne dabei unfreundlich zu wirken, und was das Dolmetschen anbelangte, war Roswitha zufrieden, soweit sie es beurteilen konnte, aber nach den Stunden wollte zwischen den beiden keine rechte Vertrautheit aufkommen. Nora hielt sich bedeckt, und Roswitha beschlich das Gefühl, dass ihre Dolmetscherin keine besonders gute Meinung von der Psychotherapie hatte. Einmal hatte Roswitha zufällig ein Gespräch zwischen Nora und Erika in der Teeküche mitangehört und hatte gedacht, ja, so sollte unser Gesprächsklima sein, dann könnten wir viel besser miteinander arbeiten, aber sobald sie den Raum betreten hatte, war Nora schlagartig verstummt, und ihr Gesicht hatte wieder den Ausdruck unverbindlicher Professionalität angenommen. Roswitha wusste aus Erfahrung, diese Haltung würde früher oder später zu einer Auseinandersetzung führen oder, noch schlimmer, zu einem stillschweigenden Auseinanderdriften, und irgendwann würde die Dolmetscherin von einem Tag auf den anderen weg sein. Auf diese Weise hatte sie schon zwei Dolmetscher verloren, eben weil sie die Signale ignoriert hatte. Was soll man sonst noch alles machen … Es war schon schwierig genug mit den Klienten und ihren Geschichten, und dann noch die Sprachbarriere – wie sollte man sich dann auch noch um die Befindlichkeiten der Dolmetscherin kümmern? Mit Nora hatte sie im Großen und Ganzen Glück, sie war zuverlässig und unauffällig. Aber irgendetwas schien an ihr zu nagen, und dieses Etwas würde sich früher oder später massiv bemerkbar machen. Roswitha wusste nicht viel über Noras Leben und ihre Motivation, als Dolmetscherin zu arbeiten, aber sie ahnte, dass sie den Job eher aus Verlegenheit als aus Eigenantrieb angenommen hatte. Vielleicht war das des Rätsels Lösung, schlicht mangelndes Interesse. Nicht gerade gut, aber immer noch besser als überbordende Hilfsbereitschaft, dachte Roswitha. Nichts war ärgerlicher als eine Dolmetscherin mit akutem Helferkomplex. Was hatte sie sich da schon geärgert über Dolmetscherinnen, die in ihrer Freizeit mit den Klienten alle möglichen Ämter abklapperten und als Möchtegern-Sozialarbeiterinnen ihr Unwesen trieben.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.