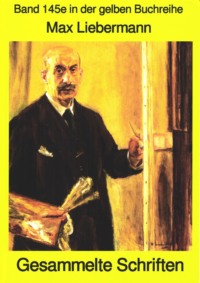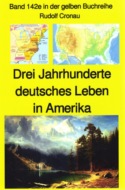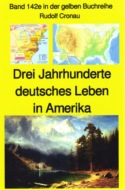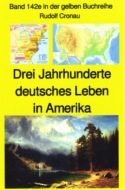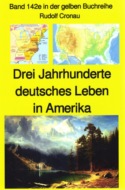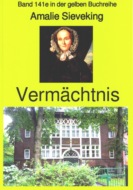Kitabı oku: «Max Liebermann: Gesammelte Schriften», sayfa 3
Die Bilder der Düsseldorfer oder Münchener Genremaler könnten, ohne Wesentliches einzubüßen, auch grau in grau gemalt sein; ja sogar reproduziert erscheinen sie koloristischer als im Original, weil die Reproduktion die Feinheit der Charakteristik wiedergibt, während die Mängel in der Farbe, die dem Original anhaften, verschwinden. Bei Israëls hingegen ist die Farbe ein integrierender Bestandteil der Bilder, er charakterisiert mit der Farbe; die Farbe ist ein ihm notwendiges Ausdrucksmittel, nicht eine mehr oder weniger überflüssige Zugabe; er geht von der malerischen Erscheinung aus.
Als gelegentlich der internationalen Ausstellung von 1896 Israëls als Juror nach Berlin kam, traf er Menzel vor seinem Bild „Der Kampf ums Dasein“, zwei Fischer, den Anker aus dem Meere ziehend. Nach den obligaten Komplimenten meinte Menzel, das Bild sei nicht gleichmäßig genug durchgeführt, Israëls hätte das den Hintergrund bildende Meer fleißiger durcharbeiten müssen, überhaupt sei das ganze Bild nicht „fertig“ genug.
Ich führe dies Geschichtchen, das mir Israëls selbst lachend erzählte, an, weil der Vorwurf, den Menzel darin unserem Meister macht, stets von der älteren Richtung der modernen gemacht wird: dass sie sich mit einer zu skizzenhaften Ausführung begnüge.
Schon Rembrandt schrieb, „dass Bilder nicht dazu gemalt wären, um berochen zu werden“. Auch dem Haarlemer Publikum schienen die Porträts von Frans Hals wohl zu skizzenhaft, sonst wäre der Meister nicht in bitterster Armut gestorben. Ich glaube, das Publikum sieht Kunstfertigkeit für Vollendung an, ohne zu ahnen, dass eleganter Vortrag und virtuose Mache nur untergeordnete Fingerfertigkeiten sind gegen die wahre künstlerische Durchbildung. Als ob der stupendeste Klaviervirtuose, der mit der glänzendsten Technik Tonleitern spielt, deshalb der größte Musiker wäre.
Es soll nicht etwa geleugnet werden, dass die Beherrschung der technischen Ausdrucksmittel für den Künstler von großem Wert ist, aber es versteht sich von selbst, dass jeder sein Handwerk ordentlich gelernt hat. Ein Kunstwerk ist vollendet, wenn der Maler das, was er hat ausdrücken wollen, ausgedrückt hat. Eine Zeichnung in wenigen Strichen und in wenigen Minuten hingeworfen, kann in sich ebenso vollendet sein, als ein Bild, woran der Maler jahrelang gearbeitet hat. Israëls arbeitet in seiner Weise seine Bilder gerade so durch wie Menzel, aber er erstrebt etwas anderes als jener. Es ist klar, dass die Malerei, welche den großen Eindruck der Natur wiedergeben will, das Detail der allgemeinen Erscheinung unterordnen muss, aber vollendet sie deswegen weniger? Ist ein Kopf von Velasquez weniger vollendet als einer von van Eyck? Im Gegenteil, Velasquez vollendet mehr, wenn er auch die tausend Fältchen der Haut, die Eyck mit wunderbarem Fleiß und hingebender Liebe malt, unterdrückt, denn er kommt dem Eindruck der Natur – und das ist doch die Aufgabe der Malerei – näher. Die moderne Malerei sucht nicht den Gegenstand wiederzugeben, sondern die Reflexe der Luft und des Lichtes auf die Gegenstände. Genau dasselbe, was die eigentlichen Maler unter den Alten auch gemacht haben.
Überhaupt ist es fast komisch, zu sehen, dass gerade die ältere Richtung gegen die Modernen stets die Alten ins Feld führt, ohne zu bemerken, dass die Modernen den Alten viel näher stehen als sie. Unter dem Firnis und der Patina der Jahrhunderte sehen sie nicht mehr das Wesen. Es ist kein Zufall, dass gerade die Kunstgelehrten, die von der alten Kunst herkommen, die Bode, Bayersdorfer, Tschudi, Seidlitz, Lichtwark und wie sie alle heißen, zu einer Zeit, als man für die moderne Richtung nur Spott und Hohn hatte, sich ihrer angenommen haben. Sie erkannten aus dem Studium der alten Kunst deren Verwandtschaft mit der neuen, dass die moderne Kunst dasselbe Ziel erstrebte, was eine jede Kunst erstreben muss; die individuelle Naturauffassung. Hierin sollen uns die alten Meister Vorbilder sein – nicht in ihren Äußerlichkeiten.
Es ist ein Unsinn, einen Bismarck malen zu wollen, der wie von Rembrandt oder Velasques gemalt aussieht.
Neben der zu skizzenhaften Ausführung wirft man Israëls und der modernen Richtung überhaupt mangelhafte Zeichnung vor. Weil Israëls das Hauptgewicht auf die Malerei legt, zeichnet er deshalb noch nicht schlecht. Gerade so wie ein schlecht gemaltes Bild deshalb noch nicht gut gezeichnet ist. Der Kontur macht nicht etwa die Zeichnung aus, und Velasquez zeichnet nicht etwa schlechter als Dürer und Holbein, weil er statt des Konturs, die den malerischen Eindruck zerstören würde, die Töne flächenartig aneinandersetzt. Gerade im Gegenteil; je vollendeter ein Bild gemalt ist, das heißt je näher es dem Eindruck der Natur kommt, desto besser muss es gezeichnet sein; sonst würde dieser Eindruck nicht hervorgerufen werden. Je näher die Hieroglyphe der Natur kommt – und alle bildende Kunst ist Hieroglyphe – desto besser muss sie gezeichnet sein.

Allein in der Welt . Jozef Israëls, 1881
Israëls liebt die Dämmerung, wenn die Konturen der Gegenstände ineinander verschwimmen; das Enveloppierte zieht er dem Bestimmten vor, das Träumerische der Abendstunde der grellen Sonne, das Geheimnisvolle, das uns mehr ahnen als sehen lässt, in einer nur ihm allein gehörenden Technik: kaum ein fetter Strich im Bilde, nichts Materielles, alles durchgeistigt, keine Farbe, alles Ton; das Ganze mehr auf die Leinwand hingehaucht als gemalt.

Jozef Israëls Jüdische Hochzeit
Was ich aber vor allem an ihm liebe, ist sein Temperament. Wenn ich es nicht wüsste, jedes seiner Werke würde es mir sagen, dass er nichts auf der Welt mehr liebt als die Malerei. Nicht mit der behaglichen Liebe des Ehemanns, mit der die Metsu, Mieris oder Dou malen, sondern mit der heißen, ungestümen Leidenschaft des Liebhabers schafft er seine Werke. Trotz seiner Jahre hat er sich die Seele des Jünglings bewahrt. In jedem seiner Bilder ein Ringen, jener Moment im Kampfe mit dem Engel, wo Jakob sagt; „ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ Er arbeitet mit höchster Konzentration aller seiner Kraft, während er arbeitet, ganz dabei, alles andere vergessend. „Wie der Handelnde“, nach Nietzsches Ausspruch: „wissenlos. Er vergisst das, was hinter ihm liegt, und kennt nur ein Recht: das Recht dessen, was jetzt werden soll.“ Unzufrieden übermalt er oft in ein paar Stunden das ganze Bild, an dem er monatelang gearbeitet hat, mit größter Rücksichtslosigkeit ganze Stücke, die vollendet waren, opfernd; aber dadurch gibt er dem Bilde jene Frische wieder, die wir an der Skizze bewundern, jene Frische, die durch langes Überarbeiten dem Bilde abhandenkommt und nur durch flüssiges ineinander Malen erzielt werden kann.
Israëls ist aus den kleinsten Verhältnissen emporgewachsen. Mühevoll musste er sich in Amsterdam, wo er sich nach seinen Wanderjahren festsetzte, mit Porträtmalen seinen Unterhalt verdienen. Auch darin Rembrandt ähnlich, wohnte er im Judenviertel, und oft genug, wenn er an dem Hause vorüberging, in dem sein großer geistiger Vorfahre gewohnt und gearbeitet hatte, wird er sich aus seiner Misere an ihm emporgerichtet haben. Rembrandt wurde sein Erzieher. Wie Rembrandt, so entnimmt Israëls die Anregung zu jedem Bilde, zu jeder flüchtigsten Zeichnung, der Natur. Aber wieder wie Rembrandt kopiert er sie nicht, sondern er verarbeitet sie zum Kunstwerk.
Je naturalistischer eine Kunst sein will, desto weniger wird sie in ihren Mitteln naturalistisch sein dürfen. Der Darsteller des Wallenstein, der – wie bei den Meiningern – im echten Koller und Reiterstiefeln aus der Zeit auftritt, macht nicht etwa dadurch einen wahren Eindruck: Der Schauspieler muss seine Rolle so spielen, dass wir glauben, er stecke in echtem Koller und Reiterstiefeln. Israëls wirkt naturalistischer als unsre Genremaler, nicht obgleich, sondern weil er weniger naturalistisch malt als sie; was wir umso deutlicher sehen können, als er sich oft im Sujet mit ihnen begegnet. Nehmen wir zum Beispiel die „Salomonische Weisheit“ von Knaus – eins der meist bewunderten, und mit Recht bewunderten Bilder der deutschen Genremalerei – und daneben Israëls' „Ein Sohn des alten Volkes“.

Ein Sohn des alten Volkes
Knaus zeigt uns einen alten Juden, wie er sein Enkelkind in die Geheimnisse des Trödelhandwerks einweiht; köstliche Figuren, jeder kleinste Zug, jede Bewegung der Natur abgelauscht und bis in die feinsten Details wiedergegeben. Bei Israëls dagegen nur eine Figur: ein armer Jude, einfach, ohne jede Bewegung vor seinem Trödelladen sitzend. Das ganze Bild liegt in dem Ausdruck des Kopfes, alles andere durch ein paar Farbenflecken kaum angedeutet. Aber in dem Antlitz des Mannes, der die Hände ineinander gefaltet ruhig dasitzt, verspüren wir den tausendjährigen Schmerz, von dem Heine singt.
Die deutschen Genremaler illustrieren mehr ihren Gegenstand; sie suchen mehr das Anekdotische, die charakteristische Zufälligkeit. Israëls hingegen unterdrückt alles Detail; er sucht das Typische; statt der verstandesmäßigen Analyse die dichterische Synthese.
Weil Israëls' Bilder mehr wahr gedacht, als wahr gemacht sind, wirken sie wahrer. Den Beweis für die Wahrheit seiner Kunst kann der Maler nur dadurch erbringen, dass er uns überzeugt. Bis dahin lachen wir ihn aus. Die sprichwörtliche Dummheit des Publikums, einen großen Künstler bei seinem Auftreten verkannt zu haben, besteht in nichts weiter, als dass es eine Sprache nicht verstanden hat, die es noch nicht gelernt hatte. Oft leider ist der Künstler dem Publikum um Generationen voraus: Millet oder Manet haben ihren Ruhm nicht mehr erlebt. Israëls hatte das Glück, schon bei Lebzeiten verstanden zu werden. Freilich drückte er sich in der allgemein verständlichen Sprache des Herzens aus; er schlug die Töne des Gemüts an, die jedem vertraut sind. Seine Popularität verdankt er – wie jeder Künstler – seinen Sujets; seine Berühmtheit aber – und man kann sehr populär sein, ohne berühmt zu sein und umgekehrt – verdankt er seinem Genius.
Es ist das charakteristische Merkmal des Genies, dass seine Äußerung als notwendig empfunden wird. Israëls' Bilder erscheinen uns heut notwendig: es musste ein Künstler die Schönheiten Hollands, die seit den alten Meistern gleichsam brach lagen, wieder von neuem entdecken.
Mit Recht hat man Holland das Land der Malerei par excellence genannt, und es ist kein Zufall, dass Rembrandt ein Holländer war. Die Nebel, die aus dem Wasser emporsteigen und alles wie mit einem durchsichtigen Schleier umfluten, verleihen dem Lande das spezifisch Malerische; die wässerige Atmosphäre lässt die Härte der Konturen verschwinden und gibt der Luft den weichen, silbrig-grauen Ton; die grellen Lokalfarben werden gedämpft, die Schwere der Schatten wird aufgelöst durch farbige Reflexe: alles erscheint wie in Licht und Luft gebadet. Dazu die Ebene, die das Auge meilenweit ungehindert schweifen lässt, und die mit ihren Abstufungen vom kräftigsten Grün im Vordergrunde bis zu den zartesten Tönen am Horizont für die Malerei wie geschaffen erscheint. Vielleicht ist Italien an und für sich pittoresker als Holland; aber wir sehen Italien nur noch in mehr oder weniger schlechten – und meistenteils mehr schlechten – italienischen Veduten: Italien ist zu pittoresk. Holland dagegen erscheint auf den ersten Blick langweilig: wir müssen erst seine heimlichen Schönheiten entdecken. In der Intimität liegt seine Schönheit. Und wie das Land so seine Leute; nichts Lautes, keine Pose oder Phrase.
Mit der ganzen Innerlichkeit seiner Nation und seiner Rasse versenkt sich Israëls in die Natur, dorthin, wo sich die Äußerungen des Gefühlslebens am naivsten zeigen: in das Leben der Armen und Elenden. Wohl mit Voreingenommenheit für sie, aber nicht etwa in tendenziöser Weise wie der politische Parteigänger. Israëls schildert die Mühe und Arbeit wie der Psalmendichter, der das Leben köstlich nennt, wenn es Mühe und Arbeit gewesen. Aus Israëls spricht Versöhnung, etwas von der heiteren Ruhe des Philosophen, der alles verzeiht, weil er alles versteht.
Nichts liegt Israëls ferner als die Brutalität, und fast sind wir geneigt, in der Epoche von Bismarck und Nietzsche einen gewissen Zusatz von Brutalität für ein notwendiges Ingrediens des Genies zu halten.
Israëls ist kein Übermensch, und – was heutzutage seltener – er will keiner sein. – Mensch-sein genügt ihm.
Nichts Harmloseres als die Erlebnisse und Begebenheiten, die er in seinem Buch „Spanien“ erzählt. Der Reiz beruht allein in der Persönlichkeit des Verfassers. Auf die Frage, wie er zu seinem schönen, klaren Stil gekommen, antwortete Goethe: „Ganz einfach; ich ließ die Verhältnisse auf mich wirken und suchte den passendsten Ausdruck, sie darzustellen.“ Israëls' Werke sind – was die Werke eines jeden Künstlers sein sollten – der Reflex seiner Seele. Schlicht und ungeschminkt malt er – ganz unoffiziell, nicht wie „der berühmte Meister“. Die Einfachheit ist sein Stil; er gebraucht nicht zehn Worte, wo er mit einem auskommen kann; die charakteristische ist ihm die schöne Linie; seine Kunst ist dekorativ, aber keine Dekoration. Was er nicht klar auszudrücken vermag, scheint ihm, wie, ich weiß nicht welcher Franzose sagt, nicht klar gedacht zu sein.
An Möricke schrieb Schwind 1867; „spricht der ganz trocken aus, ein Bild soll gar nichts vorstellen, bloß Malerei – der soll sich wundern, was die in ein paar Jahren für ein Geschmier hervorbringen“.
Heut nach dreißig Jahren hat sich „das Geschmier“, welches Schwind schaudernd vorahnte, die Welt erobert: die Errungenschaften des Impressionismus sind zum Gemeingut der Malerei geworden. Es soll nicht etwa geleugnet werden, dass der Impressionismus über Israëls hinausging, aber nimmt ihm das auch nur ein Tüpfelchen von seiner Bedeutung? Wäre er – Israëls, wenn Manet ihn hätte beeinflussen können? Liegt nicht in seiner Einseitigkeit dem Impressionismus gegenüber der Beweis für die Kraft seiner Überzeugung?
Israëls malt noch – Bilder; Bilder mit literarischem Inhalt. Ihm ist die Malerei noch Mittel zum Zweck, sie ist ihm das Werkzeug zur Wiedergabe seiner Empfindungen. Er will nicht den Innenraum malen, sondern, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Psychologie des Raumes. Er malt den Kessel mit dem singenden Wasser oder das knisternde Feuer auf dem Herde, um die Heimlichkeit des Stübchens auszudrücken. Manet malt, was ihn malerisch reizt. Ihm ist die Malerei Endzweck.
Nur in den technischen Ausdrucksmitteln kann man von einem Fortschritt in der Kunst reden; die Kunst als solche schreitet nicht fort. So oft sich eine Persönlichkeit in ihr offenbart hat, ist sie am Ziele angelangt. So kann man von Raffael oder Rembrandt sagen, dass sie vollendet waren, und insofern können wir es nicht besser machen wollen. Aber wir können etwas anderes wollen, denn die Kunst ist unendlich wie die Welt; sie ist die Welt. Es führen viele Wege nach Rom, aber jeder Künstler muss seinen eigenen gehen.
„In meines Vaters Hause sind viel Wohnungen“ wie in der Religion, so in der Kunst. Und wie jeder wahrhaft Fromme, welchen Bekenntnisses er auch auf Erden gewesen, in den Himmel, so wird jede wahrhaft künstlerische Persönlichkeit, in welcher Richtung sie sich auch dokumentiert haben möge, zur Unsterblichkeit eingehen.
* * *
Zwei Holzschnitte von Manet
Zwei Holzschnitte von Manet

Édouard Manet
„Kunst und Künstler“, 1905
... einen erläuternden Text zu den wunderschönen Reproduktionen nach Manet? Cui bono? Wer Manet versteht – und ihn daher liebt – braucht keine Erläuterungen, und wer ihn nicht versteht, noch viel weniger.
Auch Holzstöcke scheinen ihr Schicksal zu haben. Während der Holzschnitt der Olympia erst wieder durch Duret ans Tageslicht gezogen wurde, ist das Porträt der Dame, die den Kopf auf die Hand stützt, verschwunden gewesen: ebenso wie die Olympia hatte Manet das Porträt für ein Journal gezeichnet, das vor der Veröffentlichung der Zeichnung einging. Der Holzstock ist verloren gegangen und nur ein Probedruck hatte sich erhalten und nach ihm hat derselbe Xylograph, der seinerzeit Manets Zeichnung geschnitten, einen zweiten Holzstock hergestellt. Beide Holzschnitte sind im Original wiedergegeben: Wir haben also Manets Handschrift vor uns. –

Édouard Manet Holzschnitt „Pariserin“

Wenn ich früher einmal Zeichnen als die Kunst wegzulassen definiert habe, so könnte ich keine besseren Beispiele für diese Definition auswählen, als die vorliegenden beiden Holzschnitte.
Alle Kunst ist Form und alle Form: Vereinfachung.
Wie die tausend Formen und Flächen des Gegenstandes, den der Künstler darstellen will, sich in seinem Kopfe zu wenigen, charakterischen vereinfachen, während seine Hand sie niederschreibt: das bildet den Zeugungsprozess eines jeden Kunstwerkes. Weder der Kopf allein, noch die Hand ohne Kopf können ein Kunstwerk hervorbringen; beides ist, wie die Seele mit dem Körper, verbunden. Der Kopf ist der Vater, die Hand die Mutter und nur die aus dieser Ehe hervorgegangenen Kinder sind legitim, das heißt echte Kunstwerke.
Aber in den bildenden Künsten sind Inhalt und Form nicht nur, wie in den anderen Künsten, untrennbar, sie sind auch in der philosophischen Bedeutung des Wortes identisch; ihr Inhalt ist die Form.
Natürlich können Malerei, Plastik oder Architektur – die man sogar gefrorene Musik genannt hat – poetische oder musikalische Gefühle in uns hervorrufen, aber sie dürfen sie nur durch die einer jeden der bildenden Künste eigenen Ausdrucksmittel hervorrufen wollen. Sonst macht der Maler oder Bildhauer bei der Poesie oder Musik Anleihen, die er mit den rechtmäßigen Mitteln seiner Kunst nicht bezahlen kann.
Manet ist „Nur-Maler“. Er malt ebenso wenig Poesie wie Musik, worüber die sogenannten Gebildeten aller Nationen quittierten, indem sie ihn gleichermaßen verabscheuten, und wohl immer noch verabscheuen, wenn sie sich jetzt auch schämen, es einzugestehen.
Manet so recht verstehen kann wohl nur der Maler, und auch nur der, welcher in der Wiedergabe der Natur das A und O der Malerei sieht; was freilich der moderne Maljüngling, und noch mehr der moderne Kunstskribifax für einen überwundenen Standpunkt hält. Wie jener Maler, den einer fragte, warum er aus einem Naturalisten ein Symbolist geworden, antwortete: „nach der Natur malen ist zu leicht“. Ja! nach der Natur malen kann heutzutage fast jeder Malklassenschüler, beinahe so gut wie Manet, jedenfalls viel zu viel à la Manet.
Und sind doch keine Manets worden!
Bei der Wahl seiner Themata – er malt einen Schinken oder ein Blumenbukett, Pfirsiche oder eine Melone, Fische oder eine Brioche, Porträts, männliche und weibliche, oder einen Akt wie die Olympia – ist es klar, dass das Außergewöhnliche nicht in seinen Sujets liegt.
Manets Kunst beruht also, wie die eines jeden echten Malers, in seiner neuen Auffassung. Der eigentliche Maler sucht nichts Neues zu malen, sondern das Alte neu zu malen. Überhaupt ist es ganz gleichgültig, ob der Künstler ein schon tausendmal dargestelltes Thema behandelt oder ein funkelnagelneues – was übrigens schwer zu finden sein dürfte –, da es in der Kunst nur darauf ankommt, dass das Thema in persönlicher und daher neuer Weise dargestellt wird. Wenn einer einen Rosenstrauß oder einen Schinken so persönlich wie Manet zur Darstellung bringen kann, so ist er, wie es in der Kunstgeschichte heißt, ein bahnbrechendes Genie: denn indem er neue Reize an dem Schinken entdeckt und dargestellt hat, hat er das Bereich der Malerei erweitert.
Der Maler sucht überhaupt nicht, sondern er findet. Er empfängt, wie Schiller von Goethe sagt, sein Gesetz vom Objekt. Tausend Maler haben einen liegenden Akt oder ein Damenporträt gemalt; dass Manet den Akt oder das Porträt in dieser Einfachheit sah und für diese Vereinfachung die adäquate Form fand, darin liegt sein Genie.
Nicht in seiner Malfaust, sondern in seiner malerischen Phantasie liegt seine Größe. Er sieht malerisch; er weiß aus dem Frauenkörper das Typische herauszuholen, ohne die momentanen und zufälligen Reize, die die Natur bietet, einzubüßen. Er malt nicht nur, wie der „akademische Maler“, was er gelernt hat, was er kann, sondern wie der wahre geborene Maler, was er sieht. Aber er ist auch ein Poet dazu, denn die Idee „verdichtet“ sich unter seinem Pinsel zur plastischen Form. Daher das Verblüffende des Eindrucks eines jeden Striches Manetscher Kunst; die Form, die er uns zeigt, hat nur er gesehen. Es ist daher der größte Unsinn, Manets Bedeutung in seiner Technik zu sehen, wie wir's täglich zu lesen bekommen, – und welcher Unsinn würde nicht gedruckt! – als wäre er ein virtuoser Maler gewesen, nur ein äußerlicher Kopist der Natur.

Édouard Manet: Olympia – 1863
Man vergleiche nur einen nach der Natur fotografierten Akt mit der Olympia, um – was aus dem Bilde natürlich noch viel deutlicher als aus dem Holzschnitte hervorgeht – zu erkennen, dass nie ein Maler einen Frauenkörper weniger von der Natur „abgeschrieben“ hat: Weder Tizian noch Rembrandt noch Velazquez hat einen Akt persönlicher aufgefasst.
Aber ebenso wenig wie die Natur hat Manet die Alten kopiert. Die liegende Venus des Velazquez in der Sammlung Morrit hat viel mehr Verwandtschaft mit Tizian, als die Olympia mit Velazquez.
Manet hat mehr als je ein Maler vor ihm oder nach ihm die konventionelle „schöne Form“ vermieden: Die ganze Pose, die Linie, der Rhythmus in der Bewegung – um von der Malerei ganz zu schweigen – sind in der Olympia ebenso wie in dem Damenporträt so momentan, so ungezwungen, als hätte er das Modell in einem unbelauschten Augenblicke gesehen und gemalt. Daher das Überraschende, das Frappierende, das wir beim ersten Anblick jeder Arbeit von Manets Hand, sei es Ölbild, Pastell, Aquarell, sei's Radierung, Lithographie oder Zeichnung, die Empfindung haben, als hätten wir ähnliches nie zuvor gesehen.
Und dieses Wunder sollte die Hand vollbringen können? Nein, nur der Geist vermag Geist zu erzeugen, nicht aber die Hand oder gar der Körperteil, der uns von der Natur zum Sitzen gegeben ist. Manets Technik, weit davon entfernt, Virtuosität zu sein, ist – wie es bei jedem echten Künstler sein muss – der Ausfluss und der Ausdruck des innerlich Geschauten. Nach der Vorschrift, die der alte Hippokrates dem Arzte gibt, lässt uns Manet aus dem Sichtbaren das Unsichtbare erkennen. Wie der wahre Maler geht er stets von der Erscheinung aus, nicht aber – wie das leider nicht nur bei deutschen Künstlern geschieht – umgekehrt, sucht er für den Gedanken die plastische Form. Er will nicht große, philosophische Gedanken in Malerei umsetzen, sondern er sucht das Einfachste, was freilich das Schwerste, – die Natürlichkeit und – mit einer leichten Umschreibung der Worte Mercks an Goethe – möcht ich sagen: er sucht nicht das sogenannt „Malerische“, sondern er fasst das Leben malerisch auf: die höchste Aufgabe des malenden Künstlers.
Es versteht sich von selbst, dass der Maler desto mehr die Ausdrucksmittel seiner Kunst beherrschen muss, je mehr er sich auf die Malerei beschränkt, d. h. je mehr er auf literarischen Inhalt verzichtet und wir müssen schon bis auf Velazquez und F. Hals zurückgehen, um einen „Malermeister“ wie Manet zu finden.
Aber selbst Justi, der berühmte Verfasser des Velazquez, nennt noch Manet in seinem Pamphlet gegen die moderne Kunst (das, obgleich, oder richtiger, weil es nur als Manuskript gedruckt ist, in aller Händen ist) einen geistreichen Skizzisten. Was freilich nicht geschimpft ist, wenn damit gesagt sein soll, dass Manets Bilder die Frische der Skizze, die leider im Bilde fast immer verloren geht, bewahren.
In der Skizze feiert der Künstler die Brautnacht mit seinem Werke; mit der ersten Leidenschaft und mit der Konzentration aller seiner Kräfte ergießt er in die Skizze, was ihm im Geiste vorgeschwebt hat, und er erzeugt im Rausche der Begeisterung, was keine Mühe und Arbeit ersetzen können. Im längeren Zusammenleben mit seinem Werke erkaltet die Liebe, und der Künstler sieht zu seinem Schrecken, dass das Bild nicht hält, was die Skizze versprochen hat.
Aber Justi verbindet mit dem Worte „Skizze“ einen Vorwurf: Er meint: dass Manet – und die moderne Kunst überhaupt – keine vollendeten Werke geschaffen hat. Freilich hat Manet seine Bilder nicht vollendet wie Metsu, Mieris oder Meissonier. Aber hat er deshalb weniger vollendet? Ist etwa die berühmte Kürassier-Attacke von Meissonier durchgeführter? Allerdings sieht man jedes Hufeisen der Pferde, jedes Glanzlicht auf der Nase der Reiter, jeden Strohhalm des Kornfeldes. Nur leider fehlt die Hauptsache: das Stürmen und Dahersausen der Kürassiere, es fehlt das „hurre, hurre, hopp, hopp, hopp, ging's fort im sausenden Galopp“. Wie Manet ebenso treffend wie boshaft vor dem Bilde sagte: alles ist wie aus Erz, bis auf die – Kürasse. In einem Bildchen, nicht größer als ein Viertel Quadratmeter hat Manet ein Wettrennen gemalt. Drei oder vier Jokeys, ganz von vorn gesehen, die auf den Beschauer losjagen. Man fühlt das Vorbeisausen der Pferde, wie die Jokeys sie zur höchsten Schnelligkeit im Laufe anspornen und obgleich man kaum die Beine der Pferde oder die Köpfe der Reiter sieht, ist Manets Bild im Eindruck viel vollendeter als das Meissoniers, wo jeder Pferdehuf, ja fast jeder Nagel im Hufe zu sehen ist.
Freilich malt Manet nicht wie Velazquez, und das ist ein Glück, denn sonst hätten wir ein Genie weniger und nur einen lumpigen Nachahmer mehr. Manet hat uns etwas Eignes zu sagen: Daher hat er seine eigne Sprache, die zu verstehen wir erst lernen müssen, denn nur das Gemeine wird allgemein und sogleich verstanden. Er malt keine Kunststücke, sondern Kunstwerke; keine Spur von Kalligraphie.
Ausführung heißt nicht Ausführlichkeit. Kunst gibt nicht breite Bettelsuppe, sondern Extrakt. Manet macht keinen Strich zu viel, aber auch keinen zu wenig, ein jeder ist notwendig. Man betrachte die beiden Holzschnitte: jeder Strich „zieht“; er modelliert mit dem Kontur, mit der Linie weiß er das Schwellende des Körpers wiederzugeben, mit zwei dunklen Punkten das Funkelnde der Augen. Der Körper leuchtet. Und die Verteilung von Schwarz und Weiß: der ganze Raum ist angefüllt von „Licht und Luft und bewegendem Leben“ – daher die Größe des Eindruckes auch bei dem kleinsten Format.
Darin beruht die Poesie der wahren Malerei: mit den ihr eigenen Ausdrucksmitteln, d. h. mit der Zeichnung und Farbe das Gefühl von Licht und Luft uns vorzuzaubern; sonst ist sie vielleicht Poesie oder Musik, keinesfalls aber Malerei.
Wie jeder wahre Maler, ist Manet vom höchsten sinnlichen Reize. Die Mathematik in seiner Kunst ist völlig versteckt. Aber hinter der scheinbaren Zufälligkeit verbirgt sich die vollkommenste Kunst der Komposition und die Kultur der Holländer, Spanier und – last not least – der Japaner.
Was er macht, ist eine Freude, anzuschauen; jedem Material weiß er seinen geheimsten Zauber zu entlocken: welche Sattheit der Farbe, welche Fülle des Tons selbst in diesen kleinen Schwarz-Weiß-Blättchen; diese Kraft und dabei die Zartheit! Die wunderbaren Aktzeichnungen Rembrandts im Amsterdamer Kupferstichkabinett fallen mir ein: nur Rembrandt wusste mit so wenigem so viel zu geben!
Und das sollte keine Kunst sein? Weil die Alten es anders gemacht haben?
Wer das behauptet, beweist nur, dass er von alter Kunst ebenso wenig versteht wie von moderner.
Denn es gibt nur eine Kunst: die lebt, ob sie alt ist oder modern. Was jung geblieben an der alten Kunst, wird an der modernen Kunst jung bleiben. Das übrige veraltet.
Wer aber an der alten Kunst anderes schätzt als das Leben, läuft Gefahr, nicht das Werk der alten Meister zu schätzen, sondern in den meisten Fällen nur das Werk des Restaurators.
* * *
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.