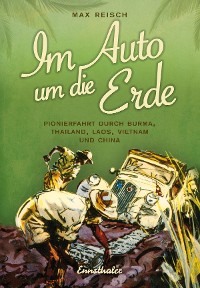Kitabı oku: «Im Auto um die Erde», sayfa 4
Dichterworte und dichter Staub
Das Grabmal des Dichters • Ein Kleinod hinter Lehmmauern •
Nächtlicher Sandsturm und eine Reifenpanne • Gastmahl in Nischapur •
Persischer Knigge
»Viele gingen schon den letzten Gang, den schweren,
zurück kam keiner, Wahrheit uns zu lehren.
Hüt dich in dieser Herberg Welt vor dem Begehren,
lass nichts zurück, nie wirst du wiederkehren.«
Aus weiter Ferne schon sahen wir im Dunst der Wüste die Kuppel jenes Bauwerks bläulich schimmern, das dem Besucher diesen Spruch mahnend entgegenhält. Es ist das Grabmal Omar Chajjams, das für mich am schönsten und vollkommensten alles verkörpert, was man sich unter »orientalischem Zauber« nur irgend vorstellen kann. Chaj-jam heißt »Zeltmacher«. Dieser Beiname muss sich auf ein sehr frühes Stadium seines Lebens beziehen, denn später wurde Omar Astrologe, Weiser und vor allem Schöpfer einer blühenden Fülle lyrischer Strophen, die immer noch im persischen Volk lebendig sind und nicht nur für dieses Volk, sondern für alle Menschen eine verständliche, zu Herzen gehende Sprache sprechen.
Seinem großen Sohn hat Persien im 14. Jahrhundert, etwa dreihundert Jahre nach seinem Tod, eine unvergleichliche Gedenkstätte geschaffen. Wir fahren an einer unscheinbaren, aus Lehmziegeln bestehenden Mauer entlang und niemand würde vermuten, welches Kleinod sich dahinter verbirgt. Aber schon das geschmiedete Gittertor, das den ersten Blick in das Innere eines lieblichen Gartens freigibt, ist ein vollendetes Kunstwerk. Es öffnet sich, fünfzig Meter trennen uns von der Hauptfassade des Grabmals und dieser fünfzig Meter lange Weg ist umrahmt von Blumenbeeten in den leuchtendsten Farben, Rosen, Narzissen, Zyklamen, tief goldgelben Dotterblumen, Stiefmütterchen und viele andere Arten, deren Namen mir so fremd sind wie die Blumen selbst. Die Beete formen Ornamente, arabische Schriftzeichen, den Baum des Lebens und in ihrer Mitte spielen Goldfische in einem blau glasierten Wasserbecken. Dieses einzigartige Blau wiederholt sich hundertfach am Bauwerk selbst, das Portal ist ganz aus blau glasierten Kacheln mit Arabesken, Blüten und Blumenmustern, blaue Säulchen teilen die Doppelfenster der beiden Fensterreihen oben und unten und über dem Bau schwebt zierlich und elegant geschwungen die Kuppel, ebenfalls aus glasierten Kacheln. Sie überdacht den großen Hauptraum, dessen Mauern mit Verzierungen aller Art übersät sind, Einlegearbeiten aus zugeschliffenen Steinen in allen Farben. Der Boden ist mit den herrlichsten weichen Teppichen belegt und durch bemalte Fensterscheiben fällt gedämpftes, farbiges Licht gerade auf den mächtigen Sarkophag aus rötlichem Gestein, auf dem in arabischen Lettern die Lebensgeschichte des großen Dichters verzeichnet ist. Andächtige Stille herrscht in diesem Raum, der trotz aller Buntheit, trotz überreicher Verzierung nicht unruhig wirkt und nicht überladen.
Nebenan kann man in kleineren Gemächern prachtvoll in Leder und Metall gebundene Bücher und Schriften bewundern, Sammlungen von Miniaturen, Schmuck und Specksteinschnitzereien.
Ganz benommen noch von dem Gesehenen, lassen wir uns draußen unter einem Aprikosenbaum nieder, dessen Zweige sich unter der Last der Früchte tief herunterbiegen. Der Perser, der uns begleitet, lädt mit einer Handbewegung zum Essen ein. Und sicher war es ganz im Sinn des Dichters, wenn wir angesichts seines zauberhaften Grabmals ein wenig von des Lebens Köstlichkeiten genossen. Er war sich der Vergänglichkeit aller Dinge sehr bewusst, aber gerade darum trachtete er, sie in vollen Zügen auszukosten, und seiner Liebe zum Wein danken die östlichen Sänger so reizende Verse wie diese:
»Ihr wisst, o Freunde, lange schon bedacht,
ward neu ein Hochzeitsfest bei mir gemacht:
Vernunft, die dürre, bannt’ ich aus dem Bett
und hab’ des Weinstocks Tochter hingebracht!«
Die Oase blühender Schönheit bleibt hinter uns und wieder umfängt uns die Wüste in ihrer einzigartigen Öde. Schon seit Tagen ist der Himmel bleiern grau und eine dicke, schwere Nebelschicht scheint sich beklemmend auf die Lungen zu legen. Ist es überhaupt Nebel? Nicht an die Sprüche der Dichter, wohl aber an die Worte der Bibel müssen wir jetzt denken: »Und die Sonne verdunkelte sich …« Genauso geschieht es, als der Nebel sich nun als aufgewirbelter Sand entpuppt, der pfeifend und singend über die Steppe jagt. Urplötzlich ist der Sturm gekommen, wir haben kaum noch Zeit, das Dach überzuziehen und die Seitenteile einzuhängen.
In unregelmäßigen, wirbelnden Stößen umheult der Sturm das einsame Fahrzeug in der weiten Wüste. Böen packen es an und wollen es zur Seite schleudern. Fest müssen die Hände das Lenkrad umklammern. Langsam füllt sich unsere Kabine mit Staub, der durch alle Ritzen dringt. Es gibt keinen Schutz gegen den feinen Wüstensand. Wir sind um die Film- und Photoapparate besorgt. Was wird das wieder für Überraschungen geben! Dem Vergaser wird es zu dumm, er beginnt trotz der Filter zu streiken. Mit viel Gas und gleichzeitigem Auskuppeln versuche ich immer wieder, ihm Leben einzuhauchen. Armer Motor, wie viel Staub bekommst du zu schlucken! Aber wir können die Nacht nicht hier in dieser Einöde verbringen und setzen trotz der tobenden Naturgewalten die Fahrt langsam fort. Noch immer zeigt sich kein Dorf, keine Karawanserei. Nur verlassene Ruinen ehemaliger Unterkünfte, die durch den Autoverkehr überflüssig geworden sind.
An ein Übernachten im Freien ist nicht zu denken. Wir müssen so bald als möglich ein schützendes Dach erreichen, um uns und den Wagen vor dem peitschenden, beißenden Sand zu sichern. Also weiter!
Welche Windstärke unserem Sturm zukommt, kann ich nicht sagen, aber die Windsbraut fasst den Wagen und wirft ihn oft mehrere Meter zur Seite, ohne dass die Hände am Steuer auch nur die leiseste Drehung gemacht hätten.
Sand und Salzstaub prasseln gegen die Scheiben. Im Lichtkegel der Scheinwerfer funkeln Tausende von Salzkristallen, die der wütende Sturm uns entgegenpeitscht. Heftiges Jucken wird durch Salz und Staub hervorgerufen – aber sonst ist es im Wagen ganz gemütlich. Der Rauch süßer persischer Zigaretten erfüllt die Kabine und erzeugt sogar ein gewisses Behagen. Soll doch der Sturm rasen, uns kann kaum etwas geschehen. So schlimm wird es auch mit dem Versanden der Kameras nicht sein. Gelesen hat man ja allerhand über solche Dinge, aber – na ja.
Der Wagen bahnt sich seinen Weg durch Wind und Nacht. Die Gedanken aber eilen zurück: Ich entdecke mich dabei, wie ich eine Hand löse und das Steuerrad tätschle: guter, treuer Weggefährte! Fünftausend Kilometer waren seine Reifen schon über spitzes Geröll und heißen Sand in Asien gelaufen und nicht einmal einen »Plattfuß« verzeichnet das genau geführte Bordbuch.
»Erstaunlich, welches Glück wir haben!«, sage ich zu Helmuth.
Das hätte ich nicht tun sollen. Kaum ist der Satz zu Ende, poltert und stößt es, der Wagen rollt auf der Felge.
»Das ist ja lustig«, meint Helmuth. Wir rauchen die Zigarette noch ruhig zu Ende, auf ein paar Minuten kommt es nicht an. Dann aber heraus! Der Sturm reißt uns fast zu Boden. Schwarze Nacht breitet sich um uns. Zum Überfluss ist der Absuchlampe kein Fünkchen zu entlocken. Ich setze den Wagenheber unter die Achse, schraube und schraube; aber der Wagenheber versinkt im Sand. Helmuth bringt ein Brett, jetzt hebt sich der Wagen, das Rad wird frei. Der salzige Sand peitscht gegen unsere Gesichter, läuft unter dem Hemd den Rücken hinunter. Schweiß mischt sich dazu. Die Augen schmerzen und triefen, als wir nach einer halben Stunde das Rad gewechselt haben und in den Wagen zurückklettern.
Weiter! Mit neuer Kraft stemmt sich der willige Motor gegen die feindliche Natur und spät, spät nachts fahren wir endlich in einen Ort, in eine geschützte Karawanserei ein.
Der nächste Reisetag bringt eine erfreuliche Abwechslung. Wir besuchen mit einer Empfehlung des Hauptbüros der Anglo-Iranian Oil Company in Teheran Abdul Hussein, den Benzinagenten dieser Gesellschaft in Nischapur. Ein Polizist bringt uns zu einem unscheinbaren Haus. Und wieder erleben wir wie bei Omar Chajjams Grabmal das Wunder, dass sich hinter öden, ausgedörrten Lehmmauern ein wahres Paradies verbirgt. Wasser plätschert, Blumen leuchten und duften. Der Hof ist von einer Säulenreihe umsäumt. Wider Erwarten gelangen wir in einen kleinen Palast.
Ein Diener bietet uns Platz an, wir übergeben ihm unsere Karten. Vorsorglich sind sie englisch, französisch und arabisch gedruckt. Es dauert nicht lange und der dienstbare Geist kommt zurück: Abdul Hussein lässt bitten. Wir treten ins Innere des Hauses. Der Hausherr erhebt sich von seinem Sitzkissen hinter dem niedrigen Rauchtisch. Sorgfältig studiert er den an ihn gerichteten Empfehlungsbrief. Das Schreiben ist der Länge nach in zwei Hälften geteilt: Auf der linken steht der englische, auf der rechten der persische Text. Auch dieser ist mit der Schreibmaschine abgefasst.
Abdul Hussein führt uns auf die Terrasse hinaus und wir nehmen in bequemen Stühlen nach westlicher Art Platz. Obwohl wir von stundenlanger Fahrt reichlich verstaubt sind, wagen wir doch nicht, um Wasser zu bitten, denn vorerst muss der unvermeidliche Begrüßungstee getrunken werden, der in winzigen Gläsern dargeboten wird.
Vor uns lockt der große Teich zu einem Bad, kaum können wir der Versuchung widerstehen, uns hineinzustürzen, um den Wüstenstaub vom Körper zu spülen. Herrlich wäre es – aber es ist unmöglich. »Wenn ich mir wenigstens die Hände waschen könnte«, stöhne ich zu Helmuth hinüber. Er blickt auf seine verstaubten Hände und Arme, über die der Schweiß schmutzige Rillen gezogen hat. Das Haar klebt an der Stirne, der Staub juckt auf der Kopfhaut. Körperliches und auch seelisches Unbehagen erfüllt uns, während wir immer neue Schalen Tee in uns hineingießen müssen.
Ein Diener bringt die Wasserpfeife. Verfluchtes Ding, denke ich, während ich den langen Schlauch an die Lippen führe: Waschen, waschen wollen wir uns! Das allein und sonst gar nichts! Sollen wir darum bitten? Nein, das dürfen wir nicht, es wäre vielleicht sehr unhöflich. Ergeben wir uns unserem verstaubten Schicksal!
Neue Gäste kommen: der Polizeikommandant und der Arzt. Der »Hakim« spricht etwas Deutsch, das er aus seinen medizinischen Büchern gelernt hat. »Wir sind sehr glücklich in deinem Haus«, lassen wir Abdul Hussein sagen.
Darauf er, mit verhaltener Befriedigung: »Mein Haus ist nur klein und Allah war ungnädig, dass er mich eure Ankunft nicht eher wissen ließ.« So plätschern die Lobesbeteuerungen und Entschuldigungen von unseren Lippen. Die »Nargileh« kreist, der Rauch gurgelt durch den gläsernen Wasserbehälter, um dann mit tiefen Zügen in die Lunge eingesogen zu werden. Gewaschen sind wir noch immer nicht.
So geht das einige Stunden – rauchen und Tee trinken, Tee trinken und rauchen.
Halt – jetzt tut sich was: Ein Diener bringt ein Kännchen und bleibt abwartend vor mir stehen. Ich begreife, strecke die Hände hin, reibe sie erwartungsvoll: Ein fadendünner Strahl rinnt darüber hin – und schon ist die »Reinigung« vollendet. Ich sehe eben noch, wie Helmuth ein paar Wassertropfen liebevoll in seinen ausgetrockneten Handflächen verreibt, dann hält schon der Hakim seine spitzen Finger hin. Auch er bekommt nicht mehr als einen Teelöffel voll, wie ein Wiesel eilt der Diener weiter zum Polizeioffizier und endlich zu Abdul Hussein. Die Waschung von fünf Personen hat kaum eine Minute gedauert. Doch scheint jedermann sehr zufrieden zu sein – nur wir nicht.
Mit dieser Zeremonie ist der Auftakt zum Abendmahl gegeben. Fruchtschalen werden gebracht. Leider sind wir nicht sattelfest im persischen Knigge, wissen nicht: Dürfen wir anfangen oder sollen wir noch warten. Wir entscheiden uns für das Letztere. Mit uns aber warten alle! Heimlich spähe ich nach der Uhr. Eine geschlagene Stunde sitzt die Gesellschaft vor den Schalen mit lockenden Trauben, Marillen und Granatäpfeln, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken. Die Unterhaltung beginnt langsam zu stocken. Alles scheint sich nach den Früchten zu sehnen. Der Polizeioffizier hat schon mehrmals danach geblickt, der Hakim rutscht unruhig auf seinem Sessel hin und her. Helmuth und ich tun das schon lange. Verzweifelt sogar. Wie schön war es doch gestern im »Auto-Hotel«, wo man für ein paar Krans tun und lassen konnte, was man wollte.
Abdul Hussein ist der Einzige, der Würde zu wahren versteht, lässig hat er sich zurückgelehnt, raucht aus der Nargileh. Damit aber ist die Unterhaltung ganz versiegt. Die Stimmung scheint gewitterschwül, ja geradezu feindselig zu werden. Bald muss irgendetwas geschehen, der Hakim hat mich so herausfordernd angeblickt.
»Zum Teufel noch einmal«, denke ich – und sage es auch und nicht eben leise. Mit dem Mut eines gequälten Tieres reiße ich mich hoch, greife nach der schönsten Marille und beiße herzhaft hinein.
Alles wartete auf diese befreiende Tat und wie eine Erlösung geht es durch die Reihen. In wenigen Minuten sind die Schalen geleert. In rascher Folge werden nun Reis, Hammelkeulen, Brotfladen, Eier, Hühnerhaschee und Melonen aufgetragen. Abdul Hussein lässt sich stets von mir nötigen zu essen.
So ist das also in Persien! Gewaschen aber sind wir immer noch nicht und das ausgerechnet in jener Stadt, die den Erlös aus dem Lebenswerk des größten aller persischen Dichter auf seinen Wunsch dazu verwendete, großzügige Bewässerungsanlagen zu schaffen.
Erlebt hat Firdusi, der »Paradiesische«, ihre Ausführung allerdings nicht mehr. In 60.000 Doppelversen hatte er in seinem ungeheuren Epos »Schah-name« alle alten persischen Heldensagen zusammengefasst und ihnen die unsterbliche dichterische Form gegeben. Von Sultan Mahmud I. war ihm für jeden Doppelvers ein Goldstück versprochen worden – aber seine Neider wussten den Sultan gegen ihn einzunehmen und der greise Dichter fiel in Ungnade. Spät erst erkannte der Sultan seinen Fehler. Zu spät, denn die Karawane mit den 60.000 Goldstücken, die nach Nischapur, Firdusis Heimat, unterwegs war, begegnete bei ihrem Einzug in die Stadt dem Leichenzug des Dichters. Er selbst allerdings hatte keiner äußeren Ehrung bedurft, um ewigen Ruhmes sicher zu sein, denn das Nachwort zu seinem Epos lautet:
»Wer immer Geist hat, Glauben und Verstand,
von dem werd’ ich mit Lob und Preis genannt,
der ich die Saat des Wortes ausgesät.
Ich sterbe nicht, wenn auch mein Leib vergeht!«
Fremde Teufel
Ostpersische Höhlendörfer • Meschhed • Drei Polizisten warten auf den
Zwischenfall • Helmuth sitzt im Käfig – ein Spaß für alle Beteiligten •
»Und sie haben doch ein Maschinengewehr!«
Die Straße, die jetzt so lange Zeit eintönig gerade verlief, bekommt Kurven, sie steigt und fällt, die Wüste wird hügelig. Wir nähern uns Meschhed, dem großen Pilgerort, dem Mekka der schiitischen Welt.
Auf der letzten Anhöhe zeichnen sich eine Unmenge kleiner Steinpyramiden als Silhouetten gegen den Himmel ab. Was mögen sie bedeuten? Erst als wir oben halten, finden wir die Erklärung dafür: Hier ist die Stelle, wo man Meschhed zum ersten Mal in seiner ganzen Ausdehnung überblickt. Ein Häusermeer, viele Gärten und Bäume dazwischen und alles überragend die vergoldete Kuppel der großen Moschee. Soweit man sehen kann, dehnt sich um die Stadt herum ein Gürtel blühender Felder, Pappelwälder und Dörfer. Kein Wunder, dass dieser Anblick die Pilger trifft wie eine Botschaft aus den Gefilden des Paradieses! Sie haben vielleicht wochenlange Reisen auf dem Rücken der Kamele hinter sich, nichts als Mühsal und Anstrengung, nichts als Hitze, Sand, Staub, eintönige gelbbraune Ebene, trockene Salztümpel. Und nun auf einmal liegt diese strahlende Stadt vor ihren Augen! Dieser Stunde muss ein Gedenkzeichen errichtet werden, hier muss man seinem Gott für die überstandene Mühsal danken. Und so entstehen die kleinen Steinpyramiden und daneben kleine, von niederen Mauern umgebene Plätze, wo der Gebetsteppich ausgebreitet werden kann.
Wie viele mögen nicht nur das Ende einer langen, beschwerlichen Reise hier feiern, sondern den Augenblick, wo in ihr Leben überhaupt zum ersten Mal eine Ahnung von Glanz und Herrlichkeit tritt! Wir denken an die Armseligkeit mancher Behausungen, die wir auf der Fahrt von Teheran nach Meschhed angetroffen haben.
Von ostpersischen Dörfern ist nichts zu erblicken als etwa zwei Meter hohe Kuppeln aus einer Mischung von Lehm und Stroh. Keine Gasse führt durch das Dorf, eng schließt eine Kuppel an die andere an.
Jede hat eine Öffnung in ihrer Mitte, Rauch steigt daraus auf und verrät, dass sich unterirdisch das dörfliche Leben abspielt.
In welchen Formen? Es lässt uns keine Ruhe, wir klettern erst zwischen den Kuppeln herum, dann einen engen Lichtschacht hinunter, in dem kleine Fensteröffnungen ausgespart sind. Die sogenannten Wohnungen, die wir auf diese Art erreichten, waren schrecklich! Finster, dumpf, von Rauch und einem unbeschreiblichen Gestank erfüllt. Zunächst konnten wir überhaupt nichts erkennen, so geblendet waren unsere Augen noch von der grellen Sonne, aber bald sahen wir, dass Frauen, Kinder, junge Hunde da unten auf dem Boden herumtollten und sich nur jetzt vor Staunen alle ganz still verhielten, um uns wie ein Wunder anzustarren.
Ein Mann fand sich, um uns durch dieses eigenartige Höhlendorf zu führen. Raum reihte sich an Raum; in dem einen lagen alte Leute, in Lumpen gehüllt, in dem anderen Werkzeuge und primitive Geräte, der nächste diente einer Familie als Schlaf- und Wohnraum, der vierte als Stall. Ein Fettschwanzschaf stand darin, wahrscheinlich hatte es sein gewichtiges Anhängsel verletzt, denn es trug den Schwanz in einem hölzernen Gestell auf den Rücken gebunden. Dieser Körperteil dient als »Vorratskammer« für magere Zeiten und die Tiere bieten einen grotesken Anblick, wenn sie ihn prall gefüllt hinter sich herschleppen. Die Räume des unterirdischen Dorfes waren alle durch Türlöcher miteinander verbunden, die nur selten mit einem schmutzigen Lappen verhängt wurden. Besonders heiß war es nicht, manche Räume schienen sogar irgendeinen Zugang zu frischer Zugluft zu haben – aber wir kamen uns vor wie in einem Labyrinth. Gerade als die Beklemmung, die sich uns auf die Brust legte, ins Unerträgliche wachsen wollte, stieß unser Führer ein Türchen auf und wir standen plötzlich im Freien. An der Straße, dicht neben unserem Wagen. Wir hatten vorhin absolut nicht bemerkt, dass sich dort ein Eingang befand. Jetzt blickten wir noch einmal zurück – Kuppel an Kuppel, auf einem Fleck von fünfzig Metern im Quadrat zusammengedrängt. Unverständlich, diese Art Siedlung in der heißen, trockenen Steppe.
An ihre Bewohner denken wir hier angesichts der leuchtenden Weite von Meschhed – was müssen erst solche Leute an dieser Stelle empfinden! Langsam rollen wir hinunter und auch uns fällt es nicht schwer, uns wie im Paradies zu fühlen. Gartenanlagen überall, die Straßen feucht und staubfrei, an ihren Seiten mächtige, schattenspendende Bäume.
An einem hübschen, gepflegten Haus lesen wir die Inschrift »British Consulate«. Sehr gut – in der nächsten Karawanserei werden wir uns rasieren und umziehen und dann dem Herrn Konsul unsere Aufwartung machen. Unsere Einreisevisa für Indien müssen ohnehin überprüft werden und außerdem – der englischen Überwachung würden wir ja doch nicht entgehen. Ich muss zugeben, dass sie auf eine außerordentlich diskrete und angenehme Weise durchgeführt wird. Mr. Humber, der Konsul, ist über unsere Reise, über Zweck und Ziel selbstverständlich schon genau unterrichtet. So wie er sie bekommen hat, wird er die Information an seine Kollegen in den nächsten Städten weitergeben. Und genau wie von seinen anderen Kollegen erhalten wir auch von ihm sofort eine Einladung zum Tee, wo man bekanntlich am besten und ganz zwanglos dem Gast auf den Zahn fühlen kann.
Wir wissen schon, dass die vielen offiziellen Einladungen, die wir auf unserer Fahrt von amtlichen Stellen und Konsulaten erhalten, kein Anlass sind, sich besonders geehrt zu fühlen. Manches lichtscheue europäische Gesindel, Abenteurer, auch politische Agenten, treiben sich in Asien herum und es ist daher verständlich, dass jeder Europäer erst einmal gründlich unter die Lupe genommen wird.
Woher? Wohin? Warum? Das interessiert anscheinend nicht nur die Vertreter der europäischen Behörden, sondern auch die Ortsgewaltigen. Denn kaum sind wir mit Mr. Humber bei einer Tasse Tee richtig ins Gespräch gekommen, als ein Polizeibeamter erscheint. Wir haben es unterlassen, uns sofort nach der Ankunft bei der Polizei zu melden – ein arger Verstoß gegen die sehr strikten persischen Vorschriften! Mr. Humber redet uns zu: »Gehen Sie lieber gleich mit, sonst haben Sie nur Schwierigkeiten!«
Ungern unterbrechen wir die gemütliche Teestunde und müssen Mrs. Humber versprechen, morgen wiederzukommen, um das Erlebnis mit den lockenden Früchten bei Abdul Hussein fertig zu erzählen. Auf der Polizei werden wir einem langen Verhör unterzogen und endlich wieder entlassen. Die Pässe behält man zurück.
Im Büro der Anglo-Iranian Oil Company gibt man uns einen Führer zur Besichtigung der Stadt mit. Die berühmte Moschee Imam Risas wollen wir unbedingt sehen und vielleicht auch eine Aufnahme machen. Menschenmassen stauen sich vor den Toren, bunt mischen sich Trachten aus Luristan und Usbekistan, aus Anatolien und Bachtiarien durcheinander. Alles stößt und drängt vorwärts zum Eingang der Moschee.
Ich frage Dschämschid, unseren Führer: »Glaubst du, dass wir hineindürfen?«
»Ausgeschlossen! Selbst in Verkleidung würdet ihr entdeckt werden. Und dann …«
Was dann wäre, wird uns klar, als wir der misstrauischen und bösen Blicke gewahr werden, die uns die Pilger zuwerfen. So richtig unbehaglich fühlen wir diese Blicke, auch von rückwärts scheinen sie uns durchbohren zu wollen, fragend, was wir hier zu suchen haben. Von allen Seiten sind wir umgeben von Gläubigen, die von fern hergekommen sind, um zum großen Gott der Wüste und zu seinem Propheten zu beten.
»Auch wenn ihr unerkannt hineingelangen würdet, so würde euch Mohammed Imam Risa, der Schutzpatron der Moschee, auf seine Art noch prüfen. In der Moschee ist ein Stein, nicht schwer, jeder kann ihn aufheben, wenn er gläubig ist! Da ihr das nicht seid, könntet ihr den Stein nicht heben und wäret verraten …«
Nein, solchen Prüfungen wollen wir uns lieber nicht unterziehen. Aber die große Pilgerschar vor der Moschee im Bild festzuhalten, das kann doch den Zorn des Propheten nicht entflammen?
Dschämschid glaubt, dass wir es wagen können. Wir ziehen uns etwas aus der wogenden Masse zurück bis unter einen der Bäume, die den großen Platz einfassen. Von hier können wir die vielen Menschen und die Moschee übersehen. Mächtig ragen das große Hauptportal und die Minarette gegen den Himmel. Blau und gelb glasierte Kacheln spiegeln das Sonnenlicht. Eine elektrische Uhr von riesigen Ausmaßen ziert das Portal. Sie wirkt wie ein Faustschlag gegen asiatische Zeitlosigkeit.
Helmuth hebt seine Kamera, will abdrücken und fährt erschreckt zusammen: »Aks! Aks!«, brüllt es von allen Seiten. Überall gellen die Rufe: »Bild! Bild!« Die Menge stößt drohend gegen uns vor. Aber schon sind die drei Polizisten zur Stelle, die uns die ganze Zeit beobachteten und scheinbar nur auf einen Zwischenfall gewartet haben. Der erste sagt mit finsterer Miene kurz angebunden »Chavaz«, Helmuth reicht ihm den Ausweis, die unerlässliche Photographiererlaubnis, hin. Der Brave kann aber leider nicht lesen, denn er hält das Schreiben verkehrt und tut nur so, als würde er es durchstudieren. Helmuth dreht freundlich den Chavaz um und zeigt mit dem Finger auf den Anfang der Schrift. Das war ganz falsch, denn jetzt hat er den Polizisten beleidigt! Er packt Helmuth unsanft am Arm und zu dritt machen sie sich daran, ihn abzuführen. Die Menge brüllt vor Begeisterung und zieht in Scharen hinterdrein.
Bis zu dem kleinen Polizeigebäude darf ich Helmuth begleiten, dann wirft man mir die Tür vor der Nase zu und es bleibt mir nichts übrig, als zum englischen Konsul zu fahren. Der Konsul war nicht da, der Konsul spielte Golf.
Weit draußen in der Wüste fand ich ihn. Er war erst beim vierten Loch angelangt, kam aber bereitwillig mit. Helmuth wurde, wie er später erzählte, in einen Hof gebracht, der rings von vergitterten Zellen umsäumt war. Man schob ihn in einen der freien Käfige, schloss ihn ein und er hatte Muße, das üble Gesindel zu betrachten, das in den anderen untergebracht war. Vorher steckte er ganz in orientalischer Ruhe und Manier dem einen Polizisten ein paar Münzen zu und sagte »Tschai«, worauf er promptest mit Tee und Weintrauben versorgt wurde. Als er sich dazu noch eine Zigarette anzündete, erschien auf einmal vor dem Gitter eine Hand – der Nachbar bettelte um Zigaretten. Helmuth machte sich den Spaß, ihm eine ganze Menge in die schmutzigen Finger zu drücken und sah bald, dass es unter den »Verbrechern« gerecht zuging. Zigaretten und Feuer wurden durch die Gitterstäbe weitergereicht, bald rauchten alle, lachten und winkten ihm zu – es war ein Mordsspaß.
Das fand auch der britische Konsul, der das Lachen kaum verbeißen konnte, als er meinen armen Reisegefährten so sitzen sah. Die persischen Polizeioffiziere im Hauptkommando machten viele Verbeugungen und stammelten viele Entschuldigungen. Im Büro bekam Helmuth feierlich seinen Chavaz zurück, dazu wurden Tee und Zigaretten gereicht und man teilte ihm aufs Höflichste mit, überall könne er filmen, nur nicht mehr bei der Moschee.
Nirgends mehr in der Stadt Meschhed hat ein Polizist Helmuth nach seinem Chavaz gefragt, soviel er auch photographierte – sie scheinen auf allen Revieren von dem Vorfall erfahren zu haben.
Dafür sammelten sich immer wieder Scharen von Neugierigen um unseren Wagen und soweit sie englisch oder französisch sprachen, bestürmten sie uns mit Fragen. Ob der Wagen auch schwimmen könne? Selbstredend. Fliegen auch? Na, das ist doch klar. So hatten wir unseren Spaß mit den gläubigen Persern. Einer sagte, das Auto sähe wie ein Panzerwagen aus. Da packte mich der Übermut und ich antwortete: »Ist ja auch einer, hinten steckt unser Maschinengewehr.«
O weh, das hätte ich nicht sagen dürfen! Diesen Scherz benützten die Mollahs, um gegen uns zu hetzen. Sie waren uns gewiss noch gram, dass wir uns in das heilige Geviert der Moschee gewagt hatten. Sie fürchteten für die Schätze von Gold, Silber und Edelsteinen, die dort angesammelt sind. Man hat in Meschhed wohl nicht vergessen, dass noch vor zwanzig Jahren turkmenische Reiter die Moschee stürmten und entheiligten.
Eine höchst aufgeregte Menge umringt uns am nächsten Nachmittag. Sie will das Maschinengewehr sehen! Es hilft nichts, dass wir versichern, wir hätten keins. Es hilft nichts, dass die Polizei die Plache aufhebt und feststellt, wie harmlos der Inhalt unseres Gepäcksraumes ist. Das Volk lässt sich nicht beruhigen. Und die Mollahs tuscheln: »Sie haben doch eins … Und ein Aks, ein Bild von der Moschee, haben sie auch gemacht, die fremden Teufel!«
Es bleibt den fremden Teufeln schließlich nichts übrig, als aus der heiligen – ach, so heiligen! – Stadt schleunigst abzureisen.